
5. Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (NTB 24-05)
Die verschiedenen Phasen (vgl. Kap. 4.2.1) werden für die Umweltbetrachtungen wie folgt zusammengefasst:
-
Bau (Phasen 1, 3 und 5) und Rückbau (Phasen 8 und 9): Bau- und Rückbautätigkeiten, Materialtransporte
-
Betriebsphase (Phasen 2, 4 und 6): Tätigkeiten und Transporte in der Betriebsphase
Die Beobachtungsphase (Phase 7) wird nicht separat betrachtet, da sie gegenüber der Betriebsphase keine zusätzlichen relevanten Umweltauswirkungen hat.
Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Einschätzung der Relevanz der einzelnen, in den folgenden Kapiteln behandelten Umweltbereiche gemäss UVP-Handbuch (BAFU 2009) für die Bau-/Rückbau- und Betriebsphase7.
Tab. 5‑1:Relevanzmatrix
|
Umweltbereiche |
Bau & Rückbau |
Betriebsphase |
|
Luftreinhaltung |
● |
● |
|
Lärm |
● |
● |
|
Erschütterungen / Körperschall |
● |
○ |
|
Nichtionisierende Strahlung (NIS) |
● |
● |
|
Grundwasser |
● |
● |
|
Oberflächengewässer inkl. aquatische Ökosysteme |
● |
○ |
|
Entwässerung |
● |
● |
|
Boden (ohne FFF) |
● |
○ |
|
Fruchtfolgeflächen (FFF) |
● |
○ |
|
Altlasten |
○ |
○ |
|
Abfälle, umweltgefährdende Stoffe |
● |
● |
|
Umweltgefährdende Organismen |
● |
● |
|
Störfallvorsorge / Katastrophenschutz |
● |
● |
|
Wald |
● |
● |
|
Flora, Fauna, Lebensräume |
● |
● |
|
Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen) |
● |
● |
|
Kulturdenkmäler, archäologische Stätten |
● |
○ |
Legende ○ keine resp. irrelevante Auswirkungen
● relevante Auswirkungen vorhanden resp. nicht auszuschliessen
Wie in Fig. 4 6 gezeigt, überlagern sich die Phasen und somit deren Einwirkungen zum Teil. Abdeckend ist davon auszugehen, dass ein gewisses Mass an baulichen Aktivitäten während der ganzen Vorhabensdauer stattfinden wird (vgl. Kap. 4.2.3). Für die Bewertung der Einwirkungen sind die Einwirkungen in den jeweiligen Phasen nach Art. 8 USG sowohl einzeln als auch gesamthaft und nach ihrem Zusammenwirken zu beurteilen. ↩
Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, Stand 1. Januar 2024, SR 814.318.411-1 (LRV)
Luftreinhaltung auf Baustellen. Richtlinie über betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen (Baurichtlinie Luft), Umwelt-Vollzug Nr. 0901, Ergänzte Ausgabe 2016 (BAFU 2016b)
Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten, Vollzug Umwelt VU 5021, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL (Leuenberger & Spittel 2001)
Luftschadstoff-Emissionen des Strassenverkehrs 1990-2060, Stand 2024, Umwelt-Wissen Nr. 1021 (BAFU 2024b)
Handbuch Emissionsfaktoren für stationäre Quellen, aktualisierte Fassung 2020, Bundesamt für Umwelt (BUWAL 2000)
Handbuch der Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs, Stand 8. Juli 2024, HBEFA V 4.2 (INFRAS 2022).
Immissions-Messresultate gemäss www.ostluft.ch (OSTLUFT 2016)
Luftbelastung: Modelle und Szenarien, Konzentrationen der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, Russ und Feinstaub PM10 und PM2.5 (BAFU 2024a)
Karten von Jahreswerten der Luftbelastung in der Schweiz. Datengrundlagen, Berechnungsverfahren und Resultate bis zum Jahr 2022 (Künzle 2023)
Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung vom 9. Dezember 2009, Stand 1. Mai 2016, Baudirektion Kanton Zürich (Verordnung zum Massnahmenplan Luftreinhaltung 2009)
Massnahmenplan Luftreinhaltung – Teilrevision 2016, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL Kanton ZH 2016)
GIS des Kantons Zürich: NO2- und Feinstaubimmissionen Stand 2020, Gesamtverkehrsmodell Kanon Zürich (GVM-ZH 2024)
|
PH-HU1 Luf 01 |
Transporte Ermitteln der Material- und Personentransporte (Bau-/Betriebsphase) zum/vom gTL inkl. der Transportfahrten zwischen gTL und Brennelementverpackungsanlage (BEVA). |
|
PH-HU1 Luf 02 |
Weitere Emissionsquellen Weitere Emissionsquellen (neben Verkehr und Baumaschinen) wie z.B. Feuerungsanlagen werden aufgeführt. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grundsätzliche Erkenntnisse für den Umweltbereich «Luft» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Luf 01 und Luf 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert. Die Anträge 49 und 50 in der Stellungnahme der Abteilung «Koordination Bau und Umwelt» (KOBU) des Kanton Zürichs (vgl. Beilage B1.2) sind, gemäss BAFU (vgl. Beilage B2.1), erst für den UVB 2. Stufe relevant.
Im Projektperimeter selbst sind keine bedeutenden Emissionsquellen vorhanden. Es finden heute lediglich land- und forstwirtschaftliche Nutzungen statt.
Im weiteren Umfeld sind im Ist-Zustand diverse Luftschadstoff-Emissionsquellen vorhanden:
-
Kiesgrube Rütifeld (ARE Kanton ZH 2020) unmittelbar neben der Kiesstrasse (K348) südöstlich des Projektperimeters mit Kies- und Betonwerk, Sortier-, Abbau- und Auffüllbetrieb (rund 10'000 Maschinen-Stunden pro Jahr), Transportverkehr (ca. 63'000 LKW-Fahrten pro Jahr) sowie Förderbänder der Firma KIBAG. Der Betrieb der Kiesgrube stellt eine relevante Vorbelastung des Gebiets bzgl. Luftreinhaltung dar (Emissionen Maschinen und Transporte ca. 7 t NO2 und 100 kg PM10 pro Jahr). Der Kiesabbau wird voraussichtlich 2026 beendet sein, die Auffüllung dauert bis ca. 2044. Die Rekultivierung soll ca. 2045 abgeschlossen sein. Eine Erweiterung des Kiesabbaus südlich der bestehenden Kiesgrube Rütifeld im Gebiet «Langacher» ist gemäss Richtplan vorgesehen (festgesetzt). Der kantonale Gestaltungsplan dafür wird jedoch erst festgesetzt, wenn die Endgestaltung der Kiesgrube Rütifeld einen weit fortgeschrittenen Stand erreicht hat (suisseplan Ingenieure AG 2018).
-
Im Gebiet «Windlacherfeld / Weiach» nördlich des Projektperimeters befinden sich weitere Materialgewinnungsstandorte (ARE Kanton ZH 2014).
-
Verkehr auf dem umliegenden Strassennetz (Zweidlenstrasse, Kiesstrasse / K348, A50, Glattfelderstrasse / HSV7 und Querstrasse), siehe Tab. 4‑3 und Fig. 4‑7 in Kap. 4.4.
Gemäss GIS-ZH (2024) lag der NO2 Jahresmittelwert 2020 bei ca. 12.3 µg/m3, der Jahresmittelwert 2020 für PM10 bei 11.6 µg/m3 und für PM2.5 bei 8.8 µg/m3.
Die Immissionsgrenzwerte (IGW) für die Jahresmittelwerte gemäss Luftreinhalte-Verordnung (Anhang 7 LRV) für NO2 (30 µg/m3), PM10 (20 µg/m3) und PM2.5 (10 µg/m3) werden im Projektperimeter für das Jahr 2020 klar eingehalten. Aufgrund der vom Bund getätigten Anstrengungen zur Luftreinhaltung ist davon auszugehen, dass die Luftschadstoffemissionen gesamtschweizerisch weiter zurückgehen werden (BAFU 2024b). Das BAFU rechnet zudem beim Strassenverkehr zwischen 2010 und 2035 mit einem Rückgang der Emissionen von NOX um rund 70% und von PM10 um rund 80% (BAFU 2024a). Auch die Prognosen des Kantons Zürich für das Jahr 2030 zeigen einen Rückgang der Belastung (vgl. Tab. 5‑2).
Tab. 5‑2:Jahresmittelwerte 2020 und Prognose für 2030 der Luftschadstoffimmissionen im Kanton Zürich (GVM-ZH 2024)
|
Jahresmittelwert (µg/m3) |
Stickstoffdioxide (NO2) |
Feinstaub (PM10) |
Feinstaub (PM2.5) |
|
2020 |
12.3 |
11.6 |
8.8 |
|
2030 |
9.2 |
11.2 |
8.4 |
Es ist davon auszugehen, dass die NO2-Immissionen im Anlagenperimeter künftig sowohl im Jahresmittel wie auch im Tagesmittel deutlich unter dem IGW der Luftreinhalte-Verordnung (Anhang 7 LRV) liegen und damit die Anforderungen einhalten werden.
Die Immissionskarten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zeigen für die Gemeinde Hohentengen a. H. (Siedlungsgebiet rund 2.3 km nordwestlich vom Projektperimeter entfernt, vgl. Fig. 3‑1) im Jahr 2016 einen NO2-Jahresmittelwert von 10.0 µg/m3, der Jahresmittelwert für PM10 lag bei 11.0 µg/m3 und der für PM2.5 bei 8.6 µg/m3 (LGL BW 2024).
Gemäss der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 2010) gelten zum Schutz der menschlichen Gesundheit, die über ein Kalenderjahr gemittelten IGW von 40 µg/m3 für NO2 und PM10 und 25 µg/m3 für PM2.5. In der Gemeinde Hohentengen a. H. werden diese Grenzwerte klar unterschritten. Die LUBW prognostiziert für das Jahr 2025 zudem einen weiteren Rückgang der Luftbelastung (vgl. Tab. 5‑3).
Tab. 5‑3:Jahresmittelwerte 2016 und Prognose für 2025 der Luftbelastung in Hohentengen a. H. (LUBW 2021)
|
Jahresmittelwert (µg/m3) |
Stickstoffdioxid (NO2) |
Feinstaub (PM10) |
Feinstaub (PM2.5) |
|
2016 |
10.0 |
11.0 |
8.6 |
|
2025 |
7.0 |
10.0 |
7.8 |
Emissionen Baustelle
Der Projektperimeter liegt in einem Gebiet, welches im gesamtschweizerischen Durchschnitt eine geringere Bebauungs- und Bevölkerungsdichte aufweist (ø Schweiz per 31.12.2022: 285 Einwohner/km2, Gemeinde Stadel: 183.8 Einwohner/km2; BFS 2022). Die Lage der Baustelle gemäss der Richtlinie «Luftreinhaltung auf Baustellen» (Baurichtlinie Luft; BAFU 2016b) wird damit als «ländlich» bezeichnet. Die einzelnen Bau- resp. Rückbauphasen werden länger als 1.5 Jahre dauern und der Bauperimeter ist grösser als 10'000 m2. Daher sind die Bau- und Rückbauarbeiten gemäss der Baurichtlinie Luft grundsätzlich in die Massnahmenstufe B einzuteilen. Die Maschinen, Geräte und Arbeitsprozesse haben somit dem Stand der Technik gemäss Art. 4 LRV zu entsprechen und es sind die in der Richtlinie vorgeschriebenen Massnahmen umzusetzen.
Angaben zu den Bau- und Rückbauaktivitäten, den Nutzungsintensitäten sowie den Materialflüssen sind in Kap. 4.2 und 4.3 vorhanden.
In allen Bau- und Rückbauphasen werden voraussichtlich durch den Einsatz von dieselbetriebenen (konservative Annahme) Baumaschinen und Geräten sowie durch arealinterne LKW-Bewegungen zusätzliche NOx- und Feinstaub-Emissionen auftreten. Weiter werden durch Schütt- und Umladevorgänge Staubemissionen entstehen.
Die Festlegung der einzelnen konkreten Massnahmen gemäss Baurichtlinie Luft (BAFU 2016b) erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe.
Emissionen Bautransporte
Neben den Bautätigkeiten im Projektperimeter führen die erforderlichen Bautransporte im Projektperimeter und entlang der Transportrouten zu Belastungen (vgl. Fig. 4‑7). In diesem Zusammenhang sind vor allem der Abtransport von Boden, Aushub-, Ausbruch- und Rückbaumaterial sowie die Anlieferung von Baumaterial (Beton, Bewehrung) und Verschlussmaterial relevant.
Am intensivsten sind die Transporte voraussichtlich während der Überlagerung der Phasen 2 (Betrieb Zentraler Bereich) und 3 (Bau SMA). Gemäss Kap. 4.4.2 ist während dieser Phase im Durchschnitt pro Werktag mit ca. 234 LKW-Fahrten sowie 310 PKW-Fahrten zu rechnen (vgl. Tab. 4‑3). In den übrigen Phasen sind die Fahrtenzahlen und somit auch die Emissionen geringer.
Falls technisch und betrieblich möglich sowie mit der Auffüllung der nahe gelegenen Kiesgruben im Umfeld des Projektperimeters terminlich koordinierbar, ist auch ein direkter Transport des Ausbruchmaterials mittels einer Transportförderanlage in eine Kiesgrube denkbar, womit der LKW-Verkehr reduziert werden könnte. Aktuell wird davon ausgegangen, dass für die Verfüllung resp. den Verschluss kein Ausbruchmaterial verwendet werden kann. Das benötigte Material wird von ausserhalb angeliefert.
Gemäss Vollzugshilfe «Luftreinhaltung bei Bautransporten» (Leuenberger & Spittel 2001) handelt es sich vorliegend um eine «grosse Baustelle» (Bauarealfläche > 5'000 m2, Aushubvolumen > 20'000 m3). Grosse Baustellen verursachen gemäss Definition der Vollzugshilfe relevante Bautransport-Emissionen. Weiter legt die Vollzugshilfe für grosse Baustellen Maximal‐ und Zielwerte bezüglich der spezifischen NOX‐, PM10 und CO2‐Emissionen für Schüttguttransporte (Emissionen pro m3 transportiertem Schüttmaterial) fest.
Die obigen Zahlen basieren auf ersten Abschätzungen. Die genauen Mengen von an- und abzutransportierenden Materialien, die Herkunfts- resp. Zielorte (inkl. Deponiestandorte und ‑volumina) und somit die Anzahl Transporte, die Transportmittel -routen- und -distanzen werden für UVB 2. Stufe erhoben und beschrieben. Ebenso werden für diese Stufe die durch Bautransporte verursachten Emissionen berechnet. Weiter erfolgen für den UVB 2. Stufe Abschätzungen sowie eine Beurteilung der spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte sowie allenfalls die Festlegung von Massnahmen.
Strassenverkehr
Während des Einlagerungsbetriebs (Phasen 4 und 6) entstehen Transporte von und zur OFA (vgl. Fig. 4‑7). Dazu zählt der Transport von verpackten radioaktiven Abfällen von der BEVA zur OFA und von leeren Transportbehältern (TB) zur BEVA. Zudem werden Betriebsmittel angeliefert.
Pro Werktag ist in der Phase 4 (ca. 15 Jahre) im Durchschnitt mit maximal 10 LKW- und 300 PW-Fahrten pro Werktag zu rechnen (vgl. Kap. 4.4.2.2 und 4.4.2.5).
Bezogen auf den Verkehr im Ausgangszustand 2040 entspricht dies einer maximalen Erhöhung des DTV um 9.6% und des LKW-Verkehrs um 1.9% auf der Kiesstrasse. Durch die Erhöhung < 10%, werden sich die verkehrsbedingten Emissionen nicht in einem für die Luftreinhaltung (Immissionsbelastung) spürbaren Masse erhöhen. Auf der Querstrasse ist die Verkehrszunahme grösser (beim DTV ca. 55% und beim LKW-Verkehr ca. 36%). Allerdings ist die Grundbelastung der Querstrasse mit rund 550 Fahrten pro Tag (vgl. Tab. 4‑5) relativ gering, daher sind trotz des Zusatzverkehrs keine übermässigen Immissionen entlang der Querstrasse zu erwarten.
In den Phasen 2 und 7 ist der LKW-Verkehr aufgrund der vorgesehenen Aktivitäten des gTL geringer als in der Phase 4 (vgl. Kap. 4.4.2).
Weitere Emissionsquellen
Zu weiteren Emissionsquellen von Luftschadstoffen wie z.B. Feuerungsanlagen oder Notstromaggregate sind zum derzeitigen Projektstand noch keine Informationen vorhanden. Allfällige Emissionen solcher Anlagen werden im Rahmen des UVB 2. Stufe ausgewiesen und beurteilt.
Beim Bau und Rückbau sind je nach Phase unterschiedlich hohe Emissionen durch Bautätigkeiten und Bautransporte zu erwarten. Die Emissionen durch Bauarbeiten (Maschinen und Geräte) sind in der Bau- und Rückbauphase relevant. Bautransporte sind in der Phase 3 am intensivsten, wobei Emissionsberechnungen und daraus folgende Massnahmen erst im UVB 2. Stufe erfolgen.
In der Betriebsphase sind gemäss derzeitigem Kenntnisstand keine relevante Zunahme der verkehrsbedingten Luftschadstoffbelastung resp. keine übermässigen Immissionen (projektbedingte Grenzwertüberschreitungen) zu erwarten. Im UVB 2. Stufe wird dies mittels Berechnungen genauer abgeklärt, die auch das Zusammenwirken von Bau und Betrieb berücksichtigen. Hinsichtlich weiterer Emissionsquellen im Projektperimeter sind präzisere Aussagen zum Einfluss auf die Luftschadstoffbelastung ebenfalls erst im Rahmen des UVB 2. Stufe möglich.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Luftreinhaltung» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Luf 01 |
Zusammenwirken von Emissionen in der Bau- und Betriebsphase Für das Baugesuch werden die Emissionen bei allfälligem Zusammenwirken von Bau- und Betriebstätigkeiten gesamthaft berechnet und ausgewiesen. Das Vorgehen und die dabei anzuwendenden Beurteilungsgrundlagen werden mit den zuständigen Behörden vorgängig abgestimmt. |
|
PH-HU2 Luf 02 |
Transportkonzept Für die Bau-, Betriebs und Rückbauphasen werden Angaben zu Transportfahrzeugen, -routen und -mengen gemacht. |
|
PH-HU2 Luf 03 |
Spezifische Emissionen Schüttguttransporte in der Bauphase Die spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte werden abgeschätzt und beurteilt. |
|
PH-HU2 Luf 04 |
Massnahmen Baustelle und Bautransporte Die auf den Baustellen und bei den Bautransporten umzusetzenden Massnahmen werden dargestellt (inkl. Massnahmen zu Staubemissionen). |
|
PH-HU2 Luf 05 |
Weitere Emissionsquellen in der Bauphase Allfällige weitere Emissionsquellen (neben Verkehr und Baumaschinen) werden aufgeführt und beurteilt. |
|
PH-HU2 Luf 06 |
Beurteilung Luftbelastung in der Betriebsphase Die Auswirkungen der Emissionsquellen im Projektperimeter auf die Luftsituation in der Betriebsphase werden beurteilt (ohne Berechnungen). |
Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986, Stand 1. November 2023, SR 814.41 (LSV)
Zonenplan der Gemeinde Stadel vom 2. Juni 2010 (Gemeinde Stadel 2010)
Zonenplan der Gemeinde Glattfelden vom 21. April 2017 (Gemeinde Glattfelden 2017)
Baulärm-Richtlinie, Bundesamt für Umwelt, Stand 2011 (BAFU 2006a)
Anwendungshilfe zur Baulärm-Richtlinie (Cercle Bruit 2005)
GIS des Bundes: Strassenverkehrs- und Fluglärm (swisstopo 2024)
GIS des Kantons Zürich: ÖREB-Kataster und Angaben zu Lärm (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 Lär 01 |
Massnahmenstufe Baulärm (Bau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Bauphase. |
|
PH-HU1 Lär 02 |
Massnahmenstufe Bautransporte (Bau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Bauphase. |
|
PH-HU1 Lär 03 |
Beurteilung Strassenverkehrslärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Strassenlärmsituation in der Betriebsphase. |
|
PH-HU1 Lär 04 |
Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase. |
|
PH-HU1 Lär 05 |
Massnahmenstufe Baulärm (Rückbau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Rückbauphase. |
|
PH-HU1 Lär 06 |
Massnahmenstufe Bautransporte (Rückbau) Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Rückbauphase. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Lärm» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Lär 03 und 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in ihrer Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Die Anträge 22 – 24 des BAFU sowie 51 und 52 des Kantons Zürich werden im UVB 1. Stufe in den Grundzügen behandelt. Dazu wurde ein Grobkonzept für die Transportwege erstellt und eine erste Einschätzung des Mehrverkehrs vorgenommen (Nagra 2024h und Kap. 4.4.2). Die weiteren Abklärungen erfolgen für den UVB 2. Stufe.
Der Antrag 26 des BAFU wird ebenfalls im UVB 2. Stufe bearbeitet und in dessen Pflichtenheft berücksichtigt. Die Festlegung der Arealzufahrten wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt.
Die Anträge 25 und 27 werden im UVB 2. Stufe berücksichtigt, sofern ein Umladebahnhof erstellt wird. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird erst für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3). Basis dafür ist das Materialbewirtschaftungskonzept für den Bau und den Betrieb des gTLs. Zur Erfüllung des Übereinkommens über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) wird die Nagra einen Espoo-Bericht erstellen und einreichen.
Der Antrag 21 des BAFU (Vollständigkeitsprüfung) wird im UVB 1. Stufe berücksichtigt, indem zum Zusammenwirken (Art. 8 USG) ein abdeckender Fall (Kap. 4.4.2.5, Tab. 4‑3) betrachtet wird. Die Zuordnung aller Lärmemissionen ab Phase 2 zum Betrieb führt dazu, dass diese Lärmemissionen nach LSV zu beurteilen sind; dies würde bedeuten, dass das gTL schon nach der ersten Bauphase dauerhaft als Industrie- und Gewerbeanlage zu betrachten wäre. Gemäss Planung fallen jedoch in Phase 3 noch bedeutende Hoch- und Tiefbauarbeiten und in Phase 9 Rückbauarbeiten an. Diese sind als Bautätigkeiten zu beurteilen. Für rein untertägige Bautätigkeiten (z.B. Phasen 5 und 6) ist eine Beurteilung nach LSV-Anhang 6 vorstellbar. Dem Stand der Planung entsprechend ist mit der Beurteilung eines abdeckenden Falls (vgl. Kap. 4.2.3 und Kap. 4.4.2.5) der Antrag sinngemäss umgesetzt. Für das Baugesuch wird der Ablauf der Bau- und Betriebstätigkeiten genauer geplant und festgelegt und die entsprechenden Emissionen und Berechnungen im UVB 2. Stufe sachgerecht durchgeführt. Im Pflichtenheft für die 2. Stufe wird ein Punkt zur Überprüfung des Zusammenwirkens von Emissionen und der anzuwendenden Beurteilungsgrundlage ergänzt (vgl. Kap. 5.3.7). Sinngemäss werden dieselben Überlegungen auch in das Kapitel Luftreinhaltung ergänzt.
Aus der Stellungnahme als Ganzes ist zu schliessen, dass der Rückbau wiederum als Bautätigkeit zu betrachten ist. ↩
Der Projektperimeter und seine Umgebung befinden sich in Zonen mit der Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) III resp. im Wald ohne ES (vgl. Fig. 5‑1). Ausserhalb des Anlagenperimeters sind keine grösseren Anlagen resp. fixe Bauten geplant, weshalb für Lärmbetrachtungen nur dieser Perimeter betrachtet wird. Die nächstgelegenen Bauzonen mit ES II sind mehr als 800 m vom Anlagenperimeter entfernt. Die Wohngebäude der Landwirtschaftsbetriebe Sali und Bäumler (vgl. Fig. 3‑1) befinden sich rund 120 m resp. 250 m vom Anlagenperimeter entfernt und liegen in der ES III.
Der Weidhof wird vor der Realisierung des Projekts zurückgebaut (vgl. Kap. 3.5.2). Diese Gebäude entfallen bei der Lärmbetrachtung.
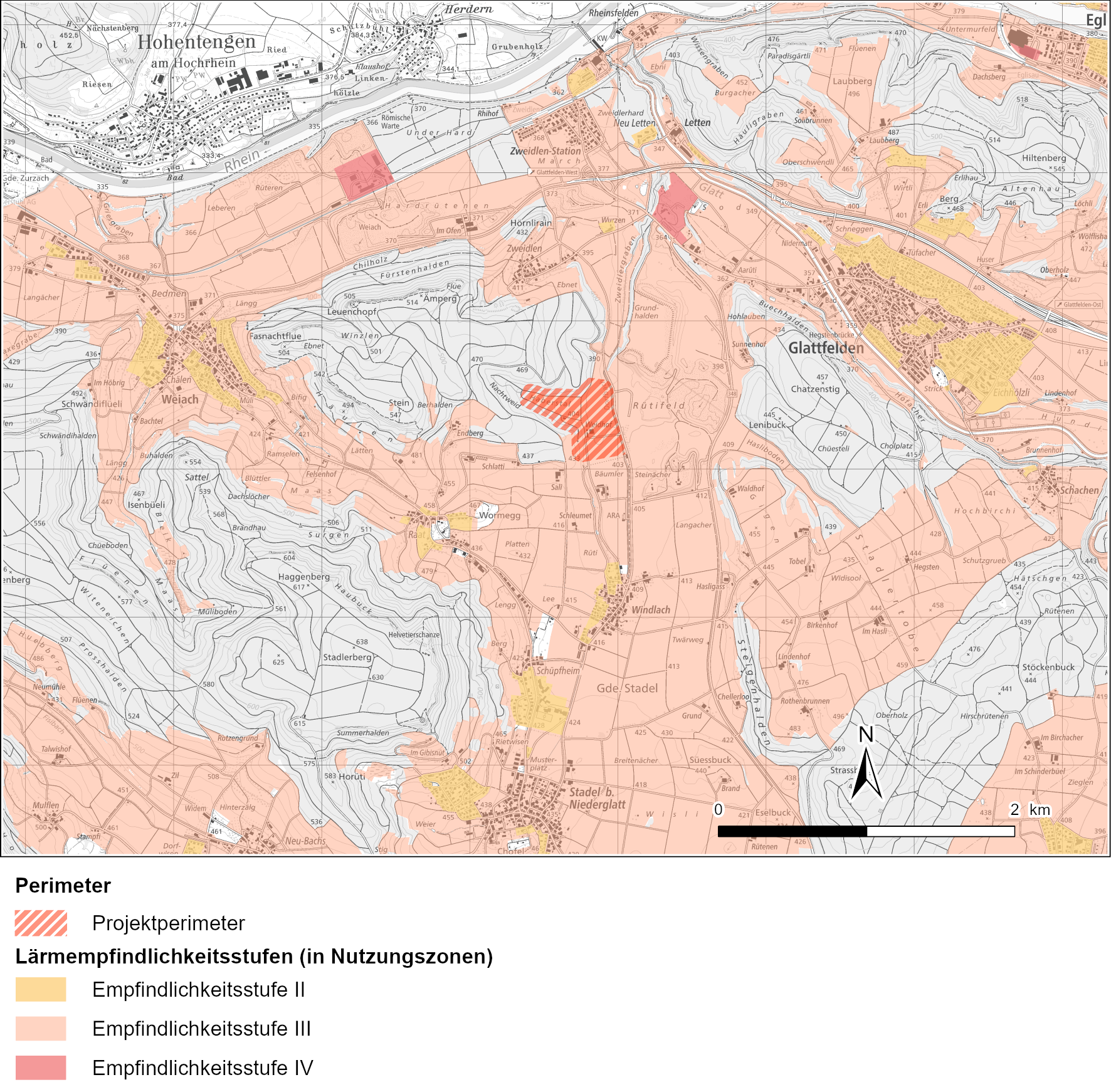
Fig. 5‑1:Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen; GIS-ZH 2024)
Die Distanz des Projektperimeters zur deutschen Grenze beträgt rund 2 km (vgl. Fig. 5‑1), wobei das nächstgelegene Siedlungsgebiet nördlich der Grenze von Hohentengen a. H. rund 2.3 km entfernt liegt9. Die bewaldete Erhebung Ämperg unterbricht die Sichtverbindung nach Nordwesten und schirmt Gebiete in diese Richtung von Lärm ab.
Lärm-Emissionsquellen in der Umgebung des Anlagenperimeters
Der Anlagenperimeter ist von Fluglärm betroffen. Gemäss Belastungskataster Kanton Zürich (GIS-ZH 2024) werden die IGW der ES III für Fluglärm im Projektperimeter tags und nachts eingehalten.
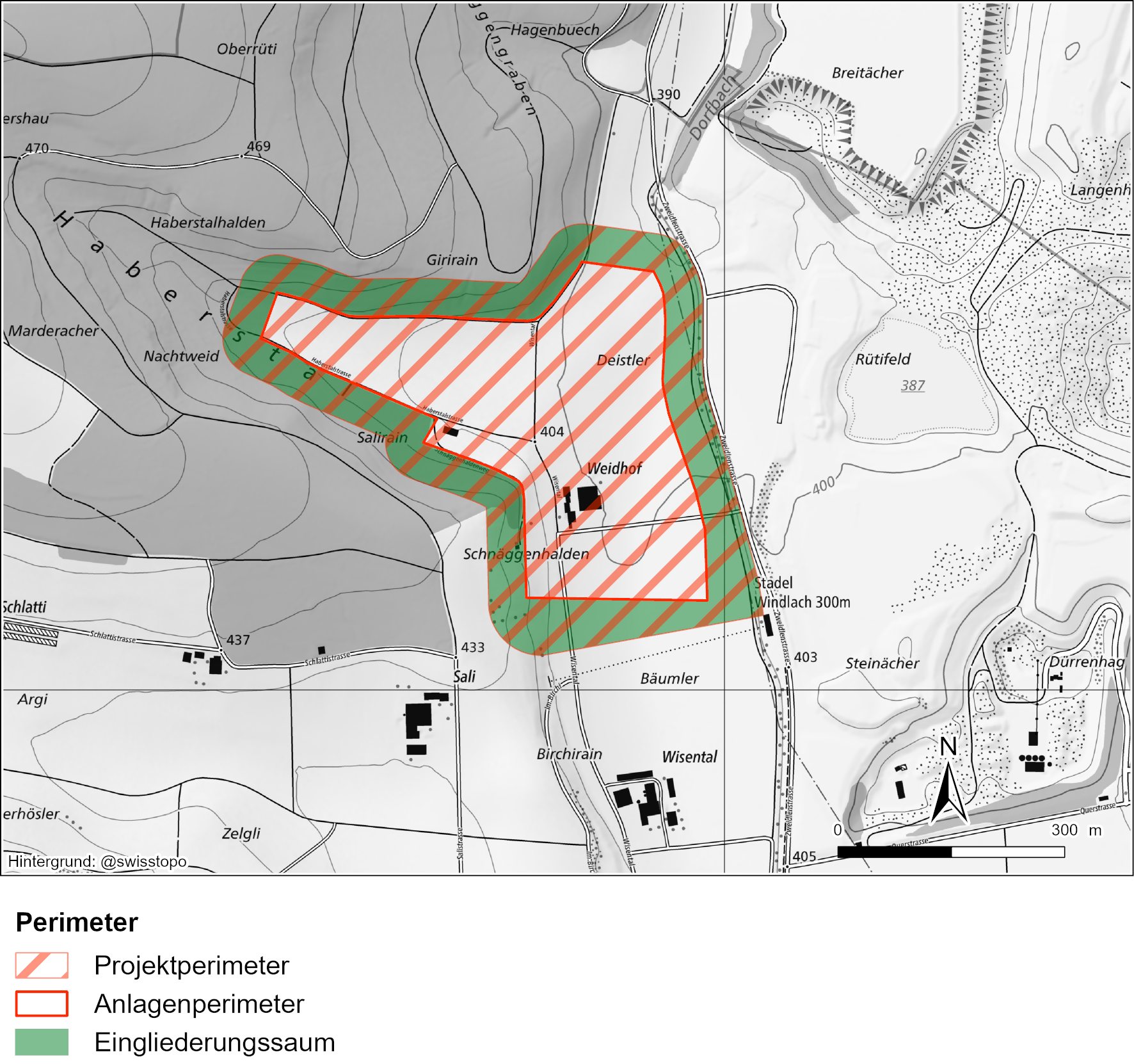
Fig. 5‑2:Gefahrenzonen der Schiessanlage Stadel-Windlach (Schweizer Armee 2021)
Weiter befindet sich südlich des Anlagenperimeters die Schiessanlage Stadel-Windlach (vgl. Fig. 5‑2). Im Schiesslärmkataster des Kantons Zürich sind dazu keine Daten vorhanden.
Daneben führt die Verbindungstrasse / Zweidlenstrasse (mit wenig Verkehr, DTV schätzungsweise zwischen 200 bis 400 Fahrzeuge pro 24 Stunden) am Anlagenperimeter vorbei. Die Querstrasse (DTV ca. 570) liegt in einer Distanz von knapp 100 m zum Anlagenperimeter. Die Kiesstrasse (DTV ca. 3'220) befindet sich in einer Entfernung von rund 600 m. Im Anlagenperimeter sind folglich heute keine relevanten Strassenlärmbelastungen vorhanden.
Die grösste und wichtigste Lärm-Emissionsquelle in der Umgebung befindet sich in rund 350 m Entfernung östlich des Anlagenperimeters und stammt vom Betrieb der Kiesgrube Rütifeld (Kies- und Betonwerk, Sortier-, Abbau- und Auffüllbetrieb mit rund 10'000 Maschinen-Stunden pro Jahr, Transportverkehr mit ca. 63'000 LKW-Fahrten pro Jahr sowie Transportförderanlagen).
Ausserdem befindet sich die Bahnstrecke Koblenz – Bülach rund 1.5 km nördlich des Anlagenperimeters. Der Eisenbahnverkehr (S36) auf der SBB-Bahnlinie erzeugt heute infolge des Stundentakts zwischen 5:00 und 24:00 Uhr geringe Lärmemissionen. Zwischen Zweidlen-Station und Weiach befindet sich ein privat genutzter Gleisabschnitt nördlich der SBB-Bahnlinie, welcher durch die Weiacher Kies AG für den Kiesverlad verwendet wird und im Bereich der Kiesgrube Rüteren mit einem Verladebahnhof ausgestattet ist. Weitere Anlagen für den Gütertransport sind der Annahmebahnhof mit Freiverlad in Zweidlen-Station sowie der Annahmebahnhof bei Weiach-Kaiserstuhl. Gemäss swisstopo (2024) ist tags nur innerhalb eines Korridors von ca. 70 – 80 m beidseits der Trasse mit einer Überschreitung des Beurteilungspegels durch den Bahnverkehr zu rechnen, nachts nur im unmittelbaren Nahbereich. Der Anlagenperimeter weist daher infolge des Abstands von 1.5 km zur Bahnlinie tags und nachts keine wahrnehmbare Lärmbelastung durch den Bahnverkehr auf.
Die Distanz zwischen einem allfälligen Umladebahnhof entlang der Bahnlinie und dem Siedlungsgebiet von Hohentengen a. H. beträgt rund 600 m. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird erst für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3). ↩
Lärmemissionen durch Bauarbeiten sowie durch Bautransporte entstehen während der gesamten Bauphasen, mit Schwerpunkt bei Hoch-, Tief- und Rückbautätigkeiten (Phasen 1, 3, 9, vgl. Kap. 4.2). Die Emissionen gehen vom gesamten Projektperimeter und den beschriebenen Transportrouten aus (vgl. Kap 4.4.1). Zeitgleich mit den Bauarbeiten finden zwischen den Phasen 2 und 6 auch Betriebsaktivitäten statt (vgl. Fig. 4‑6), wobei letztere deutlich weniger Lärm verursachen, weil die Arbeiten v.a. untertage stattfinden(vgl. Kap. 4.2).
Emissionen Baustelle
Die mit den Bauarbeiten in Zusammenhang stehenden Lärmemissionen (Baumaschinen und Geräte, Materialumschlag, lärmintensive Tätigkeiten wie Rammarbeiten) führen in der Umgebung zu zusätzlichen Lärmbelastungen. Die Beurteilung von Baulärm (Festlegen Massnahmenstufe) und die Ausarbeitung entsprechender Schutzmassnahmen werden gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie vorgenommen (BAFU 2006a). Grundsätzlich sind Massnahmen erforderlich, wenn:
-
sich Räume mit lärmempfindlicher Nutzung in einem Abstand von ≤ 300 m zur Baustelle befinden resp. ≤ 600 m, falls Bauarbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch (12 bis 13 Uhr und 19 bis 07 Uhr) stattfinden;
-
die «lärmige Bauphase» oder die «lärmintensiven Bauarbeiten» länger als 1 Woche dauern.
In allen Bau- und Rückbauphasen sind jeweils «lärmige Bauphasen» mit einer Dauer von mehr als 1 Jahr zu erwarten (vgl. Kap. 4.2.1).
Innerhalb von 300 m befinden sich zwei lärmempfindliche Nutzungen in der ES III, die Wohngebäude der Höfe Sali (120 m) und Bäumler (250 m). Im Eingliederungssaum besteht die Möglichkeit, lärmabschirmende Massnahmen gegen Süden umzusetzen, welche den Bäumlerhof zum Anlagenperimeter hin bzgl. Lärm abzuschirmen vermögen. Der Salihof befindet sich rund 30 m höher gelegen als das mittlere Terrain des Anlagenperimeters und wird zudem nach Nordosten hin grösstenteils von einem bewaldeten Hang abgeschirmt. Dies wirkt sich günstig auf die Lärmexposition aus. Innerhalb von 600 m befinden sich weitere lärmempfindliche Nutzungen (Wohnen) in der Landwirtschaftszone mit ES III.
Für die Bauarbeiten gilt damit generell für die regulären Arbeitszeiten die Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006a). Für Bauarbeiten in den übrigen Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen gilt die Massnahmenstufe C. Sofern die lärmintensiven Bauarbeiten pro Phase weniger als 1 Jahr dauern, gelten dieselben Massnahmenstufen. Die Quantifizierung der Lärm-Emissionen sowie die Festlegung der einzelnen Massnahmen gemäss Baulärm-Richtlinie erfolgt für den UVB 2. Stufe. Im Rahmen des Bauprojekts wird für den UVB 2. Stufe zudem untersucht und mit der Behörde abgestimmt, ob für gewisse mit Betriebstätigkeiten zusammenwirkende Bautätigkeiten eine Lärmbeurteilung des gTL nach Anhang 6 LSV vorzusehen ist.
Emissionen Bautransporte
Bautransporte (Materialtransporte) auf dem Areal und entlang der genutzten Transportrouten verursachen Lärmbelastungen (vgl. Fig. 4‑7). In diesem Zusammenhang ist vor allem der Abtransport von Boden, Aushub-, Ausbruch- und Rückbaumaterial sowie die Anlieferung von Baumaterial (Beton, Bewehrung) und Verschlussmaterial relevant.
Am intensivsten sind die Transporte voraussichtlich während der Phase 3 (Bau SMA), wobei parallel zu dieser Phase auch Aktivitäten der Phase 2 stattfinden (vgl. Fig. 4‑6, abdeckender Fall Tab. 4‑3), wobei bzgl. Emissionen die Bautransporte deutlich überwiegen. Gemäss Kap. 4.4.2 ist während dieser Zeit im Durchschnitt pro Werktag mit maximal 234 LKW-Fahrten (davon 230 Bautransporte) sowie 310 PKW-Fahrten (davon 160 für den Bau) zu rechnen (vgl. Tab. 4‑3). In der Phase 1 (Bau OFA) ist mit ca. 130 und in der Phase 5 (Bau HAA, mit paralleler Einlagerung Phase 6) mit ca. 180 Transportfahrten (LKW, davon 170 für den Bau) zu rechnen. Für die Transporte der Phasen 2 und 3 gilt somit tags (06 – 22 Uhr) die Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-Richtlinie (Schwellenwert von 940 Fahrten pro Woche Bauzeit für Hauptverkehrs- und Hochleistungsstrassen überschritten). Für die Bautransporte in den übrigen Phasen gilt die Massnahmenstufe A. Es wird davon ausgegangen, dass in der Nacht (22 – 06 Uhr; wobei zwischen 22 – 05 Uhr ein Lastwagenfahrverbot gilt) höchstens vereinzelte Bautransporte stattfinden und somit für diese Transporte ebenfalls die Massnahmenstufe A gilt.
Falls technisch und betrieblich möglich sowie mit der Auffüllung der nahe gelegenen Kiesgruben im Umfeld des Projektperimeters terminlich koordinierbar, ist auch ein direkter Transport des Ausbruchmaterials mittels einer Transportförderanlage (welche ebenfalls Lärm verursacht) in eine Kiesgrube denkbar, womit der LKW-Verkehr reduziert würde. Nach aktuellem Projektstand wird für die Verfüllung resp. den Verschluss des gTL kein Ausbruchmaterial verwendet, weshalb das Verschlussmaterial voraussichtlich von ausserhalb angeliefert werden muss.
Die genauen Mengen von an- und abzutransportierenden Materialien, die Herkunfts- resp. Zielorte (inkl. Deponiestandorte und -volumina) und somit die Anzahl Transporte, die Transportmittel, -routen und -distanzen werden im UVB 2. Stufe beschrieben und dem aktuellen Verkehr gegenübergestellt und beurteilt.
Strassenverkehrslärm
Während des Einlagerungsbetriebs (Phasen 4 und 6) entstehen Transporte von und zur OFA (vgl. Fig. 4‑7). Dazu zählt der Transport von verpackten radioaktiven Abfällen von der BEVA zur OFA und von leeren TB zur BEVA. Zudem werden Betriebsmittel angeliefert.
Pro Werktag ist in der Phase 4 (zwischen ca. 2050 und 2065) im Durchschnitt mit maximal 10 LKW- und 300 PW-Fahrten pro Werktag zu rechnen (vgl. Kap. 4.4.2). In der Beobachtungsphase (Phase 7) geht der Verkehr weiter zurück. Die neuen Arealzufahrten zum gTL ab dem bestehenden Strassennetz sind grundsätzlich als neue Verkehrsanlagen nach Art. 7 LSV zu beurteilen.
Durch die geringfügige Erhöhung des Verkehrsaufkommens aufgrund der wenigen Transporte während der Betriebsphase werden sich die verkehrsbedingten Emissionen auf den Transportrouten voraussichtlich nicht in einem wahrnehmbaren Masse, d.h. eine Zunahme um 1 dB(A) oder mehr erhöhen (mit Ausnahme der Querstrasse, bei welcher aber die Grundbelastung sehr gering ist und auch mit dem Zusatzverkehr keine übermässigen Immissionen verursacht werden). Wie stark sich die Strassenlärmbelastung durch den Zusatzverkehr erhöht, wird im Rahmen des UVB 2. Stufe abgeklärt und bewertet.
Industrie- und Gewerbelärm
Zu weiteren relevanten Lärmemissionsquellen wie z.B. Lüftungs- und Kühlungsanlagen, Fahrzeugbewegungen und Parkierungsvorgänge innerhalb des Anlagenperimeters (Industrie- und Gewerbelärm) sind zum aktuellen Projektstand erst grobe Informationen vorhanden (vgl. Kap. 4.2.5). Für Gebäude mit lärmempfindlicher Nutzung (Wohnbauten) sind für den UVB 2. Stufe im Falle von Planungswertüberschreitungen Lärmschutzmassnahmen vorzusehen, welche entweder im Anlagenperimeter (Lärmreduktion an der Quelle) und/oder im Eingliederungssaums (z.B. mit Abschirmungsmassnahmen) umgesetzt werden.
Beim Bau und Rückbau sind je nach Phase unterschiedlich hohe Lärmemissionen durch Bautätigkeiten und Bautransporte (inkl. LKW-Bewegungen im Anlagenperimeter) zu erwarten. Die Emissionen durch Bauarbeiten (Maschinen und Geräte) sind in der Bau- und Rückbauphase relevant. Aufgrund des heutigen Projektstands können noch keine genaueren Angaben zu den Emissionen und deren Zusammenwirken gemacht werden. Innerhalb des gemäss Baulärm-Richtlinie massgebenden Abstands von 300 m resp. 600 m zum Anlagenperimeter befinden sich lärmempfindliche Nutzungen, welche bzgl. der konkreten Auswirkungen während des Baus/Rückbaus zu berücksichtigen (Festlegen Massnahmenstufe) und für den UVB 2. Stufe geeignete Lärmschutzmassnahmen festzulegen sind.
Bautransporte sind in der Phase 3 (überlagert mit Phase 2, abdeckender Fall, Tab. 4‑3) am intensivsten. Für die Bautransporte in dieser Phase gelten daher tags erhöhte Anforderungen (Massnahmenstufe B gemäss Baulärm-Richtlinie), für die übrigen Phasen gilt die Massnahmenstufe A. Die vorläufigen Massnahmenstufen werden für den UVB 2. Stufe überprüft. Weiter werden für den UVB 2. Stufe die Anzahl Transporte, die Transportmittel, -routen und -distanzen beschrieben (basierend auf dem Materialbewirtschaftungskonzept) und dem aktuellen Verkehr gegenübergestellt und beurteilt.
In der Betriebsphase ist gemäss derzeitigem Kenntnisstand mit keiner relevanten Zunahme der Strassenlärmbelastung zu rechnen. Für den UVB 2. Stufe wird dies überprüft. Dabei werden der induzierte Zusatzverkehr auf den benutzten Routen sowie die damit verbundene Zunahme der Strassenlärmemissionen aufgezeigt und beurteilt.
Hinsichtlich Industrie- und Gewerbelärm beim Einlagerungsbetrieb wird aufgrund der Distanz zu den nächstliegenden lärmempfindlichen Nutzungen (Höfe Sali und Bäumler in einer Distanz von 120 m resp. 250 m) davon ausgegangen, dass die massgebenden Planungswerte eingehalten werden können. Dies wird im Rahmen des UVB 2. Stufe überprüft.
Das Zusammenwirken von Emissionen aus Bau- und Betriebstätigkeiten und die für deren Beurteilung anzuwendende Beurteilungsgrundlage wird für den UVB 2. Stufe mit der zuständigen Behörde abgestimmt, sobald die zugehörigen Planungen vorliegen
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Lärm» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Lär 01 |
Zusammenwirken von Emissionen in der Bau- und Betriebsphase Für das Baugesuch werden die Emissionen bei allfälligem Zusammenwirken von Bau- und Betriebstätigkeiten gesamthaft berechnet und ausgewiesen. Das Vorgehen und die dabei anzuwendenden Beurteilungsgrundlagen werden mit den zuständigen Behörden vorgängig abgestimmt. |
|
PH-HU2 Lär 02 |
Transporte (ohne Ausnahmetransporte) während Bau-/Rückbau- und Betriebsphase Die Transportrouten werden unter Berücksichtigung von Siedlungsgebieten ausgewiesen und der zu erwartende Mehrverkehr dem vorhandenen Verkehr gegenübergestellt. |
|
PH-HU2 Lär 03 |
Massnahmen Baulärm (inkl. Bautransporte) Überprüfung und Festlegung der Massnahmenstufen sowie Aufzeigen der notwendigen Massnahmen gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie. |
|
PH-HU2 Lär 04 |
Beurteilung Strassenverkehrslärm in der Betriebsphase Die Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Strassenlärmsituation werden beurteilt. Die neuen Arealzufahrten zum gTL ab dem bestehenden Strassennetz werden als neue Anlagen nach Art. 7 LSV beurteilt. |
|
PH-HU2 Lär 05 |
Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm (Betriebsphase) Die Lärmquellen im Projektperimeter werden in einem Plan dargestellt und die jeweiligen Betriebszeiten angegeben. Die Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase werden beurteilt sowie bei Bedarf geeignete Lärmschutzmassnahmen festgelegt. |
Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden, DIN-Norm 4150, Teil 2, Juni 1999 (DIN 1999)
Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober 1983, Stand 1. Januar 2024, SR 814.01 (USG 1983)
Erschütterungswirkungen auf Bauwerke, VSS-04312 (VSS 2019b)
|
PH-HU1 Ers 01 |
Bauphase und Baumethoden Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Bauphase auftreten können. |
|
PH-HU1 Ers 02 |
Rückbauphase Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Rückbauphase auftreten können. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Ers 01 und 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 den folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Der Antrag 28 wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Erschütterungsemissionen auf deutschem Staatsgebiet sind höchstens von einem Umladebahnhof entlang der Bahnlinie zu erwarten (vgl. Kap. 4.4.3 resp. Fig. 4‑7). Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs sowie dessen Standort und Ausgestaltung wird im Rahmen des Baugesuchs getroffen. Entsprechend werden die Umweltauswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt. Zur Erfüllung des Übereinkommens über die UVP im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention) wird die Nagra zum UVB 2. Stufe einen Espoo-Bericht erstellen und einreichen.
In der nahen Umgebung des Projektperimeters sind keine relevanten Erschütterungsquellen vorhanden. Das Kiesabbau- resp. Deponiegebiet befindet sich rund 260 m östlich des Projektperimeters. Das zugehörige Kies- und Betonwerk befindet sich in der Südostecke des Abbaugebiets in einem Abstand von rund 700 m zum Projektperimeter. Vom Betrieb der Kiesgrube resp. des Kies- und Betonwerks sowie der Aushubdeponie sind keine für den Anlagenperimeter relevanten Erschütterungs- und Körperschallimmissionen zu erwarten.
Die Zweidlenstrasse ist eine wenig befahrene Verbindungsstrasse (vgl. Kap. 4.4) und verläuft in einem Abstand von ca. 50 m entlang der Ostseite des Projektperimeters. Von der Zweidlenstrasse sind daher keine für den Anlagenperimeter relevanten Erschütterungs- und Körperschallimmissionen zu erwarten.
Aufgrund des kiesigen Untergrunds der Niederterrassenschotter im Windlacherfeld und der darüber liegenden quartären Ablagerungen (Gehängelehm- und Bachschuttablagerungen; vgl. Kap 3.4) ist die Ausbreitung und Übertragung von Erschütterungen im oberflächennahen Untergrund voraussichtlich schwach. Die nächstgelegenen Liegenschaften sind das Schützenhaus Stadel-Windlach unmittelbar südlich des Anlagenperimeters, das Wohngebäude des Salihof (120 m Luftdistanz, jedoch erhöht gelegen) südöstlich des Anlagenperimeters, das Wohngebäude des Bäumlerhofs (250 m Luftdistanz) südlich des Anlagenperimeters. Das Siedlungsgebiet von Hohentengen a. H. (D) liegt rund 2.3 km nördlich des Projektperimeters und ist somit von Erschütterungen nicht betroffen10.
Die Gebäude des Weidhofs werden vor der Realisierung des Projekts zurückgebaut (vgl. Kap. 3.5.2). Sie entfallen bei der Betrachtung bzgl. Erschütterung und Körperschall.
Die Distanz zwischen einem allfälligen Umladebahnhof entlang der Bahnlinie und dem Siedlungsgebiet von Hohentengen a. H. beträgt rund 600 m. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird erst für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3). ↩
Für das RBG werden aufgrund des aktuellen Projektstands noch keine Baumethoden festgelegt. Relevant bzgl. Erschütterungsemissionen während der Bauphase ist vor allem die Wahl der Schachtabteufungsmethode. Die höchsten Erschütterungsemissionen sind in den Phasen 1 und 3 während rund 10 Jahren zu erwarten, wobei insbesondere die oberflächennahen Arbeiten spürbare Erschütterungen auslösen können. Aufgrund der Distanz > 100 m der nächstgelegenen Höfe zum Anlagenperimeter, ist mit keinen relevanten Erschütterungs- und Körperschallimmissionen zu rechnen.
Unabhängig von der gewählten Vortriebsmethode auf Lagerebene ist nicht davon auszugehen, dass Erschütterungen untertage an der Oberfläche noch wahrnehmbar sein werden.
Durch die Bautransporte können Erschütterungen auf den Arealerschliessungstrassen auftreten. Die Transportrouten für LKW-Verkehr verlaufen vom Projektperimeter über die Querstrasse und dann entweder nach Norden Richtung Weiach oder nach Osten Richtung Kiesstrasse (vgl. Fig. 4‑7). Daher sind für die Höfe Sali (westlich, jedoch erhöht gelegen) und Bäumler (südlich) keine Erschütterungsauswirkungen bzgl. Bautransporte zu erwarten. Die Ortschaft Windlach wird aufgrund des LKW-Fahrverbots nicht tangiert.
Weitere Erschütterungsemissionen entstehen durch den Rückbau der Gebäude in den Phasen 8 und 9. Dabei sind keine Erschütterungsauswirkungen auf die beiden naheliegenden Höfe im Sali und Bäumler und das Schützenhaus Stadel-Windlach zu erwarten, ebenso auf weiter entfernt liegende Gebiete.
Während der Betriebsphase (Anlieferung von Verschlussmaterialien und Endlagerbehälter) sind Erschütterungen durch den Strassenverkehr aufgrund der geringen zu erwartenden Anzahl Transportbewegungen (vgl. Kap. 4.4.2) vernachlässigbar.
Beim Bau und Rückbau kann es auf dem Anlagenperimeter zu erschütterungsrelevanten Arbeiten kommen, deren Auswirkungen jedoch zum heutigen Zeitpunkt aufgrund der noch nicht festgelegten Baumethoden noch nicht beurteilt werden können. Für die künftige Projektierung wird anhand der gewählten Baumethoden beurteilt, ob dadurch relevante Auswirkungen bzgl. Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall zu erwarten sind. Ggf. sind für den UVB 2. Stufe geeignete Massnahmen zu definieren.
In der Betriebsphase sind aufgrund der geringen Anzahl Transportbewegungen keine relevanten Auswirkungen betreffend Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall zu erwarten. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu bestätigen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 Ers 01 |
Erschütterungen während der Bauphase Die Auswirkungen der gewählten Baumethoden werden beschrieben, analysiert und ggf. geeignete Massnahmen definiert. |
|
PH-HU2 Ers 02 |
Erschütterungen während der Betriebsphase Es wird bestätigt, dass während der Betriebsphase keine relevanten Erschütterungen auftreten. |
|
PH-HU2 Ers 03 |
Erschütterungen während der Rückbauphase Die Auswirkungen der gewählten Baumethoden werden beschrieben, analysiert und ggf. geeignete Massnahmen definiert. |
-
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999, Stand 1. November 2023, SR 814.710 (NISV)
-
Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV, Vollzug Umwelt VU 5801 (BUWAL 2002a)
-
Standorte von Sendeanlagen in der Schweiz (BAKOM 2022)
-
Hochspannungsleitung Vollzugshilfe zur NISV, Vollzugs-, Berechnungs- und Messempfehlung. Entwurf zur Erprobung, Juni 2007 (BAFU 2007)
-
Vorlage für die Beurteilung von Trafostationen (ESTI 2022)
|
PH HU1 NIS 01 |
Eruieren von NIS-Quellen Es werden Aussagen zu den massgebenden vorhandenen NIS-Quellen gemacht. |
|
PH HU1 NIS 02 |
Geplante NIS-relevante Anlagen Aufzeigen der Details zu NIS-relevanten Anlagen des Projekts inkl. Erstellen aller Standortdatenblätter für NIS-Anlagen, welche zum Projekt gehören oder im Rahmen des Projekts erstellt werden. |
|
PH HU1 NIS 03 |
Schutzmassnahmen gegenüber Anlagen Dritter Aufzeigen, ob Grenzwerte an OMEN aufgrund Anlagen Dritter eingehalten werden können. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «NIS» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 NIS 02 und 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
In der Umgebung des Anlagenperimeters sind heute die nachfolgenden NIS-Emissionsquellen vorhanden (vgl. Fig. 5‑3):
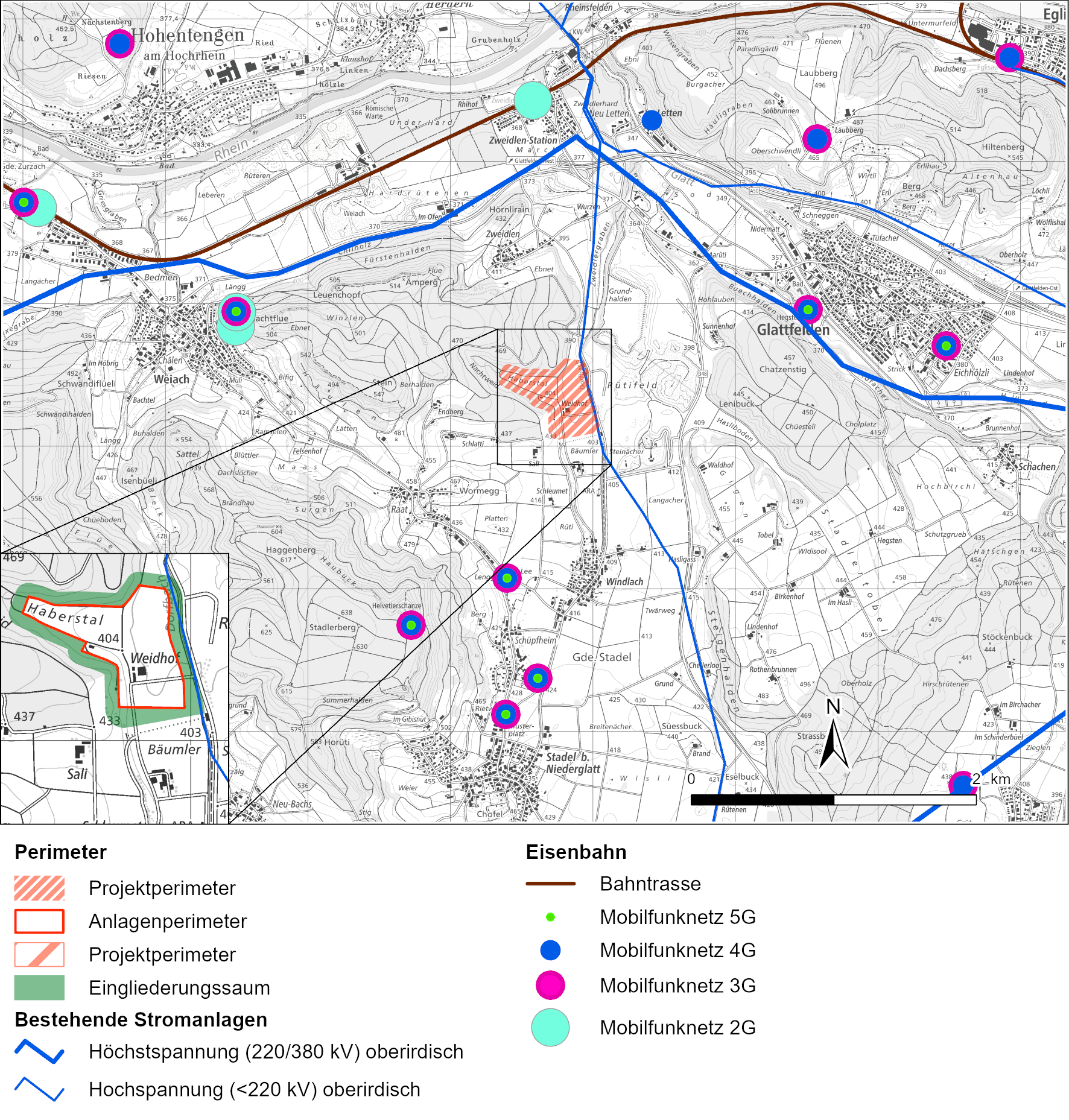
Fig. 5‑3:Antennenstandorte, Bahntrassen und Hochspannungsleitungen im Umkreis des geplanten Projektperimeters (swisstopo 2024)
-
Hochspannungs-Überlandleitung (2 x 110 kV) der Axpo von Zweidlen-Station nach Neerach, die zwischen dem Dorfbach und der Zweidlenstrasse östlich des Anlagenperimeters entlangführt und den Eingliederungssaum, wie auch die Arealzufahrten kreuzt.
-
Mehrere Mobilfunk-Sendeantennen stehen in Windlach (Flur «im Lee»), bei Zweidlen-Station (Flur «im March») unweit der A50-Ausfahrt Glattfelden West und ca. 1.9 km vom Anlagenperimeter entfernt und neben der Ortschaft Glattfelden (Flur «im Mittlerwisen»). Die Sendeanlagen «im Lee» (Kenn-Nr. 27902, 27903 und 27906 mit 2 x mittlerer und 1 x grosser Sendeleistung) befindet sich in einem Abstand von rund 1.3 km zum Anlagenperimeter. Die Sendeanlage «im March» (Kenn-Nr. 37, mittlere Sendeleistung) wird von den Ausläufern des «Ämperg» und der Erhöhung «Hörnlirain» verdeckt und daher vollständig gegen den Projektperimeter abgeschirmt. Die gleiche Situation trifft auf die Sendeanlage «im Mittlerwisen» (Kenn-Nr. 23218, 23219 und 23223 mit 2 x mittlerer und 1 x grosser Sendeleistung) zu. Diese liegt 1.7 km östlich des Projektperimeters hinter dem «Chatzenstig». Aufgrund der Entfernung der Emissionsquellen zwischen 1.3 und 1.9 km ist mit keiner relevanten Belastung des Anlagenperimeters zu rechnen.
Bei den oben genannten Anlagen handelt es sich um sogenannte «altrechtliche Anlagen», welche vor Inkrafttreten der NISV am 1. Februar 2000 erstellt wurden (NISV 1999). Die Einhaltung der Grenzwerte bei den umliegenden «Orten mit empfindlichen Nutzungen» (OMEN) bzw. die Sanierung der Anlagen wird durch die jeweiligen Betreiber der Anlage sichergestellt. Die oben aufgeführte Hochspannungsleitung der Axpo ist bereits saniert (Einbau Erdleiter bzw. Phasenoptimierung).
Die Stromversorgung des gTLs erfolgt voraussichtlich über die Mittelspannungsverteilung des öffentlichen Stromnetzes. Dafür werden gemäss aktuellem Projektstand mehrere Transformatorenstationen (Trafostationen) im Anlagenperimeter installiert (Nagra 2024a), wobei noch keine abschliessende Aussage über die neuen NIS-Quellen gemacht werden kann.
Grundsätzlich sind Trafostationen mit genügendem Abstand bzw. einer entsprechenden Abschirmung gegenüber den ständigen Aufenthaltsorten der Mitarbeitenden zu platzieren. Im Rahmen des UVB 2. Stufe werden allenfalls notwendige NIS-Schutzmassnahmen ausgearbeitet resp. konkretisiert.
Während der Betriebsphase müssen allfällige bestehende oder neue Trafostationen auf dem Areal überprüft und ggf. abgeschirmt werden, so dass der massgebende Anlagegrenzwert zu OMEN eingehalten werden kann. Für den UVB 2. Stufe werden allenfalls notwendige NIS-Schutzmassnahmen ausgearbeitet resp. konkretisiert.
Die Hochspannungsleitung bleibt nach aktuellem Planungsstand unverändert bestehen. Gemäss schriftlicher Rückmeldung der Leitungseigentümerin Axpo Grid AG kann der Anlagegrenzwert im für die OFA relevanten Leitungsabschnitt zwischen den Masten Nr. 11 – 13 in einem Horizontalabstand von rund 20 m eingehalten werden8. Eine mögliche Überschreitung des Anlagegrenzwerts betrifft somit mehrheitlich den Eingliederungssaum, in welchem gemäss aktuellem Planungsstand keine Orte mit empfindlichen Nutzungen vorgesehen sind. Die genaue Ausdehnung des NIS-Felds der Hochspannungsleitung wird für den UVB 2. Stufe berechnet, so dass die relevanten einzuhaltenden Abstände sowie allfällige Schutzmassnahmen für das Baugesuch berücksichtigt werden können.
Auskunft der AXPO Grid AG (Trassesicherung) vom 01.02.2024 per E-Mail ↩
Für die Realisierung des Vorhabens sind gemäss aktueller Planung in allen Phasen Trafostationen nötig. Sie werden so geplant, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten werden.
Von den vorhandenen NIS-Quellen sind für den Anlagenperimeter keine relevanten Auswirkungen oder grösseren Einschränkungen der Arealnutzung zu erwarten. Die NIS-Belastung durch die Hochspannungsleitung ist im Rahmen des UVB 2. Stufe genauer zu bestimmen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «NIS» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 NIS 01 |
Neue NIS-relevante Anlagen für die Bau- und Betriebsphase Die neuen NIS-relevanten Anlagen des Projekts werden aufgezeigt und ggf. Standortdatenblätter für NIS-Anlagen erstellt. |
|
PH-HU2 NIS 02 |
Einhaltung Anlagegrenzwert bei neuen OMEN / Abschirmungsmassnahmen NIS-Quellen Die Einhaltung der Anlagegrenzwerte an neuen OMEN aufgrund neuer Anlagen im Projektperimeter resp. gegenüber bestehenden Anlagen Dritter (Hochspannungsleitung) wird überprüft und allfällige NIS-Schutzmassnahmen werden definiert. |
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
Gewässerschutzverordnung, 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, Kanton Zürich, 8. Dezember 1974, Stand 1. Januar 2018, LS 711.1 (EG GschG)
Verordnung über den Gewässerschutz, Kanton Zürich, 1. Juli 1975, Stand 1. Januar 2022, LS 711.11 (kantonale Gewässerschutzverordnung, KGschV)
Wegleitung Grundwasserschutz, Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL 2004)
Wegleitung zur Umsetzung des Grundwasserschutzes bei Untertagebauten, Vollzug Umwelt VU 2503 (BUWAL 1998)
Merkblatt «Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen», Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL (AWEL Kanton ZH 2019)
Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe, 3. überarbeitete Auflage 2018, Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018)
Hydrologischer Atlas der Schweiz, Tafel 8.7 «Vulnerabilität der Grundwasservorkommen» (HADES 2007)
Von Moos AG (1976): Die Grundwasserverhältnisse im unteren Glattal und Windlacherfeld (Dr. von Moos AG 1976)
Kempf. et al. (1986): Die Grundwasservorkommen im Kanton Zürich. Erläuterungen zur Grundwasserkarte 1:25'000. Kanton Zürich. Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geotechnische Serie (Kempf et al. 1986)
Eisenlohr, T. und Müller, P. (2016): Standortareal NL-6-SMA-HAA-Kombi, Geologisch-geotechnischer Bericht: Baugrundbeschreibung und geotechnische Beschreibung der oberflächennahen Abschnitte der Zugangsbauwerke (Rampe, Schächte). Nagra Arbeitsbericht NAB 16-65 (Eisenlohr & Müller 2016)
GIS des Kantons Zürich: Gewässerschutzkarte und Grundwasserkarte des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 GW 01 |
Aufarbeitung hydrogeologischer Grundlagen und Definition von weiteren Erkundungsmassnahmen Die systematische Erfassung von bestehenden und verfügbaren hydrogeologischen Grundlagendaten wird dokumentiert, um hydrogeologische Wissenslücken zu identifizieren. Die weiteren Untersuchungen zur Schliessung dieser hydrogeologischen Wissenslücken werden definiert. Die Erkundungsmassnahmen selbst werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt (diese werden erst nach 2024 fertig sein). |
|
PH-HU1 GW 02 |
Einfluss der Versiegelung auf die Bildung von Grundwasser Durch die OFA wird Fläche versiegelt. Die quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser werden abgeklärt und es werden allfällige Massnahmen definiert (Betriebsphase). |
|
PH-HU1 GW 03 |
Beurteilung Einfluss Trinkwasserfassungen Der Einfluss auf sowie der Schutz von Trinkwasserfassungen im Abstrombereich werden aufgezeigt. |
|
PH-HU1 GW 04 |
Beurteilung Thermal- und Tiefengrundwassersituation Abklärungen, inwiefern das Durchfahren der Unteren Süsswassermolasse Einfluss auf die Thermalquellen Lottstetten-Nack resp. die Mineralwasserquellen bei Eglisau hat, auch in Zusammenarbeit mit den Eigentümern der verschiedenen Quellen. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Grundwasser» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 GW 01 bis 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgende ergänzende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und der KOBU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 11 BAFU resp. 33 KOBU: Für das Bauprojekt werden die Fundationstiefen ermittelt und die entsprechenden Durchflussnachweise / Interessenabwägungen erstellt. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 12 BAFU resp. 33 KOBU: Im Bauprojekt und im UVB 2. Stufe wird eine Optimierung der Einbauten vorgenommen. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 13 BAFU resp. 30 KOBU: Im UVB 2. Stufe sind genauere Abschätzungen anhand hydrogeologischer Untersuchungen (z.B. Projekt HydOFA-NL) möglich. Das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.
-
Anträge 14 BAFU sowie 36 und 37 KOBU: Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend ergänzt.
-
Antrag 34 KOBU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3).
-
Antrag 38 KOBU: Die Auswirkungen des geologischen Tiefenlagers bzgl. der Temperatureinwirkung auf die tiefen Aquifere im Malm wurden modelliert. Die Methodik sowie die Resultate sind in Nagra (2024g) zu finden. Untersuchungen zu den Aquiferen der OMM resp. USM werden für den UVB 2. Stufe durchgeführt und dokumentiert (z.B. Projekt HydOFA-NL). Das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.
-
Anträge 14 und 15 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden berücksichtigt und entsprechend umgesetzt.
-
Antrag 16 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und auch im Espoo-Bericht entsprechend behandelt.
-
Antrag 17 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und ins Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe aufgenommen.
-
Antrag 18 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird im Bericht entsprechend ergänzt und auch in Anhang C des «Post-closure safety reports» (Nagra 2024e) dokumentiert.
Grundwassermächtigkeit
Die ausgedehnten Niederterrassenschotter-Vorkommen im Windlacherfeld (vgl. Kap. 3.4) sind grundwasserführend und bilden den oberflächennahen, ausgedehnten Lockergesteinsgrundwasserleiter von Windlach (vgl. Kap. 3.4). Dieser wird durch Hangsickerwasserzutritte sowie durch versickerndes Niederschlagswasser gespeist. Eine Infiltration aus dem Stadler «Dorfbach» (weiter nördlich heisst das Gewässer «Zweidlergraben», vgl. Fig. 3‑1) ist nicht nachgewiesen (Dr. von Moos AG 1976). Gemäss älteren Bohrungen sind im zentralen Bereich des Rütifelds Grundwassermächtigkeiten zwischen 15 m (Kantonaler Pegel G1) und 20 m vorhanden (z.B. Aufzeitbohrung AZ-A-34; Dr. Heinrich Jäckli AG 1984). Dies entspricht einer grossen Grundwassermächtigkeit und ist in der Grundwasserkarte des Kantons Zürich entsprechend vermerkt (vgl. Fig. 5‑4; Kempf et al. 1986).
Im Dorfbachtal wurden am 26.01.2023 in den vorhandenen Messstellen B1/20 (Zufahrt zum Bäumlerhof; vgl. Fig. 5‑4) resp. B2/20 (Zufahrt zum Weidhof) einzelne Abstichmessungen durchgeführt. Es wurden geringe Grundwassermächtigkeiten zwischen 0.1 und 0.5 m gemessen.
Im vorderen (östlichen) Teil des Haberstal ist gemäss Grundwasserkarte von einer geringen Grundwassermächtigkeit < 2 m auszugehen, welche als «Randbereich mit unterirdischer Entwässerung» bezeichnet wird (vgl. Fig. 5‑4). Zuhinterst (westlich) im Haberstal ist hingegen kein Grundwasser mehr verzeichnet. In einem Grossteil des Projektperimeters wurde die Grundwasserkarte aufgrund von geologischen Kartierungen und naturräumlichen Gegebenheiten erstellt, weshalb für diesen Bereich keine datengestützen Aussagen zu Grundwasservorkommen, -mächtigkeit oder -spiegel gemacht werden können.
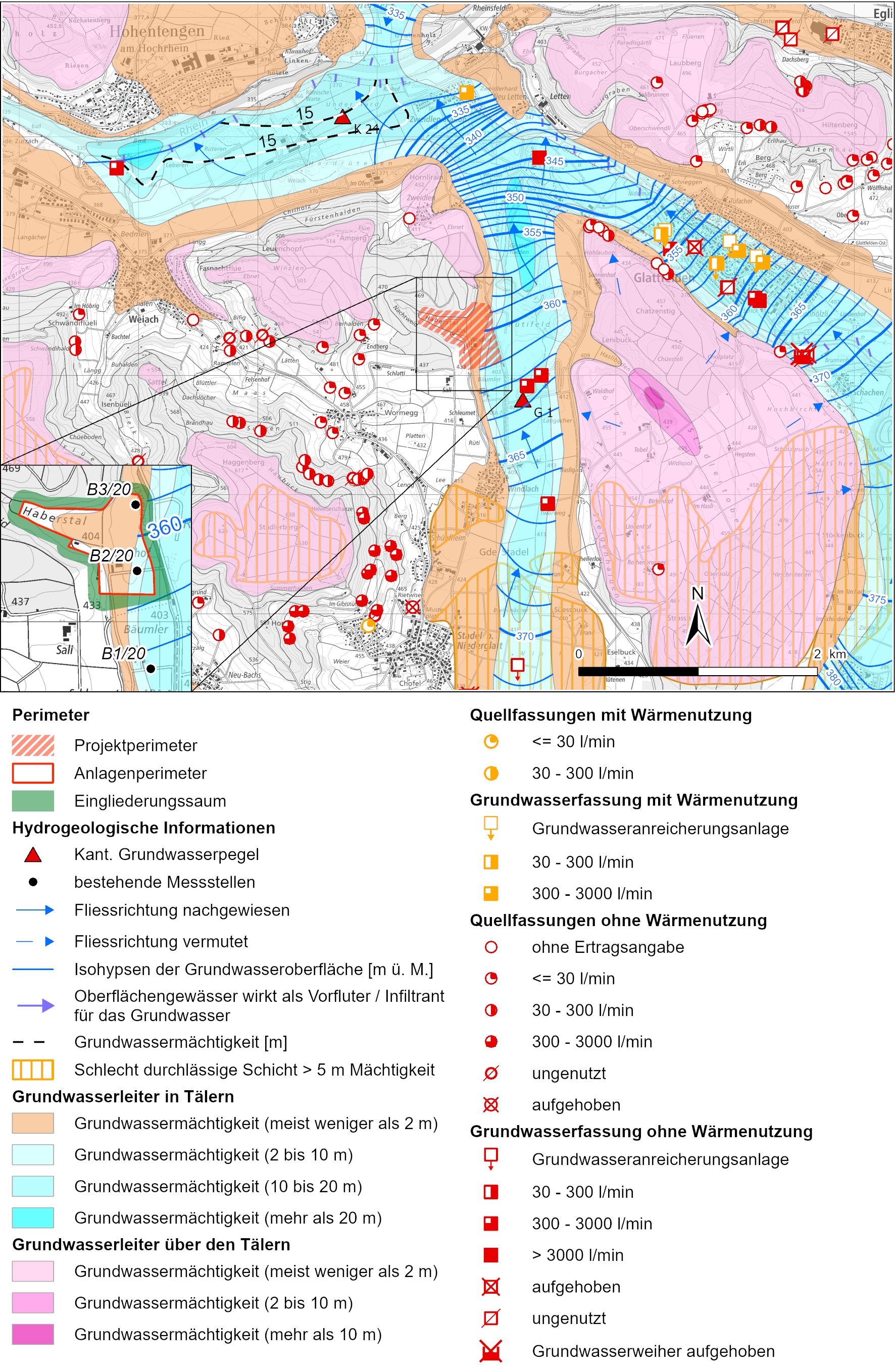
Fig. 5‑4:Grundwasserverhältnisse bei Mittelwasserstand gemäss Grundwasserkarte
(GIS-ZH 2024; ergänzt mit bestehenden Bohrungen nahe des Projektperimeters)
Grundwasserspiegellage
Gemäss der Grundwasserkarte befindet sich die Grundwasserspiegellage im Windlacherfeld auf Höhe der Kiesgrube Rütifeld bei Mittelwasserstand (MW) auf ca. Kote 363 m ü. M. (im Süden) resp. 358 m ü. M. (im Norden). Der Hochwasserstand (HW) gemäss Grundwasserkarte liegt zwischen ca. Kote 368 m ü. M. (im Süden) und 362 m ü. M. (im Norden). Somit liegt der HW gemäss Grundwasserkarte jeweils ca. 4 – 5 m höher als der MW. Der Flurabstand im Windlacherfeld beträgt somit gemäss der Grundwasserkarte bei MW durchschnittlich 40 m (vgl. Fig. 5‑4). Mittig im Grundwasserleiter befindet sich der kantonale Pegel G1 (Dr. von Moos AG 1976), in welchem seit 1983 die Grundwasserspiegelschwankungen aufgezeichnet werden. Am Stichtag 26.01.2023 lag der Grundwasserspiegel im Pegel G1 bei 360.9 m ü. M. (Tagesmittel). Gegenüber dem MW der Grundwasserkarte (363 m ü. M.; vgl. Fig. 5‑4) lag der Grundwasserspiegel im Pegel G1 somit rund 2 m tiefer.
Im Dorfbachtal wurden am selben Tag die beiden bestehenden Messstellen B1/20 und B2/20 (vgl. Fig. 5‑4) mit Datenloggern zur Überwachung des Grundwasserspiegels und der -temperatur ausgerüstet. Die dabei gemessenen Grundwasserspiegel lagen auf ca. Kote 371.3 m ü. M. resp. 369.6 m ü. M. und entsprechen somit einem Flurabstand von 32.9 m u.T. resp. 30.2 m u.T. Diese Abstichmessungen weisen darauf hin, dass die Grundwasserspiegel im Dorfbachtal in erster Näherung rund 10 m höher liegen als im Windlacherfeld. Im Rahmen der künftigen geologisch-hydrogeologischen Untersuchungen werden diese ersten Angaben vertieft untersucht (vgl. Pflichtenheft PH-HU2 GW 01).
Im Bereich des Haberstal sind bisher keine Grundwasseraufschlüsse und keine Grundwassermessungen vorhanden. Diese Angaben werden im Rahmen von weiterführenden hydrogeologischen Untersuchungen ermittelt (vgl. Pflichtenheft PH-HU2 GW 01). Grundsätzlich deuten die im Haberstal vorhandenen Drainagen (vgl. Fig. 5‑8) sowie die angetroffene Bodenbeschaffenheit (Gley; vgl. Kap. 5.9.4 und Fig. 5‑10) auf diffuse und temporäre oberflächennahe Hangsickerwasservorkommen hin. Die Wasserspiegelschwankungen im Hangsickerwasser sind erfahrungsgemäss gering (Eisenlohr & Müller 2016).
Grundwasserspiegelgefälle, Fliessrichtung und Durchlässigkeit
Das Grundwasserspiegelgefälle des Windlacherfelds beträgt auf Höhe des Projektperimeters ca. 4 – 7 ‰ und ist gegen NNW bis N gerichtet. In einer kurzen Steilstufe mit einem Grundwasserspiegelgefälle von 15 – 20 ‰ mündet das Grundwasservorkommen von Windlach ca. 1 km talwärts in den Glattgrundwasserstrom. Ursache dieser Steilstufe könnte eine örtlich etwas geringere Durchlässigkeit sein (Dr. von Moos AG 1976). Bei in den Jahren 1972/73 durchgeführten Pumpversuchen in einer Sondierbohrung rund 70 m SE des Projektperimeters sowie bei einer mittlerweile aufgehobenen Fassung rund 300 m NW des Projektperimeters wurden innerhalb des grundwasserführenden Schotters des Windlacherfelds Durchlässigkeitsbeiwerte K von ca. 2.0 × 10-4 bis 1.6 × 10-3 m/s ermittelt (Dr. von Moos AG 1976).
Das Grundwasserspiegelgefälle im Dorfbachtal kann aufgrund der geringen Anzahl Bohrungen mit Grundwassermessstellen nicht abgeschätzt werden. Es ist vermutlich flach (ca. 1 ‰) und gegen E bis NE gerichtet (Eisenlohr & Müller 2016).
Quellfassungen
An der Nordflanke des Haberstal (ca. Koordinate Auslauf: 2'677'509 / 1'267'496; Auslaufhöhe 417.94 m ü. M.) ist am Waldrand eine Quellfassung mit einem Laufbrunnen vorhanden (nachfolgend «Quellfassung Haberstal» genannt). Sie wurde im Zuge der Vervollständigung des Quellkatasters für die 3D-Seismikkampagne 2017 durch die Nagra aufgenommen (Nagra 2017) und ist weder auf der Grundwasserkarte noch im Wasserversorgungsatlas des Kantons Zürich erfasst. Die Quelle entspringt vermutlich aus der oberflächennah anstehenden OMM. Die Quellfassung lässt auf einen hoch liegenden Fels- resp. Kluftwasserspiegel schliessen (Eisenlohr & Müller 2016).
Zwischen November 2023 und März 2024 wurden die Quellschüttung und die Wassertemperatur der Quellfassung Haberstal periodisch gemessen (vgl. Fig. 5‑5). Die Quellschüttung schwankte verhältnismässig wenig zwischen 4.0 l/min und 7.0 l/min (Schüttungszahl QMin/QMax = 1.75). Im Mittel lag der Quellertrag während der Messperiode bei 5.4 l/min. Die verhältnismässig geringe Schüttungszahl weist darauf hin, dass die Quellfassung einen konstanten Quellertrag aufweist und entsprechend langsam auf Neubildungsprozesse resp. Niederschlags- und Trockenereignisse reagiert. Die Temperatur des Quellwassers schwankte in der Messperiode zwischen 10.0°C und 13.3°C und liegt damit im Normbereich für Quellwasser im Mittelland.
In einem Umkreis von rund 1 km um den Projektperimeter sind noch weitere Quellfassungen vorhanden. Im Bereich der Anhöhe «Stein» ca. 0.5 – 1.7 km westlich des Projektperimeters sind mehrere Quellaustritte vorhanden. Diese sind mehrheitlich gefasst und dienen privaten und öffentlichen Brauch- und Trinkwasserversorgungen. Im Gebiet «Bifig» weist eine Quelle eine rechtsgültige Schutzzone auf (GWR m 0-1286, Konzessionswassermenge 80 l/min).
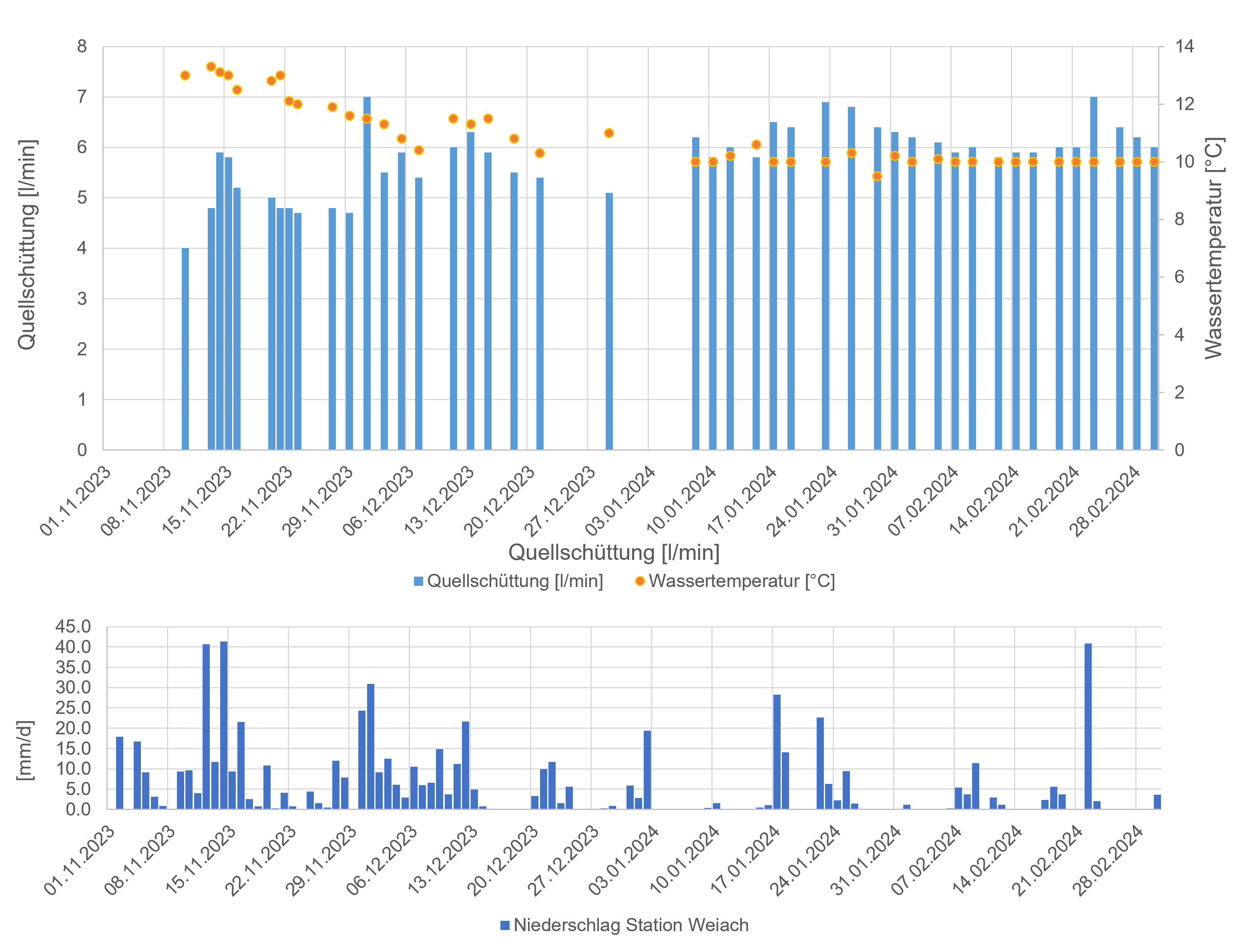
Fig. 5‑5: Quellschüttung und Wassertemperatur der Quellfassung Haberstal im Vergleich zum Niederschlag an der Station Weiach zwischen November 2023 und März 2024
Innerhalb des vorläufigen Schutzbereichs bildet der Obere Malm in einer Tiefe zwischen rund 400 m und 700 m u.T. den regionalen Tiefenaquifer (Felsaquifer) über den Wirtgesteinen Opalinuston (Nagra 2024e) mit durchschnittlichen Durchlässigkeiten auf Formationsskala von 10-9 m/s (Werte bis 10-7 m/s; Nagra 2024e).
Westlich von Eglisau, in rund 3.4 km nordöstlicher Distanz zum Projektperimeter (vgl. Fig. 5‑6), sind vier tiefe Grundwasserfassungen vorhanden, welche ursprünglich zur Mineralwassergewinnung gebohrt wurden, jedoch heute nicht mehr genutzt und grösstenteils stillgelegt wurden. Das Mineralwasser aller vier Bohrungen entstammt besser durchlässigen, sandreicheren Zonen der USM. Die wasserführenden Schichten befinden sich zwischen 52 – 76 m u.T. und 109 – 121 m u.T. (Eglisau II) resp. zwischen 70 – 141 m u.T. (Eglisau III).
Die Thermalquellen Lottstetten-Nack (D) werden durch den Malm-Aquifer gespeist (rund 590 m u.T.). Die Quellen werden heute nicht mehr genutzt. Lokal konnte mittels Vergleichen von Wasserproben verschiedener Tiefengrundwässer nördlich und südlich des Rheins gezeigt werden, dass sich die Grundwassertypen nördlich («offener Karst» des Sündrandens, dazu gehört Lottstetten-Nack) und südlich des Rheins (z.B. Benken und Schlattingen) massgeblich unterscheiden (Kap. 13.2, Waber & Traber 2022). Das Tiefengrundwasser von Lottstetten-Nack entspricht einem Na-HCO3-Typ und weist eine ungleich kürzere mittlere Verweilzeit von 7'000 – 12'000 Jahren auf als die älteren Na-Cl-Typ Tiefengrundwässer mit einer Verweilzeit von > 11'700 Jahren, die südlich des Rheins auftreten. Das Tiefengrundwasser von Lottstetten-Nack weist demzufolge auf ein jüngeres Fliesssystem hin, welches das ältere, generell von Süden nach Norden gerichtete System überprägt und zumindest bis zur Vorflut des heutigen Rheins zurückdrängt. Die Interpretation der hydraulischen Daten weist zudem darauf hin, dass keine Kommunikation der Thermalquelle Lottstetten-Nack mit den südlich des Rheins gelegenen, älteren Na-CL-Typ Grundwässern besteht (Gmünder et al. 2014). Die beiden Grundwasserregionen sind daher mit grosser Wahrscheinlichkeit vollständig hydraulisch entkoppelt. Die Thermalquellen Lottstetten-Nack (D) befinden sich ca. 11 km nördlich des Standorts. Eine Beeinflussung kann aufgrund der grossen Entfernung und des Fliesssystems ausgeschlossen werden.
Die relevanten Aquifere für die Fassungen der Thermalkurorte Baden und Bad Zurzach befinden sich im Kristallin resp. Muschelkalk, welche durch mächtige Aquitarde (Grundwasserstauer) von den Zugangsbauwerken hydraulisch entkoppelt sind und nicht durchfahren werden. Daher sind sie nicht projektrelevant und werden nicht weiter betrachtet.
Der Anlagenperimeter befindet sich gemäss Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (vgl. Fig. 5‑6) vollständig innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au, der Eingliederungssaum zu einem grossen Teil, wobei der Westteil des Haberstal im übrigen Bereich (üB) zu liegen kommt.
Rund 1.5 km nordöstlich am Rhein, und damit im Abstrombereich des Projektperimeters, liegt das rechtskräftige Grundwasserschutzareal «Weiacher Hard» (vgl. Fig. 5‑6). Das Grundwasserschutzareal mit geplanter Grundwasseranreicherung durch Rheinwasser soll gemäss Richtplan des Kantons Zürich für die zukünftige Trinkwassergewinnung verwendet werden, weshalb anhand der hydrogeologischen Untersuchungen bereits vorläufige Zonen S2 und S3 für eine künftige Grundwasserschutzzone ausgeschieden wurden (Dr. von Moos AG 1976, Kantonsrat Zürich 2024).
Im näheren Abstrombereich des Projektperimeters sind keine Grundwasserfassungen vorhanden. Die nächstgelegene Grundwasserfassung des Kieswerks Büel (Brauchwassernutzung, GWR l 2-19, Konzessionswassermenge 4'000 l/min; vgl. Fig. 5‑4) befindet sich ca. 1.5 km nordnordöstlich des Projektperimeters innerhalb des Glattgrundwasserleiters. Ausserdem ist ca. 2 km nördlich eine Grundwasserfassung mit Wärmenutzung des Kraftwerks Eglisau-Glattfelden vorhanden (GWR l 2-30, Konzessionswassermenge 500 l/min).
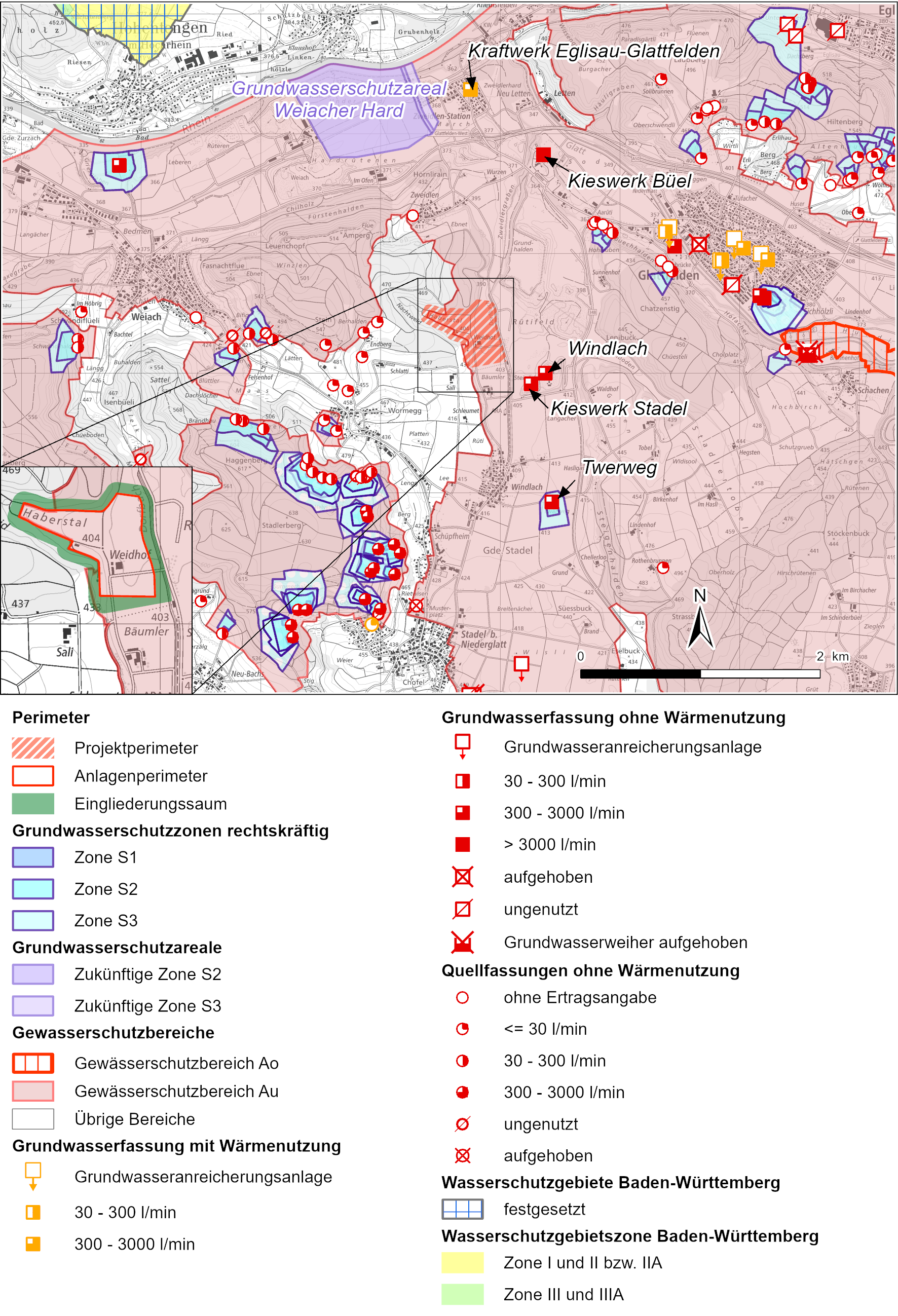
Fig. 5‑6:Auszug aus der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich im Bereich des Projektperimeters (GIS-ZH 2024)
Innerhalb des Grundwasservorkommens im Windlacherfeld, ca. 600 – 650 m süd-südöstlich des Projektperimeters (im Zustrom) sind die Brauchwasserfassungen Windlach (GWR m 3-3, Konzessionswassermenge 1'500 l/min) und Kieswerk Stadel (GWR m 3-4, Konzessionswassermenge 1'000 l/min), sowie 1.5 km süd-südöstlich die Trink- und Brauchwasserfassung «Twerweg» der Gemeinde Windlach (GWR m 3-1, Konzessionswassermenge 1'200 l/min, vgl. Fig. 5‑6) vorhanden. Für die Grundwasserfassung Twerweg wurde eine rechtskräftige Schutzzone ausgeschieden.
Auswirkungen auf den oberflächennahen Aquifer
Für den Bau und Betrieb des gTL sind innerhalb des Anlagenperimeters diverse Bauten und Anlagen mit Untergeschossen sowie mehrere Zugangsbauwerke notwendig (vgl. Kap. 4.1.3). Die Dimensionen der Bauten und Anlagen, die Fundationskoten sowie die Baumethoden und der Bauablauf werden für das Baugesuch unter Einhaltung der Vorgaben zum Gewässerschutz festgelegt. Das hydrologische Untersuchungskonzept wird vorgängig der kantonalen Behörde vorgestellt.
Betrachtungen bzgl. Einschränkungen des Grundwasserdurchflusses durch Bauten und Anlagen werden für den UVB 2. Stufe angestellt, bei Bedarf geeignete Ersatzmassnahmen ausgearbeitet sowie ggf. die notwendigen Ausnahmebewilligungen beantragt. Die Beurteilung allfälliger temporärer quantitativer Auswirkungen durch ggf. ins Grundwasser reichende temporäre Baugrubensicherungs- oder Wasserhaltungsmassnahmen sowie die Definition ggf. notwendigen Schutzmassnahmen erfolgt ebenfalls im Rahmen des UVB 2. Stufe. Sofern von einem relevanten Einfluss des Vorhabens auf Trinkwasserfassungen im Abstrombereich auszugehen ist, ist dieser im UVB 2. Stufe zu beurteilen sowie geeignete Schutzmassnahmen auszuarbeiten.
Für das Baugesuch werden die Vortriebsmethoden definiert. In Abhängigkeit von der Belastung des Ausbruchmaterials (geogen oder durch Zusatzstoffe im Vortrieb) wird die Verwertung resp. Deponierung des Ausbruchmaterials in einem Entsorgungs- und Materialbewirtschaftungskonzept definiert (vgl. Kap. 4.3 resp. Kap. 5.12.5.1). Für den UVB 2. Stufe wird die Einwirkung auf das Grundwasser bei einer Verwertung des Ausbruchmaterials im Projektperimeter untersucht und bewertet. Falls das Ausbruchmaterial in einer projektbezogenen Deponie abgelagert wird, werden die Einwirkungen auf das Grundwasser (qualitativ und quantitativ) beurteilt und ein Unbedenklichkeitsnachweis erbracht.
Weiter sind aufgrund der Flächenversiegelung im Anlagenperimeter (Grossteil der 13.1 ha, vgl. Kap. 4.1.1) quantitative Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung in diesem Bereich zu erwarten. Zudem werden im Eingliederungssaum neue Arealzufahrten (Brücken) für die Arealerschliessungen erstellt (vgl. Fig. 4‑7), was zu einer Flächenversiegelung in geringerem Umfang führt. Für das Baugesuch resp. für den UVB 2. Stufe sind die projektbedingten Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung zu quantifizieren, hydrogeologisch zu beurteilen sowie geeignete Massnahmen auszuarbeiten.
Die Umweltüberwachung während der Bau- und Betriebsphase des gTL schliesst die Überwachung des Grundwassers mit ein. Konzepte dafür finden sich in den Berichten «Überwachung von Umwelt und geologischem Umfeld» (Fanger et al. 2021) resp. «integralen Überwachungskonzept» (Nagra 2025b).
Auswirkungen auf die tieferen Aquifere
Während des Baus der Zugangsbauwerke werden Bauhilfsmassnahmen getroffen, um Wasserzutritte generell zu verhindern. Beim Bau wird die Sicherstellung einer dauerhaften Abdichtung und Trennung der Grundwasserstockwerke mit lokalen Gebirgsinjektionen und Dichtelementen gewährleistet. Sollten trotzdem geringe Mengen Grundwasser in die Zugangsbauwerke eindringen, wird das Wasser abgepumpt, vorgereinigt und fachgerecht abgeleitet (vgl. Kap. 5.8.5.1). Mit den vorgesehenen Massnahmen wird somit sichergestellt, dass das Grundwasser der tieferen Aquifere durch den Bau nicht relevant beeinflusst wird. Konkrete Bauhilfs- und Schutzmassnahmen für das Durchfahren der tiefen Aquifere werden für das Baugesuch ausgearbeitet und im UVB 2. Stufe bzgl. der hydrogeologischen Auswirkungen beurteilt.
Die USM (z.B. Mineralquellen Eglisau) sowie der Malm-Aquifer (z.B. Thermalquellen Lottsteten-Nack, D) werden in der Bauphase durch die Zugangsbauwerke zum gTL durchfahren. Die in den Bohrungen der Mineralquellen Eglisau angetroffene sandige Rinnenverfüllung, welche in Eglisau vermutlich als tiefer Aquifer dient, wurde in der Tiefbohrung Weiach weiter nordwestlich ebenfalls angetroffen, jedoch nicht in den Tiefbohrungen Stadel-2 und -3 im Umfeld der OFA (Nagra 2022b, Nagra 2022c). Aufgrund der ergriffenen Massnahmen sowie der gegebenen Umstände ist eine Beeinflussung der ungenutzten Mineralquellen Eglisau unwahrscheinlich. Auch für die Thermalquelle Lottstetten-Nack (D) kann aufgrund der grossen Distanz und der bestehenden Fliessverhältnisse eine Beeinflussung ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 5.6.4.2). Daher kann davon ausgegangen werden, dass es beim Bau der Zugangsbauwerke zu keiner Beeinträchtigung von überregional bedeutenden Thermalwasservorkommen kommt. Weitere Ausführungen dazu sind im sicherheitstechnischen Vergleich (Nagra 2024f) sowie in der Geosynthese der Nordschweiz (z.B. Fig. 4-107 und Fig. 4-116 im Kap. 4.5.5.2, Nagra 2024c) und in den hydrogeologischen Untersuchungen der Nordschweiz (Kap. 13.2, Waber & Traber 2022) zu finden.
Auswirkungen auf den oberflächennahen Aquifer
In der Betriebsphase werden die radioaktiven Abfälle stets durch mehrere Barrieren von der Umwelt isoliert, eingeschlossen und abgeschirmt. Da im gTL die Abfälle in Endlagerbehältern eingeschlossen und die an die OFA angelieferten Endlagerbehälter kontaminationsfrei sind, ist auch das gTL kontaminationsfrei, so dass keine Abgaben von radioaktiven Stoffen über den Luftoder Wasserpfad zu unterstellen sind (vgl. Kap. 3.1.2, Nagra 2025d).
Die Abfälle werden bei der Anlieferung in die Bereitstellungshalle transportiert. Die Annahme-, Bereitstellungs- und Verbringungsarbeiten der radioaktiven Abfälle nach untertag werden entweder auf den undurchlässig gestalteten, entsprechend entwässerten Einlagerungs- und Betriebsflächen oder innerhalb von gesicherten Bauten und Anlagen stattfinden.
Falls für den Betrieb eine Tankanlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Diesel, Kältemittel) betrieben werden muss (z.B. für eine Notstrom- oder Kälteanlage), sind für den UVB 2. Stufe im Gewässerschutzbereich Au die entsprechenden Schutzmassnahmen vorzusehen.
Auswirkungen auf die tieferen Aquifere
Betriebsphase
Für den Betrieb werden die Zugangsbauwerke druckwasserhaltend abgedichtet.
Nachbetriebsphase
Temperatur
Im gTL werden die radioaktiven Abfälle in ca. 800 – 930 m Tiefe im einschlusswirksamen Gebirgsbereich eingelagert. Aufgrund der Wärmeentwicklung wird bei der aktuellen Lagerauslegung davon ausgegangen, dass in den umgebenden Gebirgsbereichen (insbesondere im Malm-Aquifer) vorhandene Tiefenaquifere nach dem Verschluss des Lagers im Nahbereich lokal erwärmt werden.
Die Nagra hat Berechnungen für die exemplarische Lagerauslegung im RBG durchgeführt. Diese zeigen, dass die maximale temporäre Erwärmung infolge des Tiefenlagers im Malm-Aquifer im Bereich von 4 – 9°C liegt (Nagra 2024g).
Bei der Beurteilung der Erwärmung des Grundwassers infolge des gTLs sind die folgenden Besonderheiten zu berücksichtigen:
-
Als Entsorgungsmethode schreibt Art. 31 Abs. 1 KEG die geologische Tiefenlagerung vor. Die Einlagerung von HAA (radioaktiver Zerfall) führt daher zwangsläufig zu einer Erwärmung der Umgebung. Diese tritt gemäss Modellierungen mehrere tausend Jahre nach dem ordnungsgemässen Verschluss des gTL auf (Nagra 2024g).
-
Die Erwärmung erfolgt lokal begrenzt im Bereich des HAA-Lagers, weshalb sich der Temperatureinfluss auf die tieferen Aquifere beschränkt. Diese sind im Vergleich zu den oberflächennahen Aquiferen viel weniger ergiebig, weisen i.d.R. sehr geringe Fliessgeschwindigkeiten und häufig einen hohen Salzgehalt auf. Sie werden deshalb für die Gewinnung von Trink- und Brauchwasser nicht in Betracht gezogen.
Die derzeitige exemplarische Lagerauslegung resultiert aus einer ganzheitlichen Abwägung von sicherheitstechnischen, baulichen und betrieblichen Anforderungen an das Sicherheits- und Lagerkonzept (Nagra 2024a, Nagra 2024e) und strebt einen haushälterischen Umgang mit dem Untergrund an. Um eine Überschreitung der 3°C-Regel gemäss Anhang 4 Ziff. 21 Abs. 3 GSchV zu verhindern, müsste die Lagerauslegung angepasst werden. Dies hätte folgende Konsequenzen:
-
Das Lagerfeld würde bedeutend grösser und würde somit einen grösseren definitiven Schutzbereich beanspruchen (inkl. Nutzungsbeschränkungen). Dies würde zu einer einseitigen (raumplanerischen) Priorisierung des (Tiefen-) Grundwassers gegenüber anderweitigen Nutzungen und Interessen im Untergrund führen.
-
Ein grösseres untertägiges Bauwerk verursacht höhere Materialflüsse und grössere Emissionen (z.B. mehr Ausbruchmaterial, mehr Transporte, längere Bauzeit, grösseres Deponievolumen und grössere Mengen Verfüllmaterial etc.) und führt zu einer Verschlechterung der Umweltbilanz des Vorhabens. Ein vergrössertes Bauprojekt wäre auch mit höheren Kosten verbunden.
Gewässergefährdende Stoffe
Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung sind grundsätzlich über die Strahlenschutz- und die Kernenergiegesetzgebung geregelt und unterstehen der Aufsicht des ENSI. Das Abfallinventar enthält neben radioaktiven Nukliden auch nicht radioaktive aber chemotoxisch relevante Stoffe. Die Beurteilung von Auswirkungen der chemotoxischen Stoffe auf die Biosphäre (inkl. die tieferen Aquifere) erfolgt entsprechend der Umweltgesetzgebung und fällt somit in die Zuständigkeit des BAFU.
Die Endlagerbehälter mit den radioaktiven Abfällen werden in Lagerstollen im Opalinuston eingelagert, die rund 800 – 930 m unterhalb der Oberfläche zu liegen kommen. Die Rückhaltung wird mit Hilfe eines Mehrfachbarrierensystems sichergestellt (Anhang C, Nagra 2024e). Die rund 100 m mächtige Gesteinsschicht des Opalinustons (Wirtsgestein) wirkt als natürliche Barriere. Das Wirtsgestein ist zusätzlich von > 50 m mächtigen, tonreiche Rahmengesteinen umgeben, welche die nächstgelegen Aquifere im Malmkalk resp. im Keuper abgrenzen.
Die im Rahmen des Sachplanverfahren durchgeführten erdwissenschaftlichen Untersuchungen haben bestätigt, dass die tonreichen Gesteine der Wirt- und Rahmengesteine sehr kleine Porenöffnungen im Nanometerbereich, grosse Mineraloberflächen (30 m2/g für Opalinuston), einen Überschuss an negativen Oberflächenladungen (Illit-Smektit-Mineralien), eine geringe hydraulische Permeabilität (K = 5 × 10⁻¹³ m/s) und sehr gute Selbstabdichtungseigenschaften aufweisen (Nagra 2024c). Diese natürlichen Barrieren haben daher hervorragende Rückhalteeigenschaften für radioaktive sowie andere chemotoxische Stoffe aus dem gTL (Miron et al. 2024).
Ein Grossteil der im gTL eingebrachten Abfälle weisen aufgrund ihrer Materialzusammensetzung oder ihrer Konditionierung allgemein eine geringe Löslichkeit auf (Hummel et al. 2022, Hummel et al. 2023, Tits & Wieland 2023). Damit sind bereits die Stoffkonzentrationen beschränkt, welche diffusiv in und durch das Mehrfachbarrierensystem transportiert werden können. Für das RBG wurde eine standortspezifische, vertiefte Sicherheitsanalyse durchgeführt und die zuverlässige Rückhaltung radioaktiver Stoffe durch ein Mehrfachbarrierensystem nachgewiesen. Berechnungen der Sicherheitsanalyse (Kap. 6 resp. Fig. 6-1 und 6-9, Nagra 2024e) illustrieren, dass die meisten Radionuklide und somit analog auch potenziell wassergefährdende Stoffe (z.B. Elemente wie Pb, Cd oder Cu) für mindestens 1 Mio Jahre innerhalb der ersten 10 – 20 m im Opalinuston zurückgehalten werden (vgl. auch Anhang C, Nagra 2024e).
Diese Resultate bestätigen die im Rahmen einer früheren Risikobetrachtung für Etappe 2 im Jahr 2014 durchgeführten Analysen des Einflusses von chemotoxischen Stoffen des Abfallinventars auf das Grundwasser hinsichtlich der Freisetzung von gewässergefährdenden Stoffen (Häner et al. 2014). Die damaligen Berechnungen mit vereinfachten, sehr konservativen Freisetzungsszenarien zeigten, dass sämtliche toxikologischen Grenzwerte, welche üblicherweise für den Nachweis der Trinkwasserqualität gelten, im Grundwasser eingehalten werden können (Kap. 7 und 9, Häner et al. 2014). Somit konnte schon damals ausgeschlossen werden, dass durch das eingebrachte Abfallinventar im gTL eine chemotoxische Gefährdung bzw. Beeinträchtigung der Wasserqualität der tiefen Aquifere entsteht (Kap. 9, Häner et al. 2014).
Das gTL ist so konzipiert, dass zuverlässig radioaktive und nicht radioaktive Stoffe zurückgehalten werden, sodass der Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist. Chemotoxische Stoffe in einem gTL stellen aufgrund dieser Erkenntnisse keine Gefährdung der Biosphäre oder der tieferen Aquifere dar.
Für den UVB 2. Stufe werden hydrgeologische Untersuchungen ausgeführt, um die Situation im Projektperimeter vertieft zu erkunden. Somit können auf das Bauprojekt zugeschnittene Grundwasserschutzmassnahmen definiert sowie die ggf. notwendigen Ausnahmebewilligungen beantragt werden.
Weiter soll der Erhalt der Grundwasserneubildung innerhalb des Anlagenperimeters sichergestellt werden. Für den UVB 2. Stufe werden dazu geeignete Massnahmen definiert.
Bezüglich der Erwärmung der tieferen Aquifere infolge des gTL ist mit der modellhaften Lagerauslegung eine Erwärmung von rund 4°C (Top Malm-Aquifer) resp. rund 9°C (Basis Malm-Aquifer) mehrere tausend Jahre nach dem ordnungsgemässen Verschluss des gTL zu erwarten. Die effektive Lagerauslegung wird im Rahmen des Baugesuchs festgelegt, wofür die modellhaften Temperaturmodellierungen überprüft und ggf. angepasst und im UVB 2. Stufe dokumentiert werden. Aufgrund der günstigen Eigenschaften des gTL kann ausgeschlossen werden, dass chemotoxisch relevante Stoffe in die tiefen Aquifere und in die Biosphäre gelangen.
Für allfällige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen werden für die Betriebsphase Grundwasserschutzmassnahmen geprüft und für den UVB 2. Stufe in entsprechenden Dispositiven festgehalten.
Vorbehältlich der notwendigen Nachweise und Ausnahmebewilligungen sowie unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise und unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Grundwasser» eingehalten werden.
|
PH-HU2 GW 01 |
Hydrogeologische Untersuchungen Es werden hydrogeologische Untersuchungen im Projektperimeter definiert, die entsprechenden Erkundungen ausgeführt und dokumentiert. Die hydrogeologischen Untersuchungen umfassen auch allfällige Felsgrundwasservorkommen in der Molasse (OMM und USM). Die Untersuchungskonzepte werden vorgängig der kantonalen Fachstelle erörtert. |
|
PH-HU2 GW 02 |
Durchflussnachweis Für allfällige Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel wird der Nachweis erbracht, dass die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem Ausgangszustand um höchstens 10 % vermindert wird. Bei Bedarf sind Kompensationsmassnahmen vorzusehen. Die Interessen für einen Einbau ins Grundwasser werden aufgezeigt. |
|
PH-HU2 Grw 03 |
Temporäre Grundwasserabsenkung während der Bauphase Allfällig temporäre Grundwasserabsenkungen und Wasserhaltungsmassnahmen während der Bauphase werden abgeklärt und ggf. Ausnahmebewilligungen dafür beantragt. |
|
PH-HU2 GW 04 |
Beurteilung Einfluss Trinkwasserfassungen Der Einfluss des Bauvorhabens auf sowie der Schutz von Trinkwasserfassungen im Abstrombereich werden aufgezeigt und beurteilt. |
|
PH-HU2 GW 05 |
Einfluss der Versiegelung auf die Grundwasserneubildung (Bauphase) Im Bereich des Anlagenperimeters und der Arealzufahrten wird Fläche versiegelt. Die quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser werden abgeklärt und geeignete Massnahmen definiert. |
|
PH-HU2 GW 06 |
Grundwasserschutz bzgl. Abdichtung unterirdischer Anlageteile Bei der Weiterentwicklung des Vorhabens im Bereich der unterirdischen Anlagenteile werden die Hinweise zum Grundwasserschutz in der Stellungnahme des BAFU vom 18. Mai 2017 bzgl. Abdichtung der unterirdischen Anlagenteile gegenüber Fels-Grundwasservorkommen berücksichtigt. |
|
PH-HU2 GW 07 |
Einfluss des Ausbruchmaterials auf das Grundwasser (Bauphase) Die geogene Belastung des Ausbruchmaterials und dessen Einwirkung auf das Grundwasser bei einer Verwertung im Projektperimeter oder einer allfälligen Ablagerung in einer projektbezogenen Deponie werden untersucht. Für allfällige projektspezifsche Deponien ist nachzuweisen, dass aufgrund der Eigenschaften des Ausbruchmaterials keine negativen Einwirkungen auf das Grundwasser (qualitativ und quantitativ) zu erwarten sind. |
|
PH-HU2 GW 08 |
Beurteilung der Erwärmung der Felsaquifere (Betriebsphase) Für die effektive Lagerauslegung wird der Einfluss des gTL bzgl. der Erwärmung der tieferen Aquifere mittels Modellrechnungen überprüft. |
|
PH-HU2 Grw 09 |
Grundwasserschutz vor wassergefährdenden Stoffen (Betriebsphase) Für allfällige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen werden Grundwasserschutzmassnahmen geprüft. |
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (GSchG)
Gewässerschutzverordnung, 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)
Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991, Stand 1. Januar 2022, SR 721.100 (WAG)
Verordnung über den Wasserbau vom 2. November 1994, Stand 1. Januar 2016, SR 721.100.1 (Wasserbauverordnung, WBV)
Bundesgesetz über die Fischerei vom 21. Juni 1991, Stand 1 Juli 2023, SR 923.0 (BGF)
Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei vom 24. November 1993, Stand 1. Januar 2021, SR 923.01 (VBGF)
Leitbild Fliessgewässer Schweiz – Für eine nachhaltige Gewässerpolitik (BUWAL 2003c)
GIS des Kantons Zürich: Gewässer-Ökomorphologie, Öffentliche Oberflächengewässer, Gewässerraum und Wasserrechte (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 OfG 01 |
Eingriffe Dorfbach Die definitiven Eingriffe entlang des und im Gewässerraum des Dorfbachs (Abbruch / Neubau von Brücken) werden im Detail aufgezeigt und die Auswirkungen auf das Gewässer beurteilt sowie nötige Massnahmen definiert. |
|
PH-HU1 OfG 02 |
Haberstalgraben Die definitiven Eingriffe in den Haberstalgraben werden im Detail aufgezeigt und die Auswirkungen auf das Gewässer beurteilt sowie allfällige Massnahmen (inkl. Revitalisierungsplanung) definiert. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Oberflächengewässer» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 OfG 01 und 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgende ergänzende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und der KOBU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 1 BAFU: Die Raumreservierung für allfällige Ersatzmassnahmen aufgrund von Arbeiten an Oberflächengewässern wird im UVB 1. Stufe mit dem Ausscheiden eines Eingliederungssaums vorgenommen. Allfällige Renaturierungsmassnahmen werden für das Bauprojekt resp. im UVB 2. Stufe definiert.
-
Antrag 9 BAFU (resp. 43 KOBU): Der Antrag wird abgelehnt. Eine komplette Ausdolung des Haberstalgrabens steht im Widerspruch mit sicherheits- und sicherungstechnischen Anforderungen an eine Kernanlage (vgl. Sicherheitsbericht Kap. 3.3.4, Nagra 2025c).
-
Antrag 44 KOBU: Die Festlegung der Zufahrten (Anzahl, Ort und Ausgestaltung) wird im Baugesuch (UVB 2. Stufe) erfolgen. Im UVB 1. Stufe wird lediglich dargelegt, dass aus Sicherheits- und Redundanzgründen (Nagra 2025c) mehrere Zufahrten notwendig sind. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 45 KOBU: Im UVB 1. Stufe wird mittels Eingliederungssaum die Raumreservation festgelegt. Eine ausführliche Prüfung der Gewässerabstände wird im UVB 2. Stufe durchgeführt, sobald die Standorte der einzelnen Bauten und Anlagen festgelegt wurden.
-
Anträge 9 und 10 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden berücksichtigt und das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe entsprechend ergänzt.
-
Anträge 11 und 12 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden berücksichtigt und ins Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe aufgenommen.
- Antrag 13 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Hinweis wird berücksichtigt.
Das grösste Oberflächengewässer in der Nachbarschaft des Projektperimeters ist der Dorfbach, welcher von Windlach Richtung Norden fliesst und via Glatt in den Rhein entwässert. Dieses Gewässer ist namensgebend für das Dorfbachtal (weiter nördlich auch «Zweidlergraben» genannt; vgl. Fig. 5‑7). Der Dorfbach gilt innerhalb des Projektperimeters als «ökomorphologisch stark beeinträchtigt» (vgl. Fig. 5‑7), nördlich davon, ab der Unterquerung der Zweidlenstrasse, ist der Zweidlergraben sogar als «künstlich / naturfremd» klassifiziert. Gemäss der Revitalisierungsplanung des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024) wird eine Revitalisierung des Dorfbachs im Bereich des Projektperimeters aufgrund der stark beeinträchtigten Ökomorphologie einen «grossen Nutzen» zugeschrieben, wobei das Aufwertungspotential und das ökologische Potential als «mittel» angegeben werden. Im Projektperimeter wird das Gefälle des Bachgerinnes heute mit 6 Abstürzen < 70 cm reguliert. Die Bachsohle des Dorfbachs ist mit Steinschüttungen resp. Blockwürfen befestigt und am Böschungsfuss bilden Natursteine über weite Strecken ein relativ enges, quadratisches Gerinne, welches sich gegen oben in ein trapezförmiges Gerinne öffnet. Die Uferböschungen sind überwiegend mit Gras bewachsen und im südlichen Teil mit lockerer Ufervegetation (Büsche, wenige Einzelbäume) bestockt. Zwischen dem Bäumlerhof und dem Weidhof (im Bereich des südlichen Projektperimeters) fehlt die Uferbestockung vollständig. Nördlich davon sind die Ufer wieder mit dichtem Gebüsch und einzelnen Bäumen bestockt (vgl. Kap. 5.16.4).
Der Projektperimeter wird von Westen nach Osten durch den Haberstalgraben (Gemeinde-Gewässer Nr. 1.1) durchflossen. Der Haberstalgraben ist im kantonalen GIS (Öffentliche Fliessgewässer, GIS-ZH 2024) als kleiner, eingedolter Bach ausgewiesen. Westlich des Anlagenperimeters fliesst der Bach als kleines Gerinne mit ca. 50 cm breiter Bachsohle offen durch den Wald. Auf diesem Abschnitt ist er ökomorphologisch als «natürlich / naturnah» klassiert (vgl. Fig. 5‑7). Gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung (GIS-ZH 2024) wird eine allfällige Revitalisierung des Haberstalgrabens mit einem «geringen Nutzen» beurteilt. Entsprechend wird das Aufwertungspotential als «gering» und das ökologische Potential als «mittel» angegeben. Das Gerinne des kleinen Gewässers hat sich vermutlich auf natürliche Weise gebildet, mäandriert leicht und entwässert den vernässten, bewaldeten Taleinschnitt des Haberstals. Im hintersten Teil des Gerinnes ist ein künstliches Bauwerk vorhanden, welches einen kleinen Absturz bildet. Ansonsten ist der Gewässerabschnitt bis zur Dolung frei von baulichen Massnahmen. Bei der Querung des Waldwegs («Haberstalstrasse»), rund 60 m östlich des Anlagenperimeters, wird er mit einem Betonrohr (ca. ø 50 cm) gefasst und verläuft bis zur Mündung in den Dorfbach ca. 45 m östlich des Anlagenperimeters eingedolt unter den Landwirtschaftsflächen des Haberstal und des Dorfbachtals. Sowohl der Haberstal als auch das Dorfbachtal sind mit einem Netz an Drainageleitungen und Kontrollschächten durchzogen (vgl. Fig. 5‑8). Der Haberstalgraben leitet gemäss «Meliorationskataster» des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024) das flächig gesammelte Drainagewasser aus einem Grossteil des Anlagenperimeters ab. Zusätzlich entwässert der Haberstalgraben auch den Überlauf der Quellfassung Haberstal (vgl. Kap. 5.6.4 resp. Fig. 5‑8).
Für beide Fliessgewässer wurden planerisch noch keine Gewässerräume gemäss Art. 41a Abs. 2 Bst. a GSchV festgelegt. Es gelten daher die Übergangsbestimmungen gemäss Abs. 2, Bst. a GSchV zur Änderung vom 4. Mai 2011. Der Dorfbach weist mit einer Gewässersohlenbreite von 1.2 m nach Übergangsbestimmungen einen beidseitigen Uferstreifen von 9.2 m (1.2 m + 8 m) auf und damit einen übergangsrechtlichen Gewässerraum von 19.6 m (1.2 m + 2 x 9.2 m). Der Haberstalgraben weist mit einer Gewässersohlenbreite von 0.5 m einen beidseitigen Uferstreifen von 8.5 m resp. einen übergangsrechtlichen Gewässerraum von 17.5 m auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gewässerräume nach der planerischen Umsetzung durch den Kanton deutlich kleiner festgelegt werden.
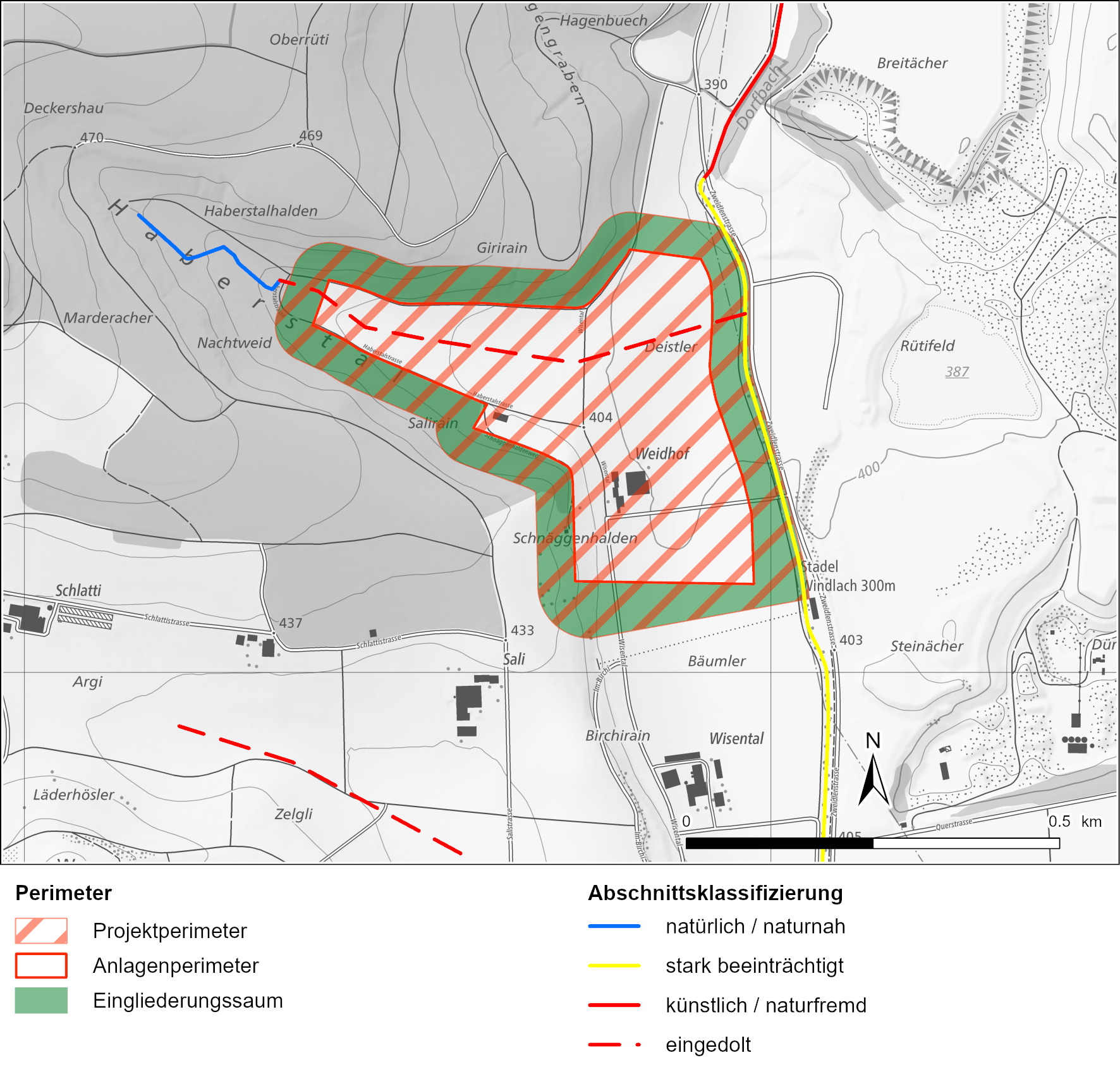
Fig. 5‑7:Ausschnitt Karte Ökomorphologie der Fliessgewässer (GIS-ZH 2024)
Haberstalgraben
Der Projektperimeter überlagert den Haberstalgraben (vgl. Fig. 5‑7). Aus der Topografie, Breite und Lage des Taleinschnitts Haberstal ergeben sich Anforderungen, für den Fall, dass dort zukünftig ein Zugang nach untertag und weitere Bauten und Anlagen errichtet werden soll, wie es in der exemplarischen Umsetzung vorgesehen ist. Die geringe Breite des Haberstals schränkt die Möglichkeiten zur Bebauung und Nutzung ein. Zur Sicherstellung der Hochwassersicherheit des Zugangs nach Untertag sowie der Bauten und Anlagen, muss gewährleistet sein, dass der Haberstalgraben überflutungssicher ausgestaltet werden kann (vgl. Anhang D in Nagra 2024a). Damit sind Eingriffe in den Verlauf des Gewässers unausweichlich.
Der Haberstalgraben fliesst heute als kleines offenes Gerinne im Wald und wird eingedolt über den zukünftigen Anlagenperimeter dem Dorfbach zugeführt. Aus verfahrenstechnischer Sicht ist es notwendig, dem RBG einen abdeckenden Fall zu Grunde zu legen. Für die Sicherheit des Anlagenperimeters wird der Haberstalgraben in der exemplarischen Umsetzung ausserhalb des Sicherungsperimeters gefasst (vgl. Anhang D in Nagra 2024a) in einem dafür dimensionierten Rohr kontrolliert nördlich um den Anlagenperimeter (bspw. entlang des Waldwegs) zum «Dorfbach» geleitet.
Bei Eingriffen in eingedolte Gewässer ist gemäss Art. 37 GSchG eine Verbesserung des Gewässerzustands im Sinne des Gesetzes, d.h. eine ökologische Aufwertung des Gewässers, vorzusehen.
Mit der weiteren Projektentwicklung ist zu prüfen, ob bzw. inwieweit eine Offenlegung/ Teiloffenlegung im nördlichen Eingliederungssaum mit den Sicherheitsbestimmungen vereinbar ist. Ein Variantenstudium zur Ausgestaltung im Rahmen der Erarbeitung des Baugesuchs (UVB 2. Stufe) muss die genaue Ausgestaltung klären. Eine Interessensabwägung hat im BAR 2. Stufe zu erfolgen.
Für das Baugesuch ist ein Variantenstudium durchzuführen, welches auch Varianten ohne Wiedereindolung umfasst. Ist keine solche Variante realisierbar, ist eine Begründung beizubringen und eine Zusicherung erforderlich, dass eine spätere Ausdolung erfolgt. Der Zeitpunkt der Ausdolung mit klarer Darlegung der Ausgestaltung ist darzulegen.
Falls eine vollständige Offenlegung nicht möglich ist, ist für den Ersatz der bestehenden Eindolung des Haberstalgrabens eine Ausnahmebewilligung nach Art. 41c Abs. 1 GSchV zu beantragen (vgl. Kap. 2.3).
Dorfbach
Für die Anbindung an die bestehenden Arealerschliessungen (Zweidlenstrasse, vgl. Fig. 4‑7) müssen mehrere Arealzufahrten über den Dorfbach gelegt werden. Die genaue Anzahl und Lage der Arealzufahrten wird für das Baugesuch aufgrund der Sicherheitsanforderungen festgelegt. Für die Ausgestaltung wird ein Variantenstudium durchgeführt. Durch den Bau der Arealzufahrten werden der Gewässerraum des Dorfbachs und dessen Ufervegetation langfristig beansprucht. Dafür bedarf es im Baubewilligungsverfahren einer Ausnahmebewilligung (vgl. Kap. 2.3). Für die betroffene Ufervegetation (vgl. Fig. 5‑17) besteht eine Ersatzpflicht nach NHG (vgl. Kap. 5.16.5.1).
Ob für den Dorfbach ein definitiver, eigentümerverbindlicher Gewässerraum festgelegt wird, ist im weiteren Verfahren durch den Kanton Zürich zu bestimmen und entsprechend umzusetzen. Der Gewässerraum (nach Übergangsbestimmungen GSchV liegt grösstenteils innerhalb des rund 50 m breiten Streifens des östlichen Eingliederungssaums, wobei die bestehende Zweidlenstrasse im orographisch rechtsseitigen Uferstreifen des Dorfbachs liegt. Der Eingliederungssaum kann in diesem Bereich für allfällige Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen sowie für die Umsetzung von Hochwasserschutz- und Renaturierungsmassnahmen genutzt werden. Der Eingliederungssaum bleibt plangemäss, abgesehen von den notwendigen Arealzufahrten, frei von permanenten Bauten und Anlagen. Falls temporäre Baustelleninstallationen (Baupisten und -plätze, Materialzwischenlager) oder projektbedingt wider Erwarten permanente Bauten oder Anlagen innerhalb des Gewässerraums erstellt werden müssen, werden für das Baugesuch entsprechende Ausnahmebewilligungen beantragt und ein Nachweis über die unmittelbare Standortgebundenheit erbracht.
Beide Gewässer
Konkrete Umlegungs- resp. Renaturierungsprojekte für die beiden Oberflächengewässer sind im Rahmen des Baugesuchs vorgesehen, weshalb Variantenstudien zur Ausgestaltung und eine Beurteilung der Gewässersituation im Rahmen von UVB 2. Stufe vorgenommen werden. Dabei werden auch die definitiven Eingriffe in die Gewässer bezeichnet, allfällige Kompensationen aufgezeigt und die Auswirkungen beurteilt.
Für die Gewässer Dorfbach und Haberstalgraben sind die Gewässerräume nach Übergangsbestimmungen zu bezeichnen und im Baugesuch in den relevanten Plänen zu dokumentieren.
Für allfällige Baustelleninstallationen und/oder Bauten und Anlagen innerhalb der Gewässerräume wird eine Ausnahmebewilligung beantragt sowie ein Nachweis über die Standortgebundenheit erbracht.
Während der Betriebsphase sind keine zusätzlichen Auswirkungen auf Oberflächengewässer und aquatische Ökosysteme zu erwarten.
Vom Vorhaben sind der durch den Anlagenperimeter verlaufende, eingedolte Haberstalgraben und dessen Gewässerraum betroffen. Im Rahmen des UVB 2. Stufe werden die Eingriffe in den Haberstalgraben (unumgängliche Umlegung / ggf. Eindolung) mittels Variantenstudium zur Ausgestaltung mit einer Interessenabwägung beurteilt. Nach Möglichkeit werden offen geführte Gewässerabschnitte ökologisch aufgewertet. Für die Ausgestaltung der Arealzufahrten über den Dorfbach und die Ausgestaltung des Gewässers wird im Rahmen des Baugesuchs ein Variantenstudium ausgearbeitet.
Für die Ufervegetation, welche durch die Arealzufahrten über den Dorfbach (und dessen Gewässerraum) tangiert ist, wird mittels einer Kompensation einen Ersatz nach NHG geschaffen.
In der Betriebsphase finden keine weiteren Eingriffe in Oberflächengewässer statt.
Vorbehältlich der notwendigen Nachweise und Ausnahmebewilligungen sowie unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise und unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Oberflächengewässer inkl. aquatische Ökosysteme» eingehalten werden.
|
PH-HU2 OfG 01 |
Eingriffe und Massnahmen Dorfbach Für die Eingriffe in den Dorfbach und dessen Gewässerraum durch den Bau der Arealzufahrten (Brücken) werden mittels Variantenstudium Möglichkeiten zur Ausgestaltung aufgezeigt, die Auswirkungen auf das Gewässer beurteilt sowie nötige Massnahmen für Ersatz- (Ufergehölze) resp. Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen definiert. Zudem wird bei Bedarf ein Renaturierungsprojekt ausgearbeitet und beurteilt. Für jede Brücke/Arealzufahrt mit Eingriffen in den Gewässerraum ist der Bedarf nachzuweisen. |
|
PH-HU2 OfG 02 |
Eingriffe und Massnahmen Haberstalgraben Die Eingriffe (Gewässerumlegung/Wiedereindolung), Auswirkungen und Massnahmen (allfällige Kompensationen z.B. durch Aufwertungen am Dorfbach) werden mittels Variantenstudium aufgezeigt und beurteilt. Nach Möglichkeit wird ein Renaturierungsprojekt für offen geführte Bachabschnitte ausgearbeitet und beurteilt. |
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (GSchG)
Gewässerschutzverordnung, 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, Kanton Zürich, 8. Dezember 1974, Stand 1. Januar 2018, LS 711.1 (EG GschG)
Verordnung über den Gewässerschutz, Kanton Zürich, 22. Januar 1975, Stand 1. Januar 2022, LS 711.11 (kantonale Gewässerschutzverordnung, KGschV)
Wegleitung Grundwasserschutz, Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL)
Regenwasserbewirtschaftung Richtlinie und Praxishilfe zum Umgang mit Regenwasser, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL; Baudirektion Kanton ZH 2022b)
Merkblatt «Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen», Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL Kanton ZH 2019)
Entwässerung von Baustellen. SIA 431:2022, Schweizer Norm SN 509 431 (SIA 2022)
GIS des Kantons Zürich: Meliorationskataster des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)
GIS des Kantons Zürich: Gewässerschutzkarte, Grundwasserkarte und Meliorationskataster des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 Ent 01 |
Prüfung Entwässerungskonzept Betriebsphase Das vorgesehene Entwässerungskonzept für die Betriebsphase wird dargestellt und hinsichtlich Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Vorgaben geprüft. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Entwässerung» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Ent 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Der Anlagenperimeter wird heute grösstenteils land- und forstwirtschaftlich genutzt (konventionelle Landwirtschaft). Die Ackerflächen des Haberstals und der Südteil des Dorfbachtals werden gemäss Meliorationskataster des Kantons Zürich über den eingedolten Haberstalgraben drainiert und in den Dorfbach abgeleitet (vgl. Fig. 5‑8).
Das Schmutzabwasser der umliegenden Höfe ist an die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Stadel-Windlach angeschlossen (vgl. Fig. 3‑1). Die ARA Stadel-Windlach, welche knapp 400 m südlich des Projektperimeters liegt, ist gemäss Angaben der Gemeinde Stadel auf 2'200 Einwohnegleichwerte ausgelegt. Die letzte Erweiterung der ARA erfolgte 2005. Gemäss Legislaturplanung 2023 – 2026 der Gemeinde Stadel sollte derzeit ein Vorprojekt für den Ausbau der ARA erarbeitet werden (Gemeinderat Stadel 2020).
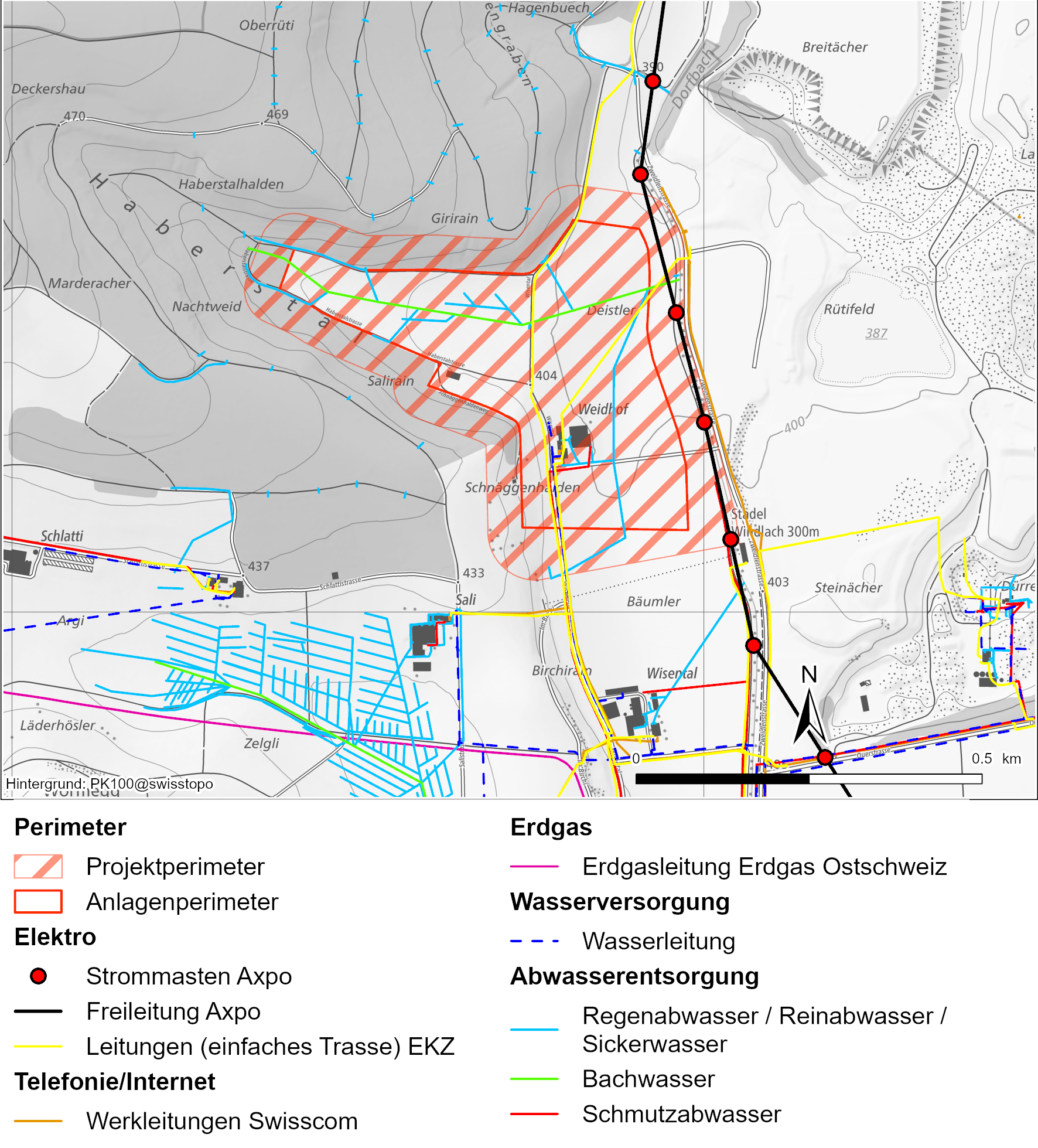
Fig. 5‑8:Bestehende Werkleitungen im und um den Projektperimeter (vgl. Anhang A)
Aufgrund der geplanten baulichen Aktivitäten werden Baustellenabwässer in allen Bau- und Rückbauphasen anfallen. Dabei ist grundsätzlich mit verschiedenen Baustellenabwässern (Meteorwasser aus der Baugrube, Abwasser von Zementbindung, Grundwasser aus Wasserhaltung, mögliches Bergwasser aus dem Erdreich) zu rechnen.
Die Vorgaben für die Baustellenabwasserbehandlung und -entsorgung werden im Rahmen des UVB 2. Stufe festgelegt, dabei wird auch ein Entwurf des Baustellenentwässerungskonzepts nach SIA 431 (SIA 2022) erarbeitet. Das definitive Baustellenentwässerungskonzept wird vor Baubeginn erstellt.
Während der Betriebsphase (ab Beginn Phase 2 bis Ende Phase 6) werden Abwässer in allen Perimetern der OFA anfallen. Das Abwasser wird getrennt gesammelt und abgeleitet. Häusliches Abwasser muss einer ARA zugeführt werden. Zu dem Zweck ist mit der Gemeinde Stadel ein allfällig nötiger Kapazitätsausbau der ARA Stadel-Windlach zu koordinieren.
Meteorwasser wird, soweit bzgl. Belastungsklasse zulässig, unbehandelt über Versickerungsanlagen abgeführt. Aufgrund der bekannten Vorkommen von gut durchlässigen Niederterrassenschottern mit einer Trockentiefe >25 m im Dorfbachtal (vgl. Kap. 3.4 und Kap. 5.6.4) stehen für Versickerungsanlagen diese Flächen im Vordergrund. Sollte eine Versickerung technisch nicht machbar sein, kann eine Einleitung in einen Vorfluter (unter Einhaltung der qualitativen und quantitativen Einleitbestimmungen) in Betracht gezogen werden. Ein Entwässerungskonzept für den Betrieb der Anlage wird für das Baugesuch erarbeitet und im UVB 2. Stufe beurteilt.
Im UVB 2. Stufe werden die Vorgaben für die Baustellenentwässerung (Bau- und Rückbauphasen) festgelegt. Das Entwässerungskonzept für die Betriebsphase (häusliches Abwasser, Platz- und Dachwasser) wird für das Baugesuch erarbeitet.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Entwässerung» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 Ent 01 |
Baustellenentwässerungskonzept Für die Baustellenentwässerung wird ein Baustellenentwässerungskonzept nach geltenden Vorgaben ausgearbeitet. |
|
PH-HU2 Ent 02 |
Erstellen Entwässerungskonzept für die Betriebsphase Für die Betriebsphase wird ein Entwässerungskonzept nach gewässerschutzrechtlichen Vorgaben (inkl. Prüfung von Versickerungsmöglichkeiten für Meteorwasser) erstellt. |
Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998, Stand 12. April 2016, SR 814.12 (VBBo)
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 04. Dezember 2015, Stand 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005, Stand 1. Januar 2020, SR 814.610 (VeVA)
Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung, Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen. Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2021a)
Boden und Bauen – Stand der Technik und Praktiken. Umwelt-Wissen Nr. 1508 (BAFU 2015a)
Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen, Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen. Ein Modul der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim Bauen». Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2022)
Erdbau, Boden. Bodenschutz und Bauen, VSS-40581 (VSS 2021)
Klassifikation der Böden der Schweiz – Bodenprofiluntersuchung, Klassifikationssystem, Definitionen der Begriffe, Anwendungsbeispiele Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, 3. Auflage (Brunner et al. 2010)
Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden. Schriftenreihe Nr. 24, Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Reckenholz (Brunner et al. 1997)
Handbuch «Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden (Handbuch Bodenprobenahme VBBo)» (BUWAL 2003a)
Erläuterungen zur Vollzugshilfe Prüfperimeter für Bodenverschiebungen, Amt für Landschaft und Natur ALN, Fachstelle Bodenschutz (Baudirektion Kanton ZH 2007)
Massnahmenplan Bodenschutz, Amt für Landschaft und Natur ALN, Fachstelle Bodenschutz (ALN Kanton ZH 2012)
Merkblatt Umgang mit dem Boden bei Bauvorhaben, Amt für Landschaft und Natur ALN, Fachstelle Bodenschutz (Baudirektion Kanton ZH 2011)
Merkblatt «Bodenprojekte», Anforderungen und Grundsätze für die Erarbeitung eines Bodenprojekts als Teil eines Bauprojekts ausserhalb der Bauzonen. Amt für Landschaft und Natur ALN, Fachstelle Bodenschutz (Baudirektion Kanton ZH 2012)
Merkblatt «Ressource Boden und Sachplan Fruchtfolgeflächen», Amt für Landschaft und Natur ALN und Amt für Raumentwicklung ARE, Stand Juni 2024, (Baudirektion Kanton ZH 2024)
Rekultivierungsrichtlinie, Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie, (FSKB 2021)
Rekultivierung von Böden, Erläuterungen zu den Richtlinien für Bodenrekultivierungen. Amt für Landschaft und Natur ALN, Fachstelle Bodenschutz, Stand 2017 (ALN Kanton ZH 2003)
Kriterien für Fruchtfolgeflächen im Kanton Zürich. Amt für Landschaft und Natur (ALN Kanton ZH & ARE Kanton ZH 2022)
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). UVP-Merkblatt Bereich Boden, Fachstelle Bodenschutz, Juni 2016 (Baudirektion Kanton ZH 2016)
GIS des Bundes: Bodeneignungskarte der Schweiz (GIS-ZH 2024)
GIS des Kantons Zürich: Bodenkarte des Kantons Zürich, Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV), Hinweiskarte anthropogene Böden (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 Bo 01 |
Erhebung und Darstellung Bodeneigenschaften Ergänzend zu bestehenden Bodenkarten sollen die physikalischen Bodeneigenschaften (inkl. Beurteilung Verdichtungsempfindlichkeit und Mächtigkeiten) anhand von Felderhebungen aufgenommen und auf Plänen dargestellt werden. Im Bereich von landwirtschaftlich genutzten Flächen oder Wald sind Bodenaufnahmen nach der Kartiermethodik FAL 24+ mittels Profilgruben und Handsondierungen durchzuführen. Im Bereich von stark anthropogen beeinflussten Böden (Umgebungsbelastung, Sportplätze, Schrebergärten) sind in Anlehnung an die FAL 24+ Handsondierungen durchzuführen. |
|
PH-HU1 Bo 02 |
Festlegung der Bodenverwertungsklassen Auf Basis der Bodeneigenschaften sowie Erhebungen zur chemischen (inkl. Fremdstoffe) und biologischen Belastung sind die Bodenverwertungsklassen für die beanspruchten Bodenflächen aufzuzeigen. |
|
PH-HU1 Bo 03 |
Auswirkungen auf den Boden während des Baus Auswirkungen (quantitativ, physikalisch) auf den Boden sowie spezifische Massnahmen für den Bodenschutz während des Baus werden aufgezeigt. |
|
PH-HU1 Bo 04 |
Flächenbeanspruchung und Bodenbilanz Abschätzung der beanspruchten Bodenflächen. Abschätzung der anfallenden Kubaturen an Bodenmaterial (inkl. Einteilung Bodenverwertungsklassen) sowie der Mengen, welche projektintern wiederverwendet werden können. Aufzeigen der externen Verwertung resp. Entsorgung für überschüssiges Bodenmaterial. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Boden» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Bo 02 bis 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Die Anträge des BAFU und Kantons Zürich werden berücksichtigt und in der weiteren Projektierung umgesetzt.
Der Projektperimeter tangiert land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete mit grösstenteils natürlichem Bodenaufbau innerhalb der Landwirtschaftszone (vgl. Fig. 3‑2). Gemäss Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV; GIS-ZH 2024) des Kantons Zürich ist entlang der Flur Schnäggenhalden eine Verdachtsfläche mit dem Belastungshinweis «Rebberg» vorhanden (vgl. Tab. 5‑4). Eine weitere Verdachtsfläche bzgl. chemische Bodenbelastungen existiert weiter südlich, im Bereich des Zielhangs der Schiessanlage Stadel-Windlach (vgl. Tab. 5‑5), wo zusätzlich ein Eintrag im Kataster der belasteten Standorte (KbS) vorhanden ist (vgl. Kap. 5.11.4).
Der Anlagenperimeter sowie der Eingliederungssaum wurden für die Beschreibung des Ist-Zustands aufgrund der unterschiedlichen Bodeneigenschaften in mehrere Teilflächen unterteilt (Anlagenperimeter: Teilflächen AP1 – AP5 / Eingliederungssaum: ES1 – ES5). Fig. 5‑9 gibt einen Überblick über die Flächeneinteilung.
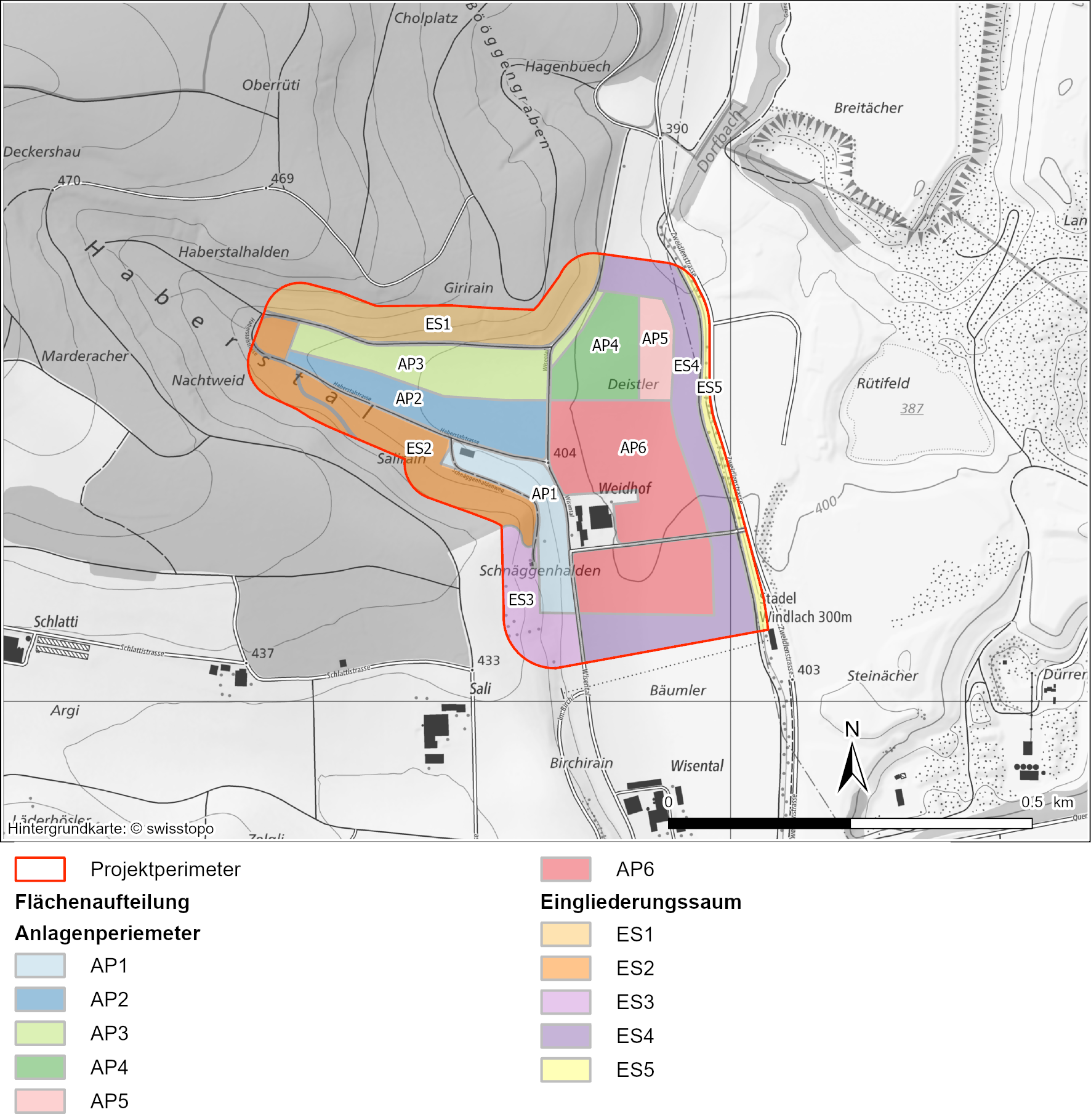
Fig. 5‑9:Teilflächen für die Bodenuntersuchungen innerhalb des Projektperimeters
Die Flächen sind gemäss kantonaler Bodenkarte überwiegend als senkrecht durchwaschene Braunerden und grund- oder hangwassergeprägte Braunerde-Gleye kartiert. Ein Teilbereich ist zudem als Auffüllung ausgeschieden (GIS-ZH 2024).
Um die Bodenbeschaffenheit und Verwertbarkeit des Bodenmaterials der betroffenen Bodenflächen zu beurteilen, wurden im Oktober 2023 im Projektperimeter (mit Schwerpunkt Anlagenperimeter) folgende Arbeiten ausgeführt:
-
Baggersondierungen und Kartierung nach FAL 24+ im gesamten Perimeter
-
Handsondierungen mit dem Flügelbohrer, ergänzend zu den Baggersondierungen im gesamten Perimeter
Im Rahmen der Bodenaufnahmen wurden die Bodentypen vor Ort bestimmt (vgl. Fig. 5‑10). Die detaillierten bodenkundlichen Aufnahmen der ausgeführten Bagger- und Handsondagen sind in den Beilagen A1.1 und A1.2 ersichtlich.
Der Vergleich mit der kantonalen Bodenkarte kann über die Geodaten des Kantons Zürich gezogen werden (GIS-ZH 2024). Die Bodenaufnahmen stimmen grösstenteils mit der kantonalen Bodenkarte überein, wobei die angetroffenen Braunerden weniger vergleyt sind und die Braunerden-Gleye kleinflächiger ausfallen und weniger weit nach Norden reichen als verzeichnet.
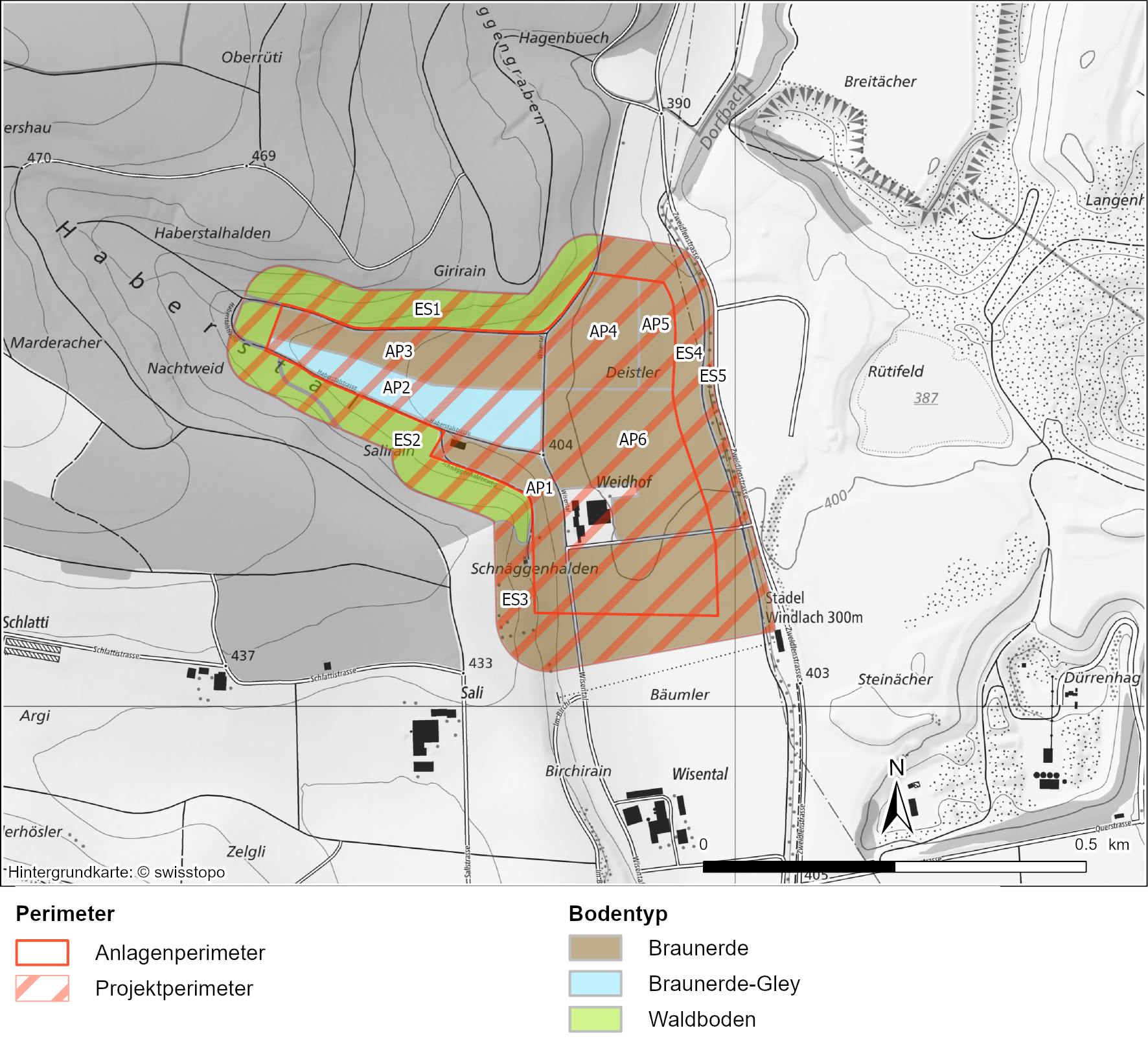
Fig. 5‑10:Bodentyp gemäss Bodenaufnahmen 2023 (vgl. Beilagen A1.1 und A1.2)
In Tab. 5‑4 werden die angetroffenen Bodeneigenschaften, die Verdichtungsempfindlichkeit, der Verdacht auf chemische Belastungen und der Fremdstoffgehalt pro Bereich im Anlagenperimeter beschrieben. Auf die physikalischen Bodeneigenschaften wird in der untenstehenden Zusammenstellung nicht spezifisch eingegangen, da gemäss den Bodenaufnahmen weder der Skelettgehalt (< 20 Gew.-% im Oberboden, < 40 Gew.-% im Unterboden), noch die Feinerdekörnung (Tongehalt der mineralischen Feinerde < 40 Gew.-% im Ober- und Unterboden) oder die Gefügeform (kein Einzelkorngefüge, Kohärentgefüge oder verdichtete Gefügeformen) eine Auswirkung auf die Verwertbarkeit des Bodens haben. Ebenfalls nicht separat aufgeführt sind die biologischen Bodenbelastungen durch Neophytenvorkommen. Diese Aufnahmen sind in Kap 5.13 zu finden.
Tab. 5‑4:Bodenaufnahmen Anlagenperimeter (vgl. Beilagen A1.1 und A1.2)
|
Bereich |
Bodentyp |
Oberboden |
Unterboden |
Verdichtungs-empfindlichkeit |
Chemische Bodenbelastung (gemäss PBV) |
Fremdstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AP1 Landwirtschaftsfläche Schnäggenhalden (HS_H_118, HS_H_120, BS_H_04) |
Mässig tiefgründig bis ziemlich flachgründige Braunerde, teilweise gleyig, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen bis hangwasserbeeinflusst |
25 – 30 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
20 – 30 cm mächtig, lehmreicher Sand bis sandiger Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
normal empfindlich |
An der Schnäggenhalden: «Spezialkulturen»: Es werden Belastungen durch Pestizide oder andere Hilfsstoffe, welche in Rebbergen eingesetzt werden, erwartet. |
Ziegelbruch-stücke <1Gew.-% |
|
AP2 Landwirtschaftsfläche (HS_H_108, BS_H_03) |
Mässig tiefgründige Braunerde-Gleye, grund- oder hangwassergeprägt, stark gleyig, selten bis zur Oberfläche wassergesättigt |
30 – 5 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
65 – 90 cm mächtig, Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
stark empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Ziegelbruch-stücke <1Gew.-% |
|
AP3 Landwirtschaftsfläche (HS_H_109, HS_H_110, HS_H_111, BS_H_02) |
Tiefgründige Braunerde, schwach pseudogleyig bis gleyig, grund- oder hangwasserbeeinflusst und normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
15 – 35 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
70 – 85 cm mächtig, überwiegend lehmiger Schluff bis Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
normal empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Keine Fremdstoffe |
|
AP4 Landwirtschaftsfläche (HS_H_104, HS_H_107) |
Tiefgründige Braunerde, teilweise schwach gleyig, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
35 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
65 cm mächtig, lehmreicher Sand bis Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
schwach bis normal empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Keine Fremdstoffe |
|
AP5 Landwirtschaftsfläche (HS_H_105) |
Mässig tiefgründige Braunerde, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
40 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |
20 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
schwach empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Keine Fremdstoffe |
|
AP6 Landwirtschaftsfläche (HS_H_115, HS_H_117, BS_H_05) |
Mässig tiefgründige Braunerde, vereinzelt schwach pseudogleyig, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
30 – 45 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
35 – 50 cm mächtig, lehmiger Sand, sandiger Lehm bis Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
schwach empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Keine Fremdstoffe |
Verdichtungsempfindlichkeit
Die durch das Projekt tangierten landwirtschaftlich genutzten Böden im Anlagenperimeter sind aufgrund der oben genannten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen überwiegend schwach bis normal empfindlich. Sie sind nur beschränkt mechanisch belastbar. Die Bereiche mit Braunerde-Gleye sind indessen als «stark empfindlich» einzustufen. Während längerer Nassperioden sowie ausserhalb der Vegetationszeit sind die Böden nur eingeschränkt mechanisch belastbar.
Bodenverwertungsklasse
Gemäss der Vollzugshilfe «Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung» (BAFU 2021a) wird der Boden aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften, der chemischen Schadstoffbelastung, der biologischen Belastung (Neophyten) sowie des Fremdstoffgehalts als verwertungspflichtig, eingeschränkt verwertbar, nur am Entnahmeort verwertbar oder nicht verwertbarer Boden eingestuft. Die Verwertbarkeit des Bodens wird im vorliegenden Fall nicht durch physikalische Bodeneigenschaften oder Fremdstoffgehalte eingeschränkt. Neophytenvorkommen können die Verwertung stellenweise einschränken. Weil die biologische und die chemische Bodenbelastung noch nicht bekannt sind, wird die Verwertungsbeurteilung im Rahmen des UVB 2. Stufe vorgenommen.
Nach denselben Kriterien, wie im Anlagenperimeter, werden die Böden im Eingliederungssaum in der nachfolgenden Tab. 5‑5 beurteilt.
Tab. 5‑5:Bodenaufnahmen Eingliederungssaum (vgl. Beilagen A1.1 und A1.2)
|
Bereich |
Bodentyp |
Oberboden |
Unterboden |
Verdichtungs-empfindlichkeit |
Chemische Bodenbelastung (gemäss PBV) |
Fremdstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ES1 Eingliederungssaum Wald (HS_H_113) |
Ziemlich flachgründige Braunerde, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
20 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |
25 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |
schwach empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Keine Fremdstoffe |
|
ES2 Eingliederungssaum Wald (HS_H_112, HS_H_114) |
Tiefgründige Braunerde, schwach pseudogleyig, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
20 – 30 cm mächtig, lehmreicher Sand bis sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
70 – 80 cm mächtig, sandiger Lehm bis Lehm, locker gelagert, krümelig, subpolyedrig |
schwach bis normal empfindlich |
An der Schnäggenhalden: «Spezialkulturen»: Es werden Belastungen durch Pestizide oder andere Hilfsstoffe, welche in Rebbergen eingesetzt werden, erwartet. |
Ziegelbruch-stücke <1Gew.-% |
|
ES3 Eingliederungssaum Schnäggenhalden (HS_H_119 – steiler Bereich, HS_H_121 – ebener Bereich) |
Steiler Bereich: Flachgründige Braunerde, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen Ebener Bereich: Tiefgründige Braunerde, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
Steiler Bereich: 20 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig Ebener Bereich: 30 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
Steiler Bereich: 10 cm mächtig, sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig, subpolyedrig Ebener Bereich: 70 cm mächtig, sandiger Lehm bis Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
schwach empfindlich |
An der Schnäggenhalden: «Spezialkulturen»: Es werden Belastungen durch Pestizide oder andere Hilfsstoffe, welche in Rebbergen eingesetzt werden, erwartet. Zusätzlich: Verdachtsfläche beim Scheibenstand der Schiessanlage. |
Ziegelbruch-stücke <1Gew.-% |
|
ES4 Eingliederungssaum landwirtschaftliche Fläche (HS_H_102, HS_H_103, HS_H_106, HS_H_123, HS_H_125, BS_H_06) |
Mässig tiefgründige bis tiefgründige Braunerde, vereinzelt schwach pseudogleyig, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
25 – 40 cm mächtig, lehmreicher Sand bis sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
35 – 65 cm mächtig, lehmreicher Sand, sandiger Lehm bis Lehm, locker gelagert, subpolyedrig |
schwach empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Ziegelbruch-stücke <1Gew.-% |
|
ES5 Eingliederungssaum Böschung Dorfbach (HS_H_116, HS_H_124) |
Ziemlich flachgründige Braunerde, normal durchlässig, senkrecht durchwaschen |
15 cm mächtig, lehmreicher Sand bis sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig |
25 – 30 cm mächtig, lehmreicher Sand bis sandiger Lehm, locker gelagert, krümelig, subpolyedrig |
schwach empfindlich |
Keine Verdachtsfläche |
Keine Fremdstoffe |
Verdichtungsempfindlichkeit
Die durch das Projekt tangierten Waldböden im Eingliederungssaum sind aufgrund der oben genannten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen schwach bis normal empfindlich.
Die durch das Projekt tangierten landwirtschaftlich genutzten Böden im Eingliederungssaum sind aufgrund der gemäss Tab. 5‑5 aufgeführten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen schwach empfindlich. Nach entsprechender Abtrocknung sind die Böden mechanisch belastbar.
Bodenverwertungsklasse
Bzgl. Bodenverwertungsklasse gilt dasselbe Vorgehen wie für den Boden im Anlagenperimeter (vgl. Kap. 5.9.4.1).
Bodenkubaturen
Aufgrund der bei den Kartierungen angetroffenen mittleren Bodenmächtigkeiten (vgl. Beilagen A1.1 und A1.2) wurden für die von Bodenabtrag betroffenen Teilflächen innerhalb des Eingliederungssaums resp. im Anlagenperimeter ungefähre zu erwartende Bodenvolumina für Ober- resp. Unterboden berechnet, welche in der Bauphase voraussichtlich bewegt werden müssen. Bodenflächen innerhalb des Eingliederungssaums.
Tab. 5‑6:Bodenkubaturen (gerundet)
|
Bereich |
Kubatur Oberboden [m³ fest] |
Kubatur Unterboden [m³ fest] |
|---|---|---|
|
Eingliederungssaum (ES3–ES5) |
14'500 |
21'500 |
|
Anlagenperimeter (AP1 – AP6) |
40'500 |
64'500 |
|
Total Abtrag |
55'000 |
86'000 |
In der Phase 1 (Bau zentraler Bereich und Testbereiche) finden Bodeneingriffe innerhalb eines Grossteils des Projektperimeters zwecks Erstellens der Arealzufahrten sowie Einrichtens der Flächen für die Baustelle der OFA statt. In Phase 3 (Bau SMA-Lager) wird der Funktionsbereich «Einlagerung» erstellt (vgl. Kap. 4.2.2), wofür nochmals Boden umgelagert resp. abgetragen wird.
Die während diesen Phasen betroffenen Bodenflächen betragen plangemäss bis zu 17 ha, wovon rund 12 ha innerhalb des Anlagenperimeters betroffen sind. Rund 5 ha davon liegen innerhalb des Eingliederungssaums.
Während der Phase 1 werden voraussichtlich bis zu 44'000 m³ (fest) Oberboden verschoben, wobei rund 15'000 m³ (fest) innerhalb des Eingliederungssaums anfallen, welche vermutlich grösstenteils wieder vor Ort eingebaut werden können (vgl. Tab. 5‑6). Daneben fallen in der Phase 1 rund 56'000 m³ (fest) Unterboden an, wobei auch hier rund 22'000 m³ (fest) aus dem Eingliederungssaum stammen und voraussichtlich wieder eingebaut werden können. Die übrigen Kubaturen des Unter- und Oberbodens (rund 63'000 m³ (fest)), welche grösstenteils aus dem Anlagenperimeter stammen, müssen voraussichtlich vollständig abtransportiert und verwertet werden (z.B. für die Wiederherstellung von FFF, vgl. Kap. 5.10.5.1).
Der erwartete Bodenabtrag während Phase 3 ist im Vergleich zu Phase 1 kleiner: Insgesamt fallen dann rund 41'000 m³ (fest) am, wovon rund 11'000 m³ (fest) aus Oberboden und rund 30'000 m³ (fest) aus Unterboden bestehen. Voraussichtlich wird dieses Bodenmaterial vollständig abtransportiert und verwertet.
Bodenzwischenlager / Bodenverwertung
Bodenmaterial, welches allenfalls als Substrat für die Gestaltung des Eingliederungssaums verwendet werden kann, soll – soweit projektbedingt möglich – direkt vor Ort kurzzeitig zwischengelagert werden.
Grundsätzlich wird eine Direktumlagerung des anfallenden, überschüssigen Bodenmaterials innerhalb des Projektperimeters angestrebt. Ist eine Direktumlagerung nicht möglich, ist das Bodenmaterial bis zu seiner entsprechenden Wiederverwertung fachgerecht zwischenzulagern und zu bewirtschaften. Der genaue Umgang und Ablauf für die Bodenzwischenlagerung sind zum aktuellen Projektstand noch nicht definiert. Somit ist auch die detaillierte Bodenverwertung noch nicht näher bekannt. Im Rahmen der UVB 2. Stufe erfolgend detailliertere Abklärungen zur Bodenzwischenlagerung resp. -verwertung. Bei einer externen Verwertung ist die entsprechende BAFU-Vollzugshilfe zu beachten (BAFU 2024e). Mit der Erarbeitung des Bodenprojekts wird eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson beauftragt.
Rückbau
In den Phasen 8 und 9 werden die Bauwerke an der Oberfläche zurückgebaut sowie die nicht mehr benötigte Infrastruktur abgebrochen. Diese Flächen sollen nach heutigem Stand wieder rekultiviert oder einer später zu definierenden Nachnutzung zugeführt werden.
Bodenarbeiten finden während den umfangreichen Bau- und Rückbauphasen (v.a. Phasen 1 und 3 resp. 8 und 9) statt. Es werden sowohl im Eingliederungssaum als auch im Anlagenperimeter ausschliesslich Flächen mit natürlich gewachsenen und oftmals tiefgründigen Böden beansprucht. Die Beanspruchung durch Umlagerung und Verschiebung beträgt insgesamt knapp 55'000 m³ (fest) Oberboden resp. ca. 86'000 m³ (fest) Unterboden. Die Abklärungen für die Verwertung von anfallendem überschüssigem Bodenmaterial werden im Rahmen des UVB 2. Stufe durch eine ausgewiesene Fachperson und entsprechend den dannzumal geltenden Vollzugshilfen durchgeführt.
In der Betriebsphase wird kein Boden zusätzlich tangiert.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Boden» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Bo 01 |
Flächenbeanspruchung und Bodenbilanz (Bauphase) Die vom Projekt temporär und permanent tangierten Flächen werden erhoben. Daraus werden die anfallenden Bodenkubaturen abgeschätzt, die projektintern verwendet werden können. Für die projektintern wiederverwendbaren Kubaturen wird aufgezeigt, wo diese vorübergehend zwischengelagert werden können. Zusätzlich wird die externe Verwertung resp. Entsorgung für überschüssiges Bodenmaterial dargelegt. |
|
PH-HU2 Bo 02 |
Ermittlung der chemischen und biologischen Bodenbelastung (Bauphase) Die tangierten Bodenflächen, v.a. die PBV-Flächen werden beprobt und analysiert. Die Ergebnisse der Bestandsprüfung der Neophyten fliessen in die Bewertung ein (vgl. PH-HU2 UgO 01). |
|
PH-HU2 Bo 03 |
Festlegung der Bodenverwertungsklassen (Bauphase) Die Bodenverwertungsklassen für die beanspruchten Bodenflächen werden auf Basis der bereits ermittelten Bodeneigenschaften sowie der chemischen und biologischen Belastung festgelegt. |
|
PH-HU2 Bo 04 |
Auswirkungen auf den Boden während Bau und Rückbau inkl. Entwurf Bodenschutzkonzept Eine Beurteilung der Auswirkungen (quantitativ, physikalisch) auf den Boden während des Baus und des Rückbaus (Rekultivierung) wird vorgenommen und es werden spezifische Bodenschutzmassnahmen (Entwurf Bodenschutzkonzept) aufgezeigt. |
Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998, Stand 1. Januar 2024, SR 910.1 (LwG)
Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000, Stand 1. Juli 2022, SR 700.1 (RPV)
Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich vom 7. September 1975, Stand 1. April 2024, LS 700.1 (PBG)
Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF): Vollzugshilfe 2006, Bundesamt für Raumentwicklung (ARE 2006)
Ressource Boden und Sachplan Fruchtfolgeflächen. Anforderungen beim Planen und Bauen. Amt für Landschaft und Natur Kt. ZH ALN und Amt für Raumentwicklung Kt. ZH ARE, Stand Juni 2024 (Baudirektion Kanton ZH 2024)
GIS des Kantons Zürich: Fruchtfolgeflächen (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 FFF 01 |
Flächenbedarf Die Fläche der durch den Projektperimeter längerfristig tangierten FFF ist zu ermitteln. |
|
PH-HU1 FFF 02 |
Qualität der FFF Die aktuelle Qualität der FFF wird vor Ort überprüft. |
|
PH-HU1 FFF 03 |
Wiederverwertung Boden zur FFF-Kompensation FFF sind ersatzpflichtig, daher muss der abgetragene (geeignete) Boden für die Erstellung von FFF gleicher Qualität wiederverwertet werden. Die Aufwertungsflächen sind festzulegen. |
|
PH-HU1 FFF 04 |
Interessenabwägung Bau OFA und FFF-Verlust Für die Beanspruchung von FFF muss eine Interessenabwägung durchgeführt werden:
FFF-Verluste von mehr als 3 ha sind dem ARE zu melden (ARE 2006, S. 8). |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «FFF» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 FFF 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Der Anlagenperimeter besteht fast vollständig aus FFF (GIS-ZH 2024, vgl. Fig. 4‑3). Auch innerhalb des Eingliederungssaums sind teilweise FFF vorhanden. Um die Qualität der FFF zu eruieren und die Grösse der zu kompensierenden Fläche festzulegen, wurden die ausgeschiedenen FFF sowie die Zuteilung zu den verschiedenen Nutzungseignungsklassen (NEK) im Oktober 2023 anhand von Felduntersuchungen überprüft. Folgende Arbeiten wurden im Projektperimeter ausgeführt:
-
Baggersondierungen und Kartierung nach FAL 24+ im gesamten Perimeter
-
Handsondierungen mit dem Flügelbohrer, ergänzend zu den Baggersondierungen im gesamten Perimeter
Die detaillierten bodenkundlichen Aufnahmen der ausgeführten Hand- und Baggersondagen sind in den Beilagen A1.1 und A1.2 ersichtlich und in Kap. 5.9.4 ausführlich beschrieben. Die tangierten Teilflächen wurden analog den Bodenaufnahmen entsprechend ihren Eigenschaften und der Beanspruchung aufgeteilt (vgl. Fig. 5‑9). Die Teilfläche ES5 entlang der Böschung des Dorfbachs enthält gemäss GIS-ZH (2024) keine FFF und wurde daher nicht beurteilt. Für die Beurteilung der NEK resp. der FFF-Qualität wurden gemäss Merkblatt des Kantons Zürich die vor Ort aufgenommenen Bodenparameter (Mächtigkeiten, Skelettgehalt, Vernässungen und Gefüge), die Topografie sowie die Klimazone verwendet (Baudirektion Kanton ZH 2024).
Gemäss GIS-ZH (2024) wurden die FFF im Anlagenperimeter überwiegend als NEK 1 – 3 sowie 5 klassiert. Die Böden im nördlichen Teil des Projektperimeters sind gemäss Inventardaten für eine uneingeschränkte Fruchtfolge (NEK 1 und 2) geeignet, im südlichen Bereich wird eine getreidebetonte Fruchtfolge (NEK 3) bevorzugt und im westlichen Projektperimeter überwiegt eine futterbaubetonte Fruchtfolge (NEK 5). In Randbereichen des Projektperimeters und v.a. entlang der Schnäggenhalden sind gemäss Inventardaten kleinflächige bedingte FFF vorhanden, welche als NEK 6, 7 und 9 klassiert sind.
Verglichen mit den Inventardaten gemäss GIS-ZH (2024) stimmen die NEK der Feldaufnahmen im Eingliederungssaum in den Teilflächen ES3 und ES4 grösstenteils überein. Im Anlagenperimeter gilt dasselbe für die Teilflächen AP2, AP4 und AP6. In Teilfläche AP1 (Schnäggenhalden) wurden am Hangfuss eine höhere NEK als in den Inventardaten festgestellt (NEK 4 statt 6). In Teilfläche AP3 wurde eine NEK 2 kartiert, während in den Inventardaten eine NEK 5 mit limitierendem Faktor «Erosion» ausgewiesen ist. In Teilfläche AP5 weicht die kartierte NEK ebenfalls ab. Gemäss Inventardaten sollte dort eine NEK 3 mit limitierendem Faktor «Skelett» vorhanden sein, jedoch wurde eine NEK 2 angetroffen. Die nachfolgenden Abbildungen Fig. 5‑11 und Fig. 5‑12 geben eine Übersicht über die für das Projekt kartierten FFF resp. NEK.

Fig. 5‑11:Kartierte Fruchtfolgeflächen im Projektperimeter (vgl. Beilagen A1.1 und A1.2)

Fig. 5‑12:Kartierte NEK im Projektperimeter innerhalb der untersuchten Teilflächen
In den Phasen 1 und 3 finden im Bereich des Projektperimeters flächige Eingriffe in die vorhandenen FFF statt, wobei für den Bau der Anlage ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und eine raumplanerische Standortbegründung für den Bau der Anlage vorliegt (vgl. Nagra 2025a). Der Boden wird im Anlagenperimeter als auch teilweise im Eingliederungsaum abgetragen (vgl. Kap. 5.9.5), um die Flächen für den Bau der OFA einzurichten. Rekultivierungen im Rahmen der FFF-Kompensation ausserhalb des Projektperimeters finden voraussichtlich zur gleichen Zeit statt (vgl. Kap. 5.9.5.1). Sie sind anhand der geltenden BAFU-Vollzugshilfe auszugestalten (BAFU 2024e).
Total werden innerhalb des Projektperimeters rund 14.7 ha FFF beansprucht (vgl. Tab. 4‑1 resp. Fig. 4‑3), wobei rund 75% resp. 11.0 ha der FFF innerhalb des Anlagenperimeters beansprucht werden und rund 25% resp. 3.7 ha innerhalb des Eingliederungssaums (vgl. Tab. 5‑7).
Tab. 5‑7:Flächenbeanspruchung Fruchtfolgeflächen nach NEK im Anlagenperimeter und Eingliederungssaum (gerundet)
|
Teilfläche |
NEK 1 |
NEK 2 |
NEK 3 |
NEK 4 |
NEK 5 |
NEK 6 (bedingte FFF) |
Total |
|
AP |
1.4 ha |
2.4 ha |
4.9 ha |
0.4 ha |
1.6 ha |
0.3 ha |
11.0 ha |
|
ES |
0.1 ha |
1.7 ha |
1.9 ha |
3.7 ha |
|||
|
Total |
1.5 ha |
4.1 ha |
6.8 ha |
0.4 ha |
1.6 ha |
0.3 ha |
14.7 ha |
Eine mehrjährige Beanspruchung von FFF wird als Verbrauch von FFF gewertet. Somit werden für die beanspruchten Flächen Kompensationen vorgesehen. Das Vorgehen für die Kompensation von FFF wird im BAR (Kap. 6.6, Nagra 2025a) detailliert ausgeführt.
Rückbau
In Phase 9 werden die Bauwerke an der Oberfläche zurückgebaut sowie die nicht mehr benötigte Infrastruktur abgebrochen. Die freiwerdenden Flächen können nach heutigem Stand wieder rekultiviert oder einer später zu definierenden Nachnutzung zugeführt werden.
Während der Betriebsphase sind keine Auswirkungen auf FFF vorhanden.
Durch das Projekt werden ab der Bauphase mehrjährig FFF beansprucht, weshalb die Flächen im vollen Umfang kompensiert werden müssen. Vor Einreichung des Baugesuchs sind die notwendigen Kompensationsmassnahmen (räumlich und zeitlich) für die beanspruchten FFF zu bestimmen. Für die Kompensation sind die Vorgaben gemäss Sachplan FFF sowie die kantonalen Vorgaben zu beachten.
Gemäss BAR (Nagra 2025a) liegen die für das RBG notwendigen Voraussetzungen für die Beanspruchung von FFF (überwiegendes Interesse, raumplanerische Standortbegründung) für die Realisierung der OFA vor.
Während der Betriebsphase werden keine weiteren FFF benötigt. Mit Abschluss des Rückbaus werden die Flächen wieder frei.
Vorbehältlich der Sicherung von Ersatzflächen sowie unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise und unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «FFF» eingehalten werden.
|
PH-HU2 FFF 01 |
Ermitteln tatsächlicher Flächenbedarf, Sichern von Ersatzflächen Der Flächenbedarf für die durch das Vorhaben tangierten FFF (permanenter Verbrauch) wird ermittelt und entsprechende Ersatzflächen gesichert. |
|
PH-HU2 FFF 02 |
Wiederverwertung Boden auf Aufwertungsflächen Abgetragener, geeigneter Boden wird an geeigneten Standorten wiederverwertet. Diese Aufwertungsflächen sind zu definieren und mittels Feldaufnahmen auf ihre Eignung hin zu überprüfen. |
Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998, Stand 1. Juli 2024, SR 814.680 (Altlasten-Verordnung, AltlV)
Bauvorhaben und belastete Standorte. Ein Modul der Vollzugshilfe «Allgemeine Altlastenbearbeitung», Umwelt-Vollzug Nr. 1616 (BAFU 2016a)
GIS des Bundes: Karten Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze, des öffentlichen Verkehrs sowie des Militärs (swisstopo 2024)
GIS des Kantons Zürich: Kataster der belasteten Standorte (KbS, GIS-ZH 2024)
Der Umweltbereich «Altlasten» wurde in der Voruntersuchung aufgrund fehlender Auswirkungen als nicht relevant bewertet.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 den folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Berücksichtigung des Antrags
Der Antrag 19 des BAFU wird berücksichtigt.
Im Anlagenperimeter befinden sich keine Flächen, welche im KbS des Kantons Zürich eingetragen sind (vgl. Fig. 5‑13).
Der Eingliederungssaum tangiert in der südwestlichsten Ecke (Parzelle Kat.-Nr. 825) rund 15 m² Fläche des Kugelfangs der Schiessanlage Stadel-Windlach (300 m Scheibenstand), welcher als Standort-Nr. 0100/I.0001-001 im KbS als «belasteter und (bezüglich des Schutzguts Boden) sanierungsbedürftiger Standort» ausgeschieden wurde. Gemäss Auskunft der Sektion Altlasten des Kantons Zürich9 ist die Gemeinde Stadel verpflichtet, den KbS-Standort zu sanieren, hat jedoch eine Fristerstreckung dafür beantragt, um die Sanierung mit dem Nagra-Vorhaben koordinieren zu können. Ziel ist es, dass der KbS-Standort bereits vor der Ausführung des Nagra-Vorhabens fachgerecht saniert ist, so dass im Ausgangszustand kein belasteter Standort mehr vorhanden ist.
Zwischen Windlach und Glattfelden sind durch die Wiederauffüllungen der umliegenden Kiesgruben diverse Ablagerungsstandorte vorhanden, welche als «belastet, ohne schädliche oder lästige Einwirkungen» klassiert sind (Art. 5 Abs. 4 Bst. a AltlV) und den Projektperimeter nicht
tangieren. Der nächstgelegene Ablagerungsstandort befindet sich angrenzend an die Zweidlenstrasse östlich des Projektperimeters (Kiesgrube Breitächer) auf der benachbarten Parzelle Kat.-Nr. 2138 (Standort-Nr. 0100/D.0004-0).
Die Kataster des Eidgenössische Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, des Bundesamts für Zivilluftfahrt und des Bundesamts für Verkehr enthalten in der näheren Umgebung keine Einträge.
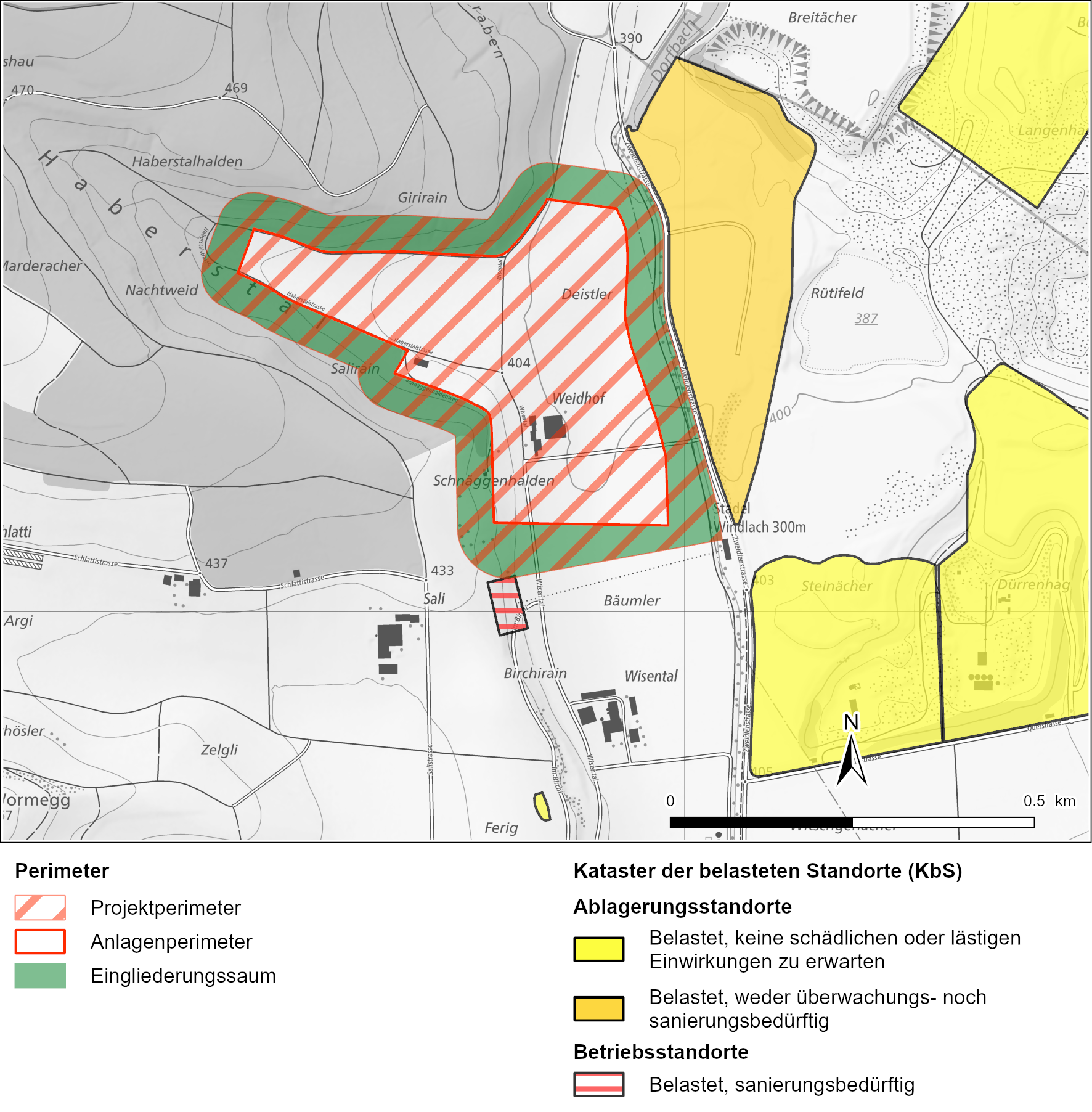
Fig. 5‑13:Auszug aus dem KbS des Kantons Zürich beim Projektperimeter (GIS-ZH 2024)
Telefonische Auskunft der Sektion Altlasten des AWEL am 28.03.2024 ↩
Der belastete Standort auf der Parzelle Kat.-Nr. 825 wird in geringem Ausmass (15 m²) durch den Eingliederungssaum tangiert. In diesem Bereich sind Eingliederungsmassnahmen vorgesehen, ggf. eine wallförmige Geländemodellierung zur Eingliederung und zu Sicht- und Lärmschutzzwecken (vgl. Kap. 4.1.2.2). Da davon ausgegangen wird, dass der Standort vorgängig saniert wird (vgl. Kap. 3.5.2 und Kap. 5.11.4), hat das Vorhaben keine Auswirkungen.
Auf die übrigen belasteten Standorte im Projektgebiet hat das Vorhaben keine Auswirkungen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass der vom Vorhaben geringfügig (15 m²) tangierte belastete Standorte (Kugelfang) vor Baubeginn saniert sein wird.
Das Vorhaben tangiert somit keinen belasteten Standort. Der Umweltbereich «Altlasten» ist somit nicht relevant.
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015, Stand 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005, Stand 1. Januar 2020, SR 814.610 (VeVA)
Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008, Stand 1. September 2024, SR 814.911 (Freisetzungsverordnung, FrSV)
Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998, Stand 12. April 2016, SR 814.12 (VBBo)
Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle – Ausbauasphalt, Strassenaufbruch, Betonabbruch, Mischabbruch. 2. aktualisierte Auflage (BAFU 2006b)
Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten, SIA 430, SN 509 430 (SIA 1993)
VSS-Norm «Recyclingbaustoffe» (Grundnorm SN 670 071; VSS 2022) und «Asphaltmischgut» Mischgutanforderungen – Teil 8: Ausbauasphalt (SN EN 13108-8; VSS 2019a)
Bauabfälle. Ein Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA). Umwelt-Vollzug Nr. 1826 (BAFU 2020a)
Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung. Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen. Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2021a)
Wegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten. Vollzug Umwelt VU 3009 (Schenk 2003)
|
PH-HU1 Abf 01 |
Erstellung eines groben Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzepts Abschätzung der projektbedingt anfallenden Abfallmengen (Aushub, Ausbruch, Strassenaufbruch, Ausbauasphalt, Boden, Betonabbruch etc.) und Definition der grundsätzlichen Verwertungs- resp. Entsorgungswege. |
|
PH-HU1 Abf 02 |
Maximierung der Verwertung und Minimierung der Transportdistanzen Aufzeigen von möglichen Lösungen (Verwertung, Deponierung) für den Umgang mit dem Ausbruchmaterial. Prüfung und Dokumentation der (lokalen) Verwertungsmöglichkeiten des Ausbruchs als Roh- bzw. Baustoff. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Abfälle, umweltgefährdende Stoffe» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Abf 01 und 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Der Kanton Schaffhausen hat in seiner Stellungnahme vom 24. Januar 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.3):
Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich hat in seiner Stellungnahme vom 19. Januar 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. auch Kap. 5.6 sowie Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Im UVB 1. Stufe sind aufgrund der groben Festlegungen des momentanen Planungsstandes nur Richtwerte für das Entsorgungskonzept vorhanden. Die Anträge des BAFU, des Kantons Schaffhausen sowie des AWEL und der KOBU bzgl. des Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzepts sowie der Materialqualität werden im UVB 2. Stufe behandelt.
Der Antrag 20 des BAFU (Vollständigkeitsprüfung) wird im Bericht berücksichtigt.
Heute befinden sich verschiedene Bauten im Projektperimeter: Wohngebäude Weidhof (Wisental 30 und 32, Baujahr 1972), Remise (Wisental 32.1, Baujahr 2010), Stall (Wisental 32.2, Baujahr 1972), Holzschopf (Haberstalstr. 9.1, Baujahr 1972) sowie einige Gartenhäuschen und Holzunterstände/Ställe, welche nicht offiziell verzeichnet sind.
Die heute vorhandenen, oben genannten Bauten werden vor Beginn der Phase 1 rückgebaut sein (vgl. Kap. 3.5.2). Rückbau und Entsorgung werden fachgerecht geplant und durchgeführt. Die vorhandene Freileitung der Axpo (vgl. Fig. 5‑8) bleibt bestehen. Zum Zeitpunkt des Ausgangszustands sind im Projektperimeter daher keine Abfälle oder umweltgefährdende Stoffe dieser Bauten mehr vorhanden.
Verschiedene bestehende Anlagen müssen für die Einrichtung der OFA vollständig rückgebaut werden. Es sind dies:
-
Rückbau Gemeindestrassen und Flurwege inkl. darunter oder entlang verlaufende Leitungstrassen (d.h. Belagsaufbruch, Ausbauasphalt, Betonabbruch)
-
Rückbau resp. Verlegung der erdverlegten Leitungen (Strom, Wasser, Abwasser, Drainagen, Telecom) sowie die Bachdolung des Haberstalgrabens
-
Rückbau der Plattenbrücke über den Dorfbach
Beim Bau des gTL fallen hauptsächlich Abfälle in Form von Bodenabtrag (vgl. Kap. 5.9.5.1) sowie Aushub- und Ausbruchmaterial (vgl. Kap. 4.3) an.
Gemäss Vorhabensbeschrieb (vgl. Kap. 4) ist davon auszugehen, dass der Anlagenperimeter vollständig überbaut resp. befestigt wird und für die Umsetzung baulicher Massnahmen auch im Eingliederungssaum stellenweise Bodenverschiebungen vorgesehen sind. Es ist daher zu erwarten, dass der Boden in diesen Bereichen abgetragen werden muss. Dabei fallen bis zu 150'000 m³ (fest) Boden (vgl. Tab. 4‑2 resp. Tab. 5‑6) an. Geprüft werden kann, ob ein Teil davon beispielsweise zur Rekultivierung oder für Bodenverbesserungsmassnahmen im Eingliederungssaum wieder eingebaut werden kann. Überschüssiges Bodenmaterial wird gemäss der Verordnung über Belastungen des Bodens VBBo (1998) und der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen (BAFU 2021a, BAFU 2022) fachgerecht verwertet resp. entsorgt. Die Ermittlung der Bodenbelastung (Schadstoffbeprobung) wird für UVB 2. Stufe durchgeführt.
Das Ausbruchmaterial aus den UTA beträgt ca. 1.9 – 3.2 Mio. m³ (fest; vgl. Tab. 4‑2). Zudem generiert der Bau der OFA Aushubmaterial aus oberflächennahen Baugruben von bis zu 200'000 m³ (fest). Geprüft werden kann, ob ein Teil des anfallenden unverschmutzten Materials für das Bauplanum oder den Bau der OFA (z.B. Betonherstellung) resp. die Geländemodellierung für die Landschaftseingliederung verwendet werden kann (vgl. Kap. 4.3).
Das verbleibende Aushub- und Ausbruchmaterial muss abtransportiert und entsprechend den nach Art. 19 Abs. 1 VVEA genannten Möglichkeiten möglichst vollständig verwertet werden. Dafür soll, abhängig von der Materialqualität und den künftigen Verwertungsmöglichkeiten, für die Bauphase eine Lösung gesucht werden. Eine Ablagerung auf einer Deponie ist zu vermeiden.
Beim Rückbau der Bauten und Anlagen im Projektperimeter (Phasen 8 und 9) werden weitere Bauabfälle anfallen. Dabei handelt es sich vor allem um Betonabbruch, Stahl, Belagsaufbruch und Ausbauasphalt.
Die grundsätzlichen Entsorgungs- resp. Verwertungswege der wichtigsten Materialkategorien sind aus der nachfolgenden Tab. 5‑8 ersichtlich.
Tab. 5‑8:Abfallarten und Entsorgungs-/Verwertungswege nach VVEA (2015)
|
Materialkategorie |
LVA-Code |
||
|
Boden |
unbelastet |
17 05 04 |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ A |
|
schwach belastet |
17 05 93 |
vor Ort verwerten oder auf ähnlich belastete Böden auftragen, sonst Deponie Typ B |
|
|
wenig belastet |
17 05 96 ak |
Deponie Typ B |
|
|
Aushub- und Ausbruchmaterial |
unverschmutzt |
17 05 06 |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ A |
|
schwach verschmutzt |
17 05 94 |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ B |
|
|
wenig verschmutzt |
17 05 97 ak |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ B |
|
|
Ausbauasphalt |
PAK < 250 mg/kg |
17 03 02 |
Belagsrecycling/Verwertung. Falls nicht möglich: Deponie Typ B |
|
PAK > 250 mg/kg |
17 03 01 ak |
Thermische Behandlung |
|
|
Betonabbruch |
unverschmutzt / schwach verschmutzt |
17 01 01 |
Betonrecycling / Verwertung als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen. Falls nicht möglich: Deponie Typ B |
|
Eisen und Stahl |
17 04 15 |
Metallrecycling |
|
Die Abfälle werden gemäss BAFU (2020a) möglichst sortenrein getrennt, um die umweltverträgliche Verwertung / Entsorgung der Abfälle und Rückbaumaterialien sowie die Qualität der Recyclingbaustoffe zu gewährleisten. Die Verwertungs- / Entsorgungswege werden auf Basis der Schadstoffbelastungen bestimmt und gemäss der obigen Tabelle (vgl. Tab. 5‑8) gewählt. Wo nötig werden dazu entsprechende Untersuchungen durchgeführt.
Ein detailliertes Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept wird für den UVB 2. Stufe ausgearbeitet, in welchem die Arten, Mengen und Qualitäten des anfallenden Materials aufgezeigt werden.
Wird während der Bauarbeiten (Bauphase) unerwartet chemisch oder mit Fremdstoffen belastetes Aushubmaterial angetroffen, wird das betroffene Material separat zwischengelagert, durch eine Altlastenfachperson begutachtet und bei Bedarf beprobt, um den Entsorgungsweg zu definieren.
Allfällige projektbezogene Deponien (d.h. für die Ablagerung von Material aus dem vorliegenden Projekt extra geschaffene Deponien) für nicht wiederverwertbares Material können Auswirkungen auf alle Umweltbereiche haben. Da die Lage und Grösse von allfälligen solchen Deponien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind, werden die Umweltauswirkungen in Übereinstimmung mit Art. 49 Abs. 5 KEG erst im UVB 2. Stufe beschrieben (oder allenfalls in separaten deponiebezogenen UVB).
Während der Betriebsphase sind Abfälle zu erwarten, die mit dem Betrieb des Tiefenlagers zusammenhängen, wie z.B. Verbrauchs- und Verpackungsmaterialien, sowie herkömmliche Haus- und Betriebsabfälle (vgl. Kap. 4.3). Grundsätzlich werden die anfallenden Abfälle sortenrein in geeigneten Behältnissen gesammelt und gemäss den geltenden Vorgaben verwertet (allenfalls mit vorgängiger Aufbereitung) resp. entsorgt. Aufgrund bisher noch nicht definierter Betriebsabläufe kann ein detailliertes Entsorgungs- und Materialbewirtschaftungskonzept mit Angaben zu Qualitäten, Mengen und Entsorgungswegen der Abfallmaterialien erst für UVB 2. Stufe erstellt werden.
Während der Bauphase fallen diverse Abfälle an, insbesondere Aushub- und Ausbruchmaterial sowie Bodenabtrag (vgl. Kap. 4.3). Ein Teil des anfallenden unverschmutzten Aushub- und Ausbruchmaterials soll nach Möglichkeit für den Bau der OFA resp. die Geländemodellierung verwendet werden (vgl. Kap. 4.3.1). Für das verbleibende abzutransportierende Material wird im Sinne der Kreislaufwirtschaft eine projektexterne Verwertung angestrebt, entsprechend der Möglichkeiten nach Art. 19 Abs. 1 VVEA. Eine Ablagerung auf einer Deponie ist zu vermeiden. Bodenmaterial muss intern oder extern als Boden verwertet werden (vgl. Kap. 5.9.5.1). Ein detailliertes Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept für die Bauphase wird für den UVB 2. Stufe ausgearbeitet.
Die Abfallbewirtschaftung während des Betriebs wird für den UVB 2. Stufe abgeschätzt. Während der Betriebsphase sind vor allem Verbrauchs- und Verpackungsmaterialien sowie Hausabfälle zu erwarten, welche dem Recycling zugeführt werden sollen.
Während der Rückbau- und Verschlussphase (Phase 9) entstehen Bauabfälle durch den Rückbau von Bauten und Anlagen, welche nach den dann (in rund 100 Jahren) geltenden Richtlinien und Vorschriften dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden sollen. Ein Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept für den Rückbau der OFA und den Verschluss des gTL könnte im Rahmen des Stilllegungsgesuchs ausgearbeitet werden (vgl. Kap. 3.5).
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Abfall und umweltgefährdende Stoffe» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Abf 01 |
Erstellung Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept (Bau und Rückbau) Die projektbedingt anfallenden Abfallmengen (Boden, Aushub, Ausbruch, Strassenaufbruch, Ausbauasphalt, Betonabbruch etc.) werden ermittelt und die grundsätzlichen Verwertungs- resp. Entsorgungswege inkl. Transportmittel definiert. Dabei wird die Materialqualität sowie die projektbedingte Belastung des Materials berücksichtigt und soweit technisch und projektbedingt sinnvoll und machbar, vermieden. |
Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008, Stand 1. September 2024, SR 814.911 (Freisetzungsverordnung, FrSV)
Richtlinie Grünräume an Nationalstrassen: Gestaltung und Betrieblicher Unterhalt, V1.10 (ASTRA 2015)
Liste der invasiven und potenziell invasiven Neophyten der Schweiz, Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora (Info Flora 2021)
Merkblätter zu den einzelnen Neophytenarten, Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora (Info Flora 2024)
Umgang mit abgetragenem Boden, der mit invasiven gebietsfremden Pflanzen nach Anhang 2 FrSV belastet ist. Empfehlung der AGIN für den Vollzug von Art 15. Abs. 3 FrSV. Version 2.0 (Cercle Exotique 2016)
Invasive Neophyten im Kanton Zürich, Praxishilfe, Testversion 2022. Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL (Baudirektion Kanton ZH 2022a)
GIS des Kantons Zürich: Neophytenverbreitung (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU2 UgO 01 |
Erhebung der Neophyten-Vorkommen Abklären der vor Ort vorhandenen Standorte mit Vorkommen von invasiven Neophyten mittels Feldaufnahmen vor Baubeginn. |
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Berücksichtigung der Anträge
Im UVB 1. Stufe wurde eine Ersterhebung der Neophytenvorkommen durchgeführt, welche vor Baubeginn aktualisiert wird. Die Definition von Schutzmassnahmen und die Auswahl der Pflanzenarten, welche für die Arealbegrünung verwendet werden, erfolgt im UVB 2. Stufe. Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wurde entsprechend ergänzt.
Unter umweltgefährdenden Organismen werden entsprechend der Umweltschutzgesetzgebung Neobiota (hier v.a. sog. invasive Neophyten) sowie pathogene und gentechnisch veränderte Organismen verstanden.
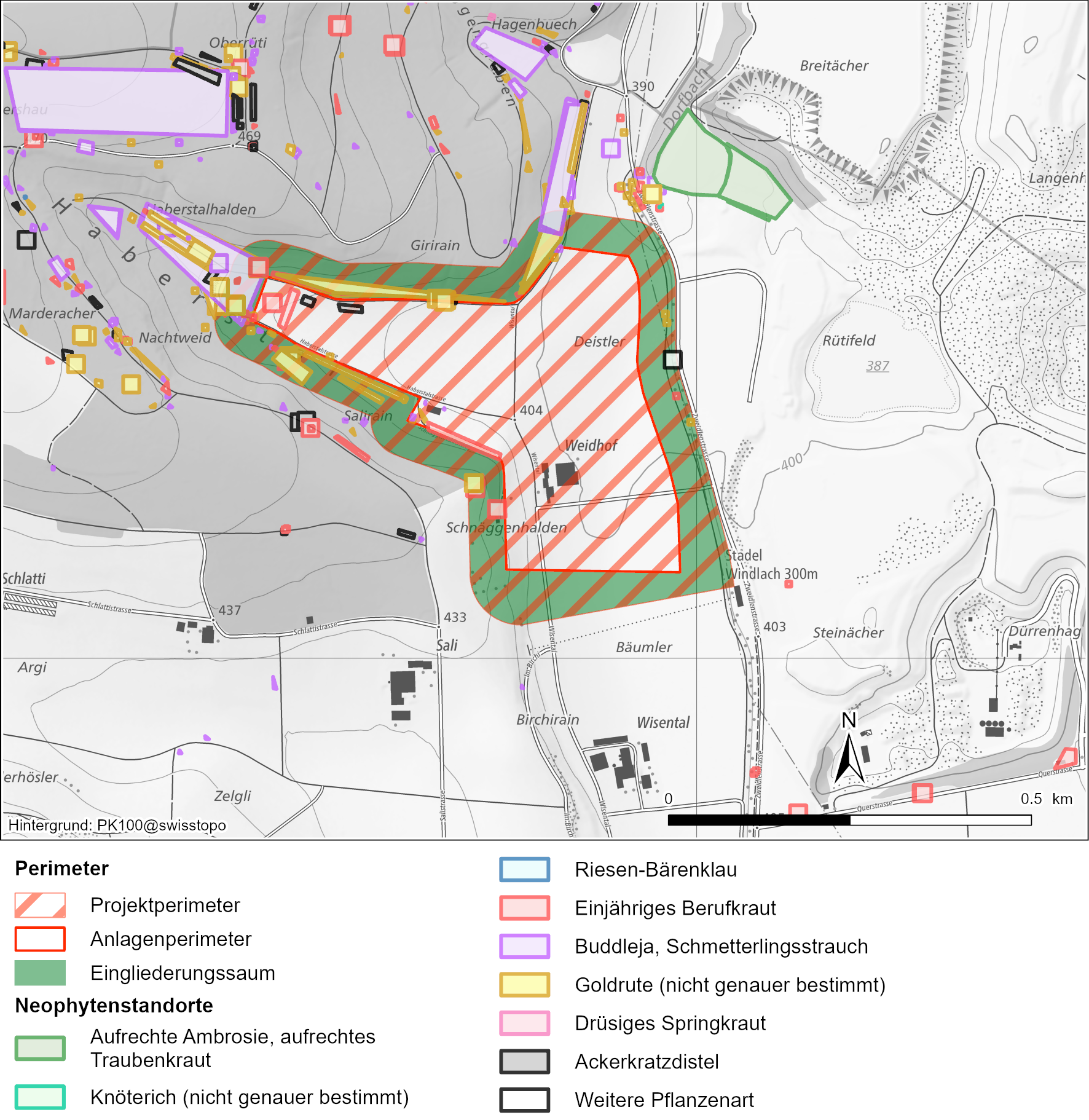
Fig. 5‑14:Vorkommen von invasiven Neophyten und landwirtschaftliche Problempflanzen im und um den Projektperimeter im Haberstal (GIS-ZH 2024)
Gemäss Geoportal des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024) sind im Projektperimeter Vorkommen von invasiven Neophyten nach Kriterien der Freisetzungsverordnung (FrSV 2008) bekannt. Es handelt sich dabei vor allem entlang des Waldrands um Vorkommen der Goldrute und des Einjährigen Berufkrauts. Entlang des Dorfbachs und der Zweidlenstrasse sind Vorkommen von Goldruten und des Einjährigen Berufkrauts aufgeführt. Im Wald im Bereich des Haberstalgrabens sind grössere Vorkommen des Sommerflieders ausgewiesen (vgl. Fig. 5‑14).
Im Zuge der Lebensraumkartierung (vgl. Kap. 5.16.4) wurden die Goldrutenbestände entlang des Waldrands Girirain im Haberstal sowie die Sommerfliederbestände im Wald beim Haberstalgraben bestätigt (vgl. Beilage A5). Zusätzlich wurden im Wald entlang des offen fliessenden Haberstalgrabens vereinzelte Goldrutenbestände gefunden.
In der Tab. 5‑9 sind alle in der Umgebung des Projektperimeters vorkommenden invasiven Neophyten, deren Verbreitung und Status aufgelistet.
Tab. 5‑9:Artenliste der in der Umgebung des Projektperimeters angetroffenen Neophyten
|
Artenname |
Verbreitung |
Vorkommen im Projektperimeter | |
|---|---|---|---|
|
Amerikanische Goldrute (Solidago spp.) |
Flugsamen und unterirdische Ausläufer (Rhizome) |
Invasiv |
Eingliederungssaum |
|
Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) |
Samen |
Invasiv |
Anlagenperimetr und Eingliederungssaum |
|
Sommerflieder (Buddleja davidii) |
primär Flugsamen, Wurzelausläufer |
Invasiv |
Einliederungssaum |
Bau
Während der Phasen 1 und 3 werden bei der Einrichtung des Eingliederungssaums Bestände von invasiven Neophyten entlang des Waldrands im Haberstal, im Wald entlang des Haberstalgrabens sowie entlang der Zweidlenstrasse und des Dorfbachs tangiert. Für die Arealzufahrten über den Dorfbach, welche in der Phase 1 erstellt werden, sind für die Fundamente der Brücken Bodenarbeiten nötig (vgl. Kap. 4.4.1). Die entsprechenden Flächen/Böden innerhalb des Eingliederungssaums gelten aufgrund der vorgefundenen invasiven Neophyten als biologisch belastet und müssen entsprechend der biologischen Bodenqualität entsorgt resp. verwertet werden (vgl. Kap. 5.9.5.1).
Für UVB 2. Stufe erfolgt eine Aktualisierung der Neophytenerhebung im Projektperimeter, sodass die für die Bauphase aktuellen Bestände bekannt sind. Die Neophytenvorkommen werden zu Beginn der Phase 1 mittels gezielter Bekämpfungsmassnahmen fachkundig entfernt, bevor die Installationen in der Phase 1 erstellt werden. Die Bekämpfungsmassnahmen sowie die Entsorgung des Pflanzenmaterials der vorgefundenen invasiven Neophyten im Anlagenperimeter werden gemäss den Empfehlungen der Info Flora (2024) ausgeführt.
Während der Phase 1 ist aufgrund der Boden- und Aushubarbeiten in einem Grossteil des Anlagenperimeters und im Eingliederungssaums das Risiko für eine Verschleppung von invasiven Neophyten durch Baustellentransporte und Baumaschinen am grössten. Längerfristig brachliegenden Flächen wie neu angelegten Böden, Bodenzwischenlagerflächen sowie Installations- und Materiallagerplätze müssen unmittelbar nach der Erstellung begrünt resp. befestigt werden, damit sie nicht von projektbedingt eingeschleppten oder auf anderem Weg eingetragenen Neophyten besiedelt werden.
Der Eingliederungssaum soll direkt nach der Auslichtung begrünt und während der Bauphase überwacht werden, um einen Neophytenbefall dieser lichten Fläche zu verhindern oder umgehend bekämpfen zu können. Die Bekämpfungsart und -methoden werden gemäss den Empfehlungen der der Info Flora (2024) ausgeführt. Für die Wiederverwertung des Bodenmaterials werden die gesetzlichen Grundlagen entsprechend Art. 7 Abs. 2 VBBo und Art. 15 FrSV berücksichtigt.
Vor Baubeginn erfolgt eine Aktualisierung der Neophytenerhebung, sodass die für die Bauphase aktuellen Bestände bekannt sind und gezielte Bekämpfungsmassnahmen ergriffen werden können.
Rückbau
Für den Rückbau (Phase 9) wird davon ausgegangen, dass die verbleibenden Grünflächen im Anlagenperimeter während der Betriebsphase regelmässig gepflegt werden. Vor Ausführung der Rückbautätigkeiten werden die aktuellen Bestände nochmals neu aufgenommen und ggf. Bekämpfungsmassnahmen ergriffen.
Nach dem Verschluss des Gesamtlagers und dem Rückbau der OFA ist die Nachnutzung des Eingliederungssaums noch offen. Die Bekämpfung der invasiven Neophyten im Eingliederungssaum wird auch während dem Rückbau durch den ordentlichen Unterhalt sichergestellt.
Während der Betriebsphase wird das Aufkommen von invasiven Neophyten durch regelmässige Kontrollen und bedarfsweise Bekämpfung verhindert.
Das Vorgehen zum Monitoring und zur Bekämpfung der invasiven Neophyten in der Betriebsphase wird für den UVB 2. Stufe festgelegt.
Im Projektperimeter befinden sich heute in der Schweiz häufig vorkommende invasive Neophyten, welche durch das Vorhaben tangiert werden. Unter Einhaltung der oben genannten Vorgaben mit regelmässigen Kontrollen sowie bei Bedarf durch Bekämpfung kann eine Verbreitung von invasiven Neophyten im Projektperimeter während der Bauphase wirksam verhindert werden. Im UVB 2. Stufe werden für die Bauphase weitere Massnahmen und Entsorgungswege definiert.
Während des Betriebs liegt der Fokus vor allem auf der Kontrolle von neu erstellten Grünflächen in den ersten fünf Jahren nach der Erstellung.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «umweltgefährdende Organismen» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 UgO 01 |
Erhebung der Neophytenbestände Die Neophytenbestände werden erhoben. |
|
PH-HU2 UgO 02 |
Verhinderung der Neophyten-Verbreitung in der Bauphase Es werden Massnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung ausgearbeitet. Bekämpfungsmassnahmen und Entsorgungswege werden definiert. |
|
PH-HU2 UgO 03 |
Umgang mit Neophyten in der Betriebsphase Massnahmen zu Monitoring, Bekämpfung und Unterhalt von neu erstellten Flächen werden ausgearbeitet. |
Im vorliegenden Kapitel werden lediglich nicht-nukleare Störfälle gemäss Art. 1 resp. Anhang 1.1 Störfallverordnung (StFV 1991) beurteilt. Angaben zur generischen Sicherheitsbetrachtung für das gTL bzw. zu den sog. Einwirkungen von Innen sind im Sicherheitsbericht (Nagra 2025d) zu finden.
Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, Stand 1. Juli 2024, SR 814.012 (Störfallverordnung, StFV)
Verordnung über die Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Strasse vom 29. November 2002, Stand 1. Januar 2023, SR 741.621 (SDR)
Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 30. September 1957, Stand 19. Juni 2019, SR 0.741.621 (ADR)
Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen vom 18. Oktober 2005, Stand 1. Januar 2018, SR 814.610.1 (UVEK 2005)
Verordnung über explosionsgefährliche Stoffe vom 27. November 2000, Stand 1. Januar 2024, SR 941.411(Sprengstoffverordnung, SprstV)
Richtlinie «Sicherheitsmassnahmen gemäss Störfallverordnung bei Nationalstrassen». V2.10 (ASTRA 19001; ASTRA 2008)
Mengenschwellen gemäss Störfallverordnung (StFV), Ein Modul des Handbuchs zur Störfallverordnung. Umwelt-Vollzug Nr. 0611 (BAFU 2024c)
Handbuch I zur Störfallverordnung (StFV). Allgemeiner Teil. Umwelt-Vollzug Nr. 1807 (BAFU 2018b)
Beurteilungskriterien zur Störfallverordnung (StFV). Ein Modul des Handbuchs zur Störfallverordnung (StFV), Umwelt-Vollzug Nr. 1807 (BAFU 2018a)
Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe, 3. überarbeitete Auflage 2018, Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018)
GIS des Kantons Zürich: Risikokataster (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 StF 01 |
Beurteilung Störfallsituation Beschreibung und Beurteilung der Projektbestandteile bezüglich Einordnung in die Störfallverordnung. |
|
PH-HU1 StF 02 |
Beurteilung Konsultationsbereiche Beschreibung und Beurteilung der tangierten Konsultationsbereiche und Vorgaben für die Koordination mit der Raumplanung. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands konnten noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Störfallvorsorge / Katastrophenschutz» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 StF 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wir daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Berücksichtigung der Anträge
Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt (vgl. Kap. 4.4.3).
Die Anträge des BAFU werden im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
Rund 300 m südlich des Anlagenperimeters verläuft gemäss Risikokataster des Kantons Zürich eine Erdgashochdruckleitung in Ost-West-Richtung (vgl. Fig. 5‑15). Der Konsultationsbereich der Leitung verläuft nahe jedoch ausserhalb des Anlagenperimeters, der Eingliederungssaum dagegen tangiert den Konsultationsbereich randlich. Es sind keine weiteren störfallrelevanten Anlagen, welche der Störfallverordnung (StFV 1991) unterstehen, in der Umgebung der OFA vorhanden.
Der Anlagenperimeter befindet sich ausserhalb der Bauzone in einem dünn besiedelten Gebiet und der aktuell innerhalb des Projektperimeters vorhandene Weidhof wird bereits vor Baustart rückgebaut sein (vgl. Kap. 3.5.2). Entsprechend befindet sich das nächste bewohnte Gebäude (Salihof) in ca. 120 m Entfernung südlich des Anlagenperimeters. Die Bürogebäude der Kiesgrube Rütifeld sind bzgl. Störfälle ebenfalls zu berücksichtigen, befinden sich jedoch in einer Distanz von 600 m zum Anlagenperimeter. Bei der Zweidlenstrasse handelt es sich um eine wenig befahrene Nebenstrasse (vgl. Kap. 4.4.1). Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Personenrisiko in der Umgebung im Ausgangszustand eher gering ist.
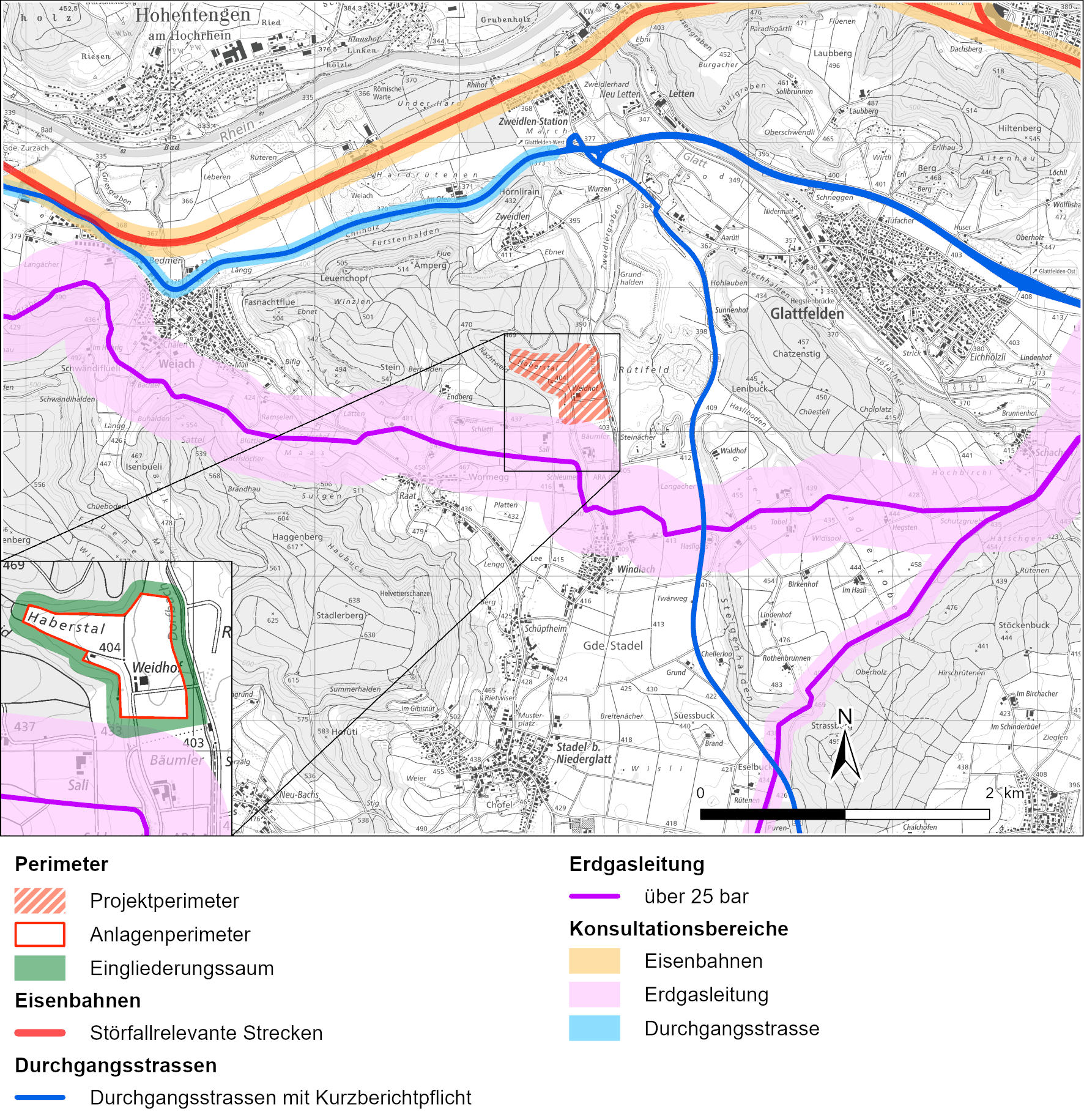
Fig. 5‑15:Auszug aus dem Risikokataster chemische und biologische Risiken des Kantons Zürich (GIS-ZH 2024)
Bau
Der Anlagenperimeter tangiert die vorhandene Erdgashochdruckleitung resp. dessen Konsultationsbereich nicht. Im Eingliederungssaum, der randlich den Konsultationsbereich tangiert, sind keine Bauten und Anlagen geplant. Daher ist keine Koordination mit der Raumplanung (Nagra 2025a) nach Art. 11a StFV nötig.
Welche Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter erstellt werden, wird für das Baugesuch definiert. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf dem Baustellengelände eine Tankanlage (Benzin/Diesel) installiert wird. Die Mengenschwellen gemäss Anhang 1.1 StFV liegen bei Benzin/Diesel bei 200'000 kg bzw. 500'000 kg.
Aufgrund des geschätzten Bedarfs an Beton (vgl. Kap. 4.3.3) ist es zudem möglich, dass ein temporäres Betonwerk (ober- und untertage) erstellt wird. Üblicherweise fallen Betonwerke nur unter die StFV, wenn sie Bindemittel und Zusatzstoffe über deren Mengenschwelle benötigen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Anlagenperimeter im konventionellen Sinne störfallrelevant ist.
Allenfalls ist aufgrund der gewählten Vortriebsmethoden (ggf. Sprengvortrieb, vgl. Kap. 4.2.4) innerhalb der Baustelle ein Sprengmittellager notwendig. Die Vortriebsmethoden sowie die dafür benötigten Spreng-/Zusatzstoffe werden im Rahmen des Baugesuchs definiert. Für den UVB 2. Stufe werden aufgrund der gelagerten Stoffe und deren Höchstmengen die Gefahrenkategorien nach ermittelt und die Anforderungen für eine fachgerechte Lagerung dieser Stoffe gemäss Sprengstoffverordnung (SprstV 2000) definiert.
Aus Störfallsicht sind während der Bauphase primär die Umweltrisiken «Grundwasser» (vgl. Kap. 5.6) und «Oberflächengewässer» (vgl. Kap. 5.7) relevant, wofür in der künftigen Projektierung (UVB 2. Stufe) entsprechende Sicherheits- und Schutzmassnahmen zu planen sind (z.B. bzgl. Entwässerung; vgl. Kap. 5.8). Die Richtlinien zur Lagerung und zum Umschlag gefährlicher Stoffe sind dabei einzuhalten (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018). Gefahrenstoffe sind entsprechend der Vorgaben ihrer Lagerklasse räumlich getrennt und beispielsweise in Auffangwannen, sicheren Lagerbehältern und/oder in abschliessbaren Containern zu lagern. Die Gefahrenstoffe sind mit ihren Gefahrensymbolen nach Chemikalienverordnung (ChemV 2015) klar zu kennzeichnen.
Für den UVB 2. Stufe sind die verwendeten Gefahrenstoffe und deren maximal gelagerte Menge zu ermitteln und die entsprechenden Schutzmassnahmen zu planen. Falls Mengenschwellen gemäss Anhang 1.1 StFV überschritten werden, wird im Rahmen des UVB 2. Stufe ein entsprechender Kurzbericht gemäss StFV erstellt (Ausmasseinschätzung, Beurteilung Personenrisiken/Gewässerrisiken).
Rückbau
In der Rückbauphase sind die störfallrelevanten Risiken abhängig von den dann verwendeten Gefahrenstoffen. Entsprechende Sicherheitsmassnahmen und Entsorgungswege werden für den UVB 2. Stufe ermittelt.
Als Anlage, die der Kernenergie- und Strahlenschutzgesetzgebung unterstellt ist, unterliegt das gTL gemäss Art. 1 Abs. 4 StFV bezüglich Umgang mit radioaktiven Materialien nicht der StFV. Der Katastrophenschutz bzw. die Folgen eines kerntechnisch-bedingten Störfalls werden daher im Rahmen des UVB nicht behandelt.
In der Betriebsphase benötigt das gTL voraussichtlich verschiedene Gefahrstoffe als Betriebsmittel. Es kann davon ausgegangen werden, dass keine Gefahrstoffe und Zubereitungen in Mengen über den Mengenschwellen nach Anhang 1.1 StFV im Projektperimeter gelagert oder verwendet werden. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu verifizieren. Bei Bedarf wird ein Kurzbericht nach StFV erstellt.
Während der Bau-, Betriebs- und Rückbauphase werden möglicherweise (konventionelle) Gefahrenstoffe gelagert und umgeschlagen, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Mengenschwellen gemäss StFV nicht überschritten werden. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu verifizieren. Sollten während der Bau-, Betriebs oder Rückbauphase nach StFV relevante Mengen Gefahrenstoffe im Anlagenperimeter zwischengelagert werden, ist für den UVB 2. Stufe ein Kurzbericht nach StFV zu erstellen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Störfallvorsorge / Katastrophenschutz» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 StF 01 |
Beurteilung Störfallsituation (Bau-, Rückbau- und Betriebsphase) Beschreibung und Beurteilung der Störfallsituation im Projektperimeter bzgl. Gefahrenstoffen und Mengenschwellen. Bei Bedarf wird ein Kurzbericht nach StFV erstellt. |
-
Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991, Stand 1. Januar 2022, SR 721.100 (Waldgesetz, WaG)
-
Verordnung über den Wald vom 30. November 1992, Stand 1. Juli 2021, SR 921.01 (Waldverordnung, WaV)
-
Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz – Voraussetzungen zur Zweckentfremdung von Waldareal und Regelung des Ersatzes. Umweltvollzug Nr. 1407 (BAFU 2014)
-
Kantonales Waldgesetz vom 7. Juni 1998, Stand 1. Januar 2018, LS 921.1 (KWaG)
-
Kantonale Waldverordnung vom 28. Oktober 1998, Stand 1. Januar 2023, LS 921.11 (KWaV)
-
Planungs- und Baugesetz, Kanton Zürich, 7. September 1975, Stand 1. April 2024, LS 700.1. (PBG)
-
Waldentwicklungsplanung Kanton Zürich 2010, Abteilung Wald (ALN Kanton ZH 2010)
-
Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz, Schweizerische Anstalt für das forstliche Versuchswesen: Vol. 48/4 (Ellenberg, H., Klötzli, F. 1972)
-
Lebensräume der Schweiz, Ökologie – Gefährdung – Kennarten, 3. vollständig überarbeitete Auflage (Delarze et al. 2015)
- GIS des Kantons Zürich: Kartierung Waldstandorte / seltene Gesellschaften, Entwicklungsplan (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 Wal 01 |
Ermittlung der Rodungsflächen und der Wiederbewaldungs- und Ersatzaufforstungsflächen (und evtl. Rodungsgesuch) Die projektbedingt zu rodenden Waldflächen sowie die Flächen, welche (wieder) mit Wald bestockt werden sollen, werden so genau wie möglich ermittelt und dargestellt. Falls genügend genaue Angaben vorliegen, wird ein Rodungsgesuch erarbeitet. |
|
PH-HU1 Wal 02 |
Waldabstandsbereich Festlegen der Waldgrenzen und definieren des Waldabstandsbereichs zu den OFA. |
|
PH-HU1 Wal 03 |
Sicherheitsperimeter Abklären, ob der Waldabstandsbereich vergrössert werden muss, um den Sicherheitsperimeter zwischen Wald und Sicherheitszaun einhalten zu können. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Wald» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Wal 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 den folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 den folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich hat in seiner Stellungnahme vom 19. Januar 2023 den folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.1):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgende ergänzende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
überprüfen, die effektiv zu rodende Fläche zu minimieren und die Notwendigkeit für eine allfällige Rodung zu begründen. Dies betrifft insbesondere den 50 m breiten «Eingliederungssaum» mit dem 30 m breiten «Freihaltestreifen» und den daran anschliessenden, ca. 20 m breiten stufigen Waldrand. Sollte die Umzäunung des Anlagenperimeters zudem direkt an das Waldareal angrenzen, ergibt sich bereits daraus die Notwendigkeit einer Rodung. Dies ist ebenfalls zu beachten.
Berücksichtigung der Anträge
-
Der Antrag 10 der KOBU wird teilweise im UVB 1. Stufe abgehandelt, in welchem der Flächenbedarf (Eingliederungssaum) festgelegt und mittels einer Lebensraumkartierung die Lebensräume definiert werden (vgl. Kap. 5.16.4). Im UVB 2. Stufe wird die konkrete Umsetzung des Freihaltestreifens definiert und eine Ausnahmebewilligung für eine Waldrodung in diesem Bereich (vgl. Kap. 2.3) beantragt.
-
Der Antrag 3 des AWEL wird im UVB 1. Stufe summarisch bzgl. des maximalen Flächenbedarfs abgehandelt, welcher sich aus der exemplarischen Umsetzung ergibt (beschrieben in Anhang C in Nagra 2025a). Die Abstimmung des exemplarischen Vorhabens mit der Raumplanung sowie die raumplanerische Standortbegründung wird im BAR (Nagra 2025a) dargelegt. Die Notwendigkeit von Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter sowie ihre sicherheitstechnische Anordnung wird im Rahmen des Baugesuchs ermittelt. Entsprechend werden die raumplanerischen Abwägungen im UVB 2. Stufe ausgeführt und aufgezeigt, wie die Auswirkungen auf Natur und Landschaft möglichst geringgehalten werden können.
-
Antrag 7 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Begrifflichkeiten werden im Bericht präzisiert. Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend dem Antrag ergänzt.
-
Antrag 8 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und ins Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe aufgenommen.
Der Haberstal wird auf drei Seiten von Waldflächen des Ämpergs eingeschlossen. Die Waldflächen bestehen aus Laubmischwäldern mit ausgewachsenen Baumbeständen, mit der Rotbuche als weitaus häufigste Baumart. Es handelt sich um für das Mittelland typische, oft vorkommende und nicht um seltene, schützenwerte Waldgesellschaften. Im Rahmen der Felduntersuchungen wurde die vegetationskundliche Kartierung des Kantons Zürich gemäss Geoportal (vgl. Fig. 5‑16 und Beilage A2) bestätigt. Beim Wald um den Haberstal handelt es sich grundsätzlich um einen Waldmeister-Buchenwald mit einem nährstoffreichen Krautsaum.
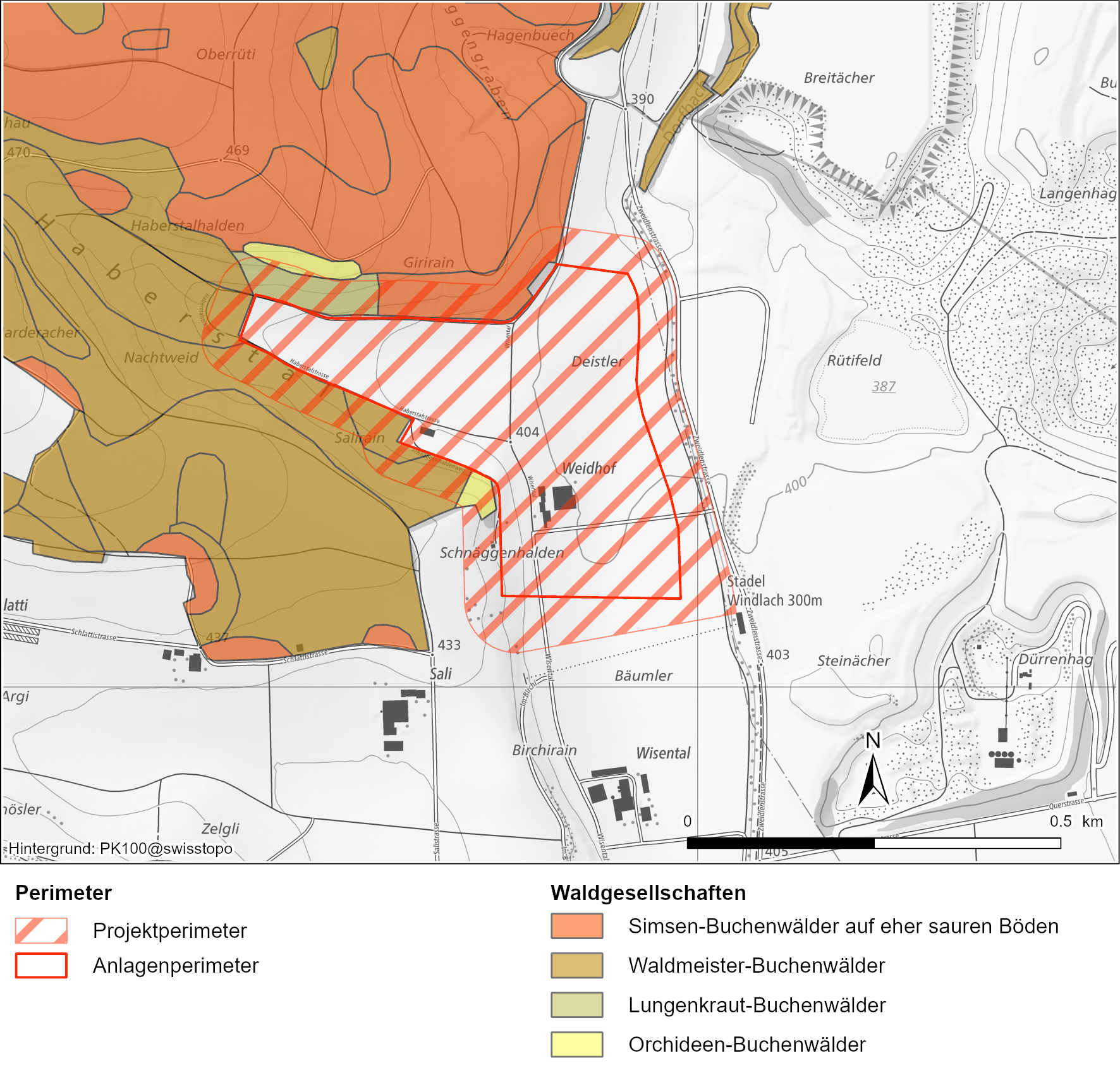
Fig. 5‑16:Vegetationskundliche Kartierung der Wälder im Kanton Zürich (Waldvegetationskarte, GIS-ZH 2024)
Im Süden (Salirain) wird der Wald gemäss kantonaler Waldvegetationskarte (vgl. Fig. 5‑16) von Waldmeister-Buchenwald («typischer Waldmeister-Buchenwald», teils «mit Wald-Ziest» oder «mit Hainsimse») geprägt. Im Waldrandbereichs sind feuchte Stellen vorhanden, in denen die Vegetation durch Wasseraufstösse oder Hangwasser geprägt ist (vgl. Kap. 5.16.4). Gegen Westen grenzt der Haberstal ausschliesslich an «typischen Waldmeister-Buchenwald mit Wald-Ziest». Im Norden sind hauptsächlich Simsen-Buchenwälder auf eher sauren Böden («Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse» und «Typischer Waldhainsimsen-Buchenwald») vertreten. Zuhinterst im Haberstal auf der nordwestlichen Seite sind weitere Waldgesellschaften wie der «Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt» und der «Bergseggen-Buchenwald» (Orchideen-Buchenwald) vorhanden. Weiter nördlich im Bereich des «Girirain» handelt es sich um einen «Waldmeister-Buchenwald mit Hainsimse» (Orchideen-Buchenwald). Die weiteren Wälder auf den umliegenden Anhöhen sind ebenfalls grösstenteils als Waldmeister- oder Simsen-Buchenwälder ausgebildet (vgl. Fig. 5‑16 resp. GIS-ZH 2024). Alle an den Projektperimeter angrenzenden, relevanten Waldflächen befinden sich im Forstrevier Egg-Ost Stadlerberg und sind in Privatbesitz.
Es sind keine als «Standorte von naturkundlicher Bedeutung» bezeichneten Waldflächen in der Umgebung des Projektperimeters ausgeschieden (GIS-ZH 2024). Nächstliegende Waldstreifen mit der Waldschutzzone IV als Schutzverordnung nach PBG (1975) befinden sich entlang der Nord- sowie der Westflanke des Ämperg zwischen der Flue und der Fasnachtflue rund 800 – 1'500 m nordwestlich des Projektperimeters (GIS-ZH 2024).
Abgesehen von den Arealen der Waldschutzzone ist gemäss dem Waldentwicklungsplan Kanton Zürich die Holzproduktion im Wald am Ämperg eine vorrangige Zielsetzung. Der Ämpergwald stellt dabei gleichzeitig einen wenig begangenen Lebensraum dar und besitzt in Teilen der Nord- und der Westflanke den Status «Eichenförderung». Darüber hinaus ist im Ämpergwald auf verschiedenen Abschnitten die Waldrandförderung (stufiger Waldrand, vgl. Fig. 4‑4 standortgerechte Gehölze) vorgesehen, insbesondere an den südlichen Waldrändern bei Weiach und Raat.
Standort und Projektperimeter sind das Ergebnis einer umfangreichen Interessenabwägung im Rahmen des Sachplanverfahrens. Die für die Waldbeanspruchung notwendige raumplanerische Standortbegründung und die Herleitung der Interessenabwägung sind in den Kap. 2 resp. 4 des BAR (Nagra 2025a) zu finden und werden vom ARE begutachtet.
Bau
Der Anlagenperimeter liegt ausserhalb der Waldflächen. Die geringe Breite des Taleinschnitts Haberstal schränkt die Möglichkeiten zur Bebauung ein. Bauten und Anlagen mit Relevanz für die Sicherheit und Sicherung müssen vermutlich so angeordnet werden, dass mindestens stellenweise der kantonal vorgeschriebene Waldabstand unterschritten wird.
Im Bereich des Eingliederungssaums um den Haberstal wird Wald im Sinne des Waldgesetzes (WaG 1991) tangiert. Um die Sicherung und Sicherheit des Anlagenperimeters zu gewährleisten, wird im Eingliederungssaum um den Haberstal ein max. 30 m breiter gehölzfreier Freihaltestreifen notwendig. Im waldrechtlichen Sinne handelt es sich bei einem solchen Freihaltestreifen um eine definitive Rodung gemäss Art. 5 WaG, wofür Rodungsersatz nach Art. 7 WaG zu leisten ist. Die Notwendigkeit dieser Rodung muss begründet werden (vgl. unten).
Angrenzend an den Freihaltestreifen soll aus waldbaulichen Gründen wieder ein gestufter Waldrand erstellt werden (waldpflegerische Massnahme). Er besteht aus einem ca. 20 m breiten Streifen (vgl. Fig. 4‑3), welcher von einer Strauchschicht in einen lockeren Wald übergeht (vgl. Fig. 4‑4). Gegenüber dem heutigen Waldrand, der nur wenig gestuft ist, wird dieser Bereich der Waldfläche daher ökologisch aufgewertet (vgl. Kap. 5.16.5.1). Begründung für die Rodung (Freihaltung) und Unterschreitung des Waldabstands.
Begründung für die Rodung (Freihaltung) und Unterschreitung des Waldabstands
-
Rodung (Freihaltung): Eine Kernanlage ist gemäss den Vorgaben von Art. 8 Abs. 3 KEV und Art. 5 Abs. 1 UVEK gegen Einwirkungen von aussen, zu denen Waldbrand oder Windwurf gehören, zu schützen. Gemäss den Vorgaben des ENSI an den Brandschutz ist eine Kernanlage so auszulegen, dass die Entstehung von Bränden vorgebeugt wird und die Ausbreitung eines Brands reduziert wird (ENSI 2024). Mit einem gehölzfreien, brandlastbegrenzten Freihaltestreifen angrenzend an die Kernanlage können die potenziellen Auswirkungen eines Waldbrands auf die Anlageteile reduziert und somit ein Übergreifen eines Waldbrands auf den Anlagenperimeter verhindert werden (Kap. 3.3 in Nagra 2025d). Ein Freihaltestreifen ist auch aus Gründen der Sicherung des Anlagenperimeters als vorteilhaft einzustufen. Zur Sicherung einer Kernanlage wird die Einsehbarkeit der Umgebung von der Anlage aus gefordert (Kap. 6 in Nagra 2025c). Die Sicherungsmassnahme zielt darauf ab, die nukleare Sicherheit gegen unbefugte Einwirkungen zu gewährleisten. Potenzielle Täter sollen von ihrem Vorhaben abgeschreckt und bei einem Angriff erkannt werden (UVEK 2007, UVEK 2008).
-
Unterschreitung der Waldabstände: Weil die Lage der einzelnen Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter mit den Arbeiten zum Baugesuch definiert wird und die Waldgrenze noch nicht festgelegt ist, kann der Abstand zum Wald noch nicht bestimmt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass der in § 262 PBG kantonal vorgeschriebene Waldabstand von 30 m stellenweise unterschritten wird.
Gemäss § 66 Abs. 1 und § 262 Abs. 1 PBG (1975) gilt für Gebäude ein Waldabstand von 30 m. Aus wichtigen Gründen können die zuständigen Behörden die Unterschreitung des Mindestabstands unter Auflagen und Bedingungen bewilligen (Art. 17 Abs. 3 WaG). Für den UVB 2. Stufe sind Begründungen für allfällige Waldabstandsunterschreitungen beizubringen. Weiter sind Massnahmen zum Schutz des Waldrands zu definieren.
Die effektive Ausgestaltung und Pflege des Eingliederungssaums muss sich an der Anordnung und Grösse der Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter orientieren. Diese wird im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG festgelegt.
Aus verfahrenstechnischer Sicht ist es notwendig, dem RBG einen abdeckenden Fall zu Grunde zu legen. Wird der max. 30 m breite gehölzfreie Freihaltestreife vollumfänglich in Anspruch genommen, ergibt sich für die Freihaltung eine maximal zu rodende Fläche von ca. 3.0 ha Wald (vgl. Tab. 4‑1). Der Waldboden wird in diesem Bereich nicht zweckentfremdet und vor Ort belassen. Eine Wertholzproduktion ist allerdings über die Dauer des Vorhabens nicht möglich. Im Bereich des abgestuften Waldrands (20 m breiter Streifen, ca. 2.1 ha, vgl. Tab. 4‑1) ist die Wertholzproduktion aufgrund der ökologischen Aufwertungen mit Einschränkungen möglich.
Für das Baugesuch wird die tatsächlich benötigte Fläche für eine Rodung (Freihaltestreifen) aufgrund der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben bestimmt. Das Vorhaben wird so entwickelt, dass die tatsächlich zu rodende Breite des Freihaltestreifens nur so gross wie nötig ist, max. 30 m.
Der Anlagenperimeter wird voraussichtlich stellenweise bis an die Grenzen ausgenutzt, was eine Unterschreitung des Waldabstandes zur Folge haben kann, wenn der Streifen an diesen Stellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Sicherung nicht 30 m breit sein muss.
Unter Beizug des zuständigen Kreisförsters wird in diesem Prozess die korrekte waldrechtliche Handhabung der gesamten beanspruchten Waldfläche im Eingliederungssaum definitiv festgelegt (Rodung (Freihaltung), nachteilige Nutzung von Wald und Waldabstandsunterschreitungen) und die effektive Ausgestaltung und Pflege definiert. Für die waldbauliche Ausgestaltung (Pflegeeingriffe) werden die Grundeigentümer miteinbezogen.
Mit dem Baugesuch wird ein Rodungsgesuch für die definitive Rodung eingereicht, Ersatzflächen bezeichnet und im UVB 2. Stufe eine Begründung für die Notwendigkeit dieser Rodung vorgelegt. Für die Waldabstandsunterschreitungen wird im Baugesuch ggf. eine Ausnahmebewilligung beantragt (vgl. Kap. 2.3) und im UVB 2. Stufe eine Begründung dafür beigebracht.
Rückbau
Nach dem Verschluss des Gesamtlagers und dem Rückbau der OFA ist die Nachnutzung des Eingliederungssaums noch offen und zu gegebener Zeit mit den zuständigen Behörden und Grundeigentümer abzustimmen. Durch realisierte Ersatzmassnahmen (vgl. Kap. 5.13.5) in diesem Bereich werden voraussichtlich neue Lebensräume geschaffen und eine Rückführung in einen Hochwald ist vermutlich nicht möglich, ohne diese neuen Lebensräume zu beeinträchtigen. Der ökologische Zustand bzw. Wert der Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum ist daher entscheidend für die Nachnutzung (vgl. Kap. 5.16.5.1).
Während der Betriebsphase werden keine zusätzlichen Waldstandorte tangiert.
Die Waldbewirtschaftung und der Unterhalt des Freihaltestreifen im Eingliederungssaum werden mit dem zuständigen Kreisförster resp. den jeweiligen Grundeigentümern koordiniert.
Für die Realisierung des Vorhabens muss aus Sicherheits- und Sicherungsgründen zur Herstellung des 30 m breiten, an den Anlagenperimeter angrenzenden Freihaltestreifens gegebenenfalls 3.0 ha Wald gerodet werden. Die genaue Fläche der definitiven Rodung wird in der weiteren Planung nach Vorgaben der Arealsicherung resp. -sicherheit und unter Beizug des zuständigen Kreisförsters definiert. Für die tatsächliche Rodungsfläche wird ein Rodungsersatz nach Art. 7 WaG geleistet. Für das Baugesuch sind Ersatzaufforstungen festzulegen und ein Rodunsgesuch zu erarbeiten. Für die waldbauliche Ausgestaltung des gestuften Waldrands im Eingliederungssaum werden die Grundeigentümer miteinbezogen. Der Teil des Eingliederungssaums, der im waldrechtlichen Sinne Wald bleibt, wird gegenüber dem Nicht-Waldareal mit geeigneten Abschrankungen geschützt (vgl. Kap. 5.16.5.1). Für allfällige Unterschreitungen des Waldabstands ist im Baubewilligungsverfahren eine forstrechtliche Ausnahmebewilligung erforderlich.
Die Voraussetzungen (Interessenabwägung, raumplanerische Standortbegründung) für die erforderlichen Ausnahmenbewilligungen der Waldbeanspruchung sind gemäss den oben genannten Begründungen gegeben. Detaillierte raumplanerische Darlegungen sind zudem in Kap. 6.7 Nagra (2025a) zu finden. Die sicherungs- und sicherheitstechnische Begründung der Freihaltemassnahmen resp. des damit verknüpften Rodungsbedarfs ist im Sicherheitsbericht enthalten (Kap. 3.3.2, Nagra 2025d).
Während der Betriebsphase werden keine zusätzlichen Waldstandorte tangiert.
Vorbehältlich der Sicherung von Ersatzflächen sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Wald» eingehalten werden.
|
PH-HU2 Wal 01 |
Definitve Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen (Freihaltung) Der Flächenbedarf für die definitiv zu rodende Waldfläche (Freihaltestreifen) wird ermittelt, begründet und die Flächen für die Ersatzaufforstung festgelegt. |
|
PH-HU2 Wal 02 |
Erarbeitung Rodungsgesuch (Bundesverfahren) Für die Rodungen und die Aufforstung der Ersatzfläche(n) ist ein Rodungsgesuch mit Rodungs- und Ersatzaufforstungsplänen zu erarbeiten. Darin ist die Einhaltung der Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nachzuweisen. |
|
PH-HU2 Wal 03 |
Unterschreitung Waldabstand Die Anlageteile, welche den Waldabstand unterschreiten, werden ermittelt und in einem Plan festgehalten. Für die Unterschreitung des Waldabstands ist eine forstrechtliche Ausnahmebewilligung inkl. Begründung zu beantragen. |
-
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966, Stand 1. Januar 2022, SR 451 (NHG)
-
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 20. Juni 1986, Stand 1. Januar 2022, SR 922.0 (JSG)
-
Kantonale Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991, Stand 1. Juni 2017, SR 451.1 (NHV)
-
Verordnung über den Schutz von Pflanzen von besonders gefährlichen Schadorganismen vom 31. Oktober 2018, Stand 1. Januar 2024, SR 916.20 (Pflanzengesundheitsverordnung, PGesV)
-
Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung vom 15. Juni 2001, Stand 1. November 2017, SR 451.34 (Amphibienlaichgebiete-Verordnung; AlgV)
-
Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung vom 20. Juli 1977, Stand 1. Januar 2018, LS 702.11 (KNHV)
-
Kantonales Jagdgesetz vom 1. Februar 2021, Stand 1. Januar 2023, LS 922.1 (JG)
-
Kantonale Jagdverordnung vom 5. Oktober 2022, Stand 1. Januar 2023, LS 922.11 (JV)
-
Faktenblatt BLN, Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN; BAFU 2017c)
-
Vollzugshilfe Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Vollzug Umwelt (BUWAL 2002b)
-
Korridore für Wildtiere in der Schweiz– Grundlagen zur überregionalen Vernetzung von Lebensräumen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 326, (Holzgang et al. 2001)
-
Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz – Die Eingriffsregelung nach schweizerischem Recht, Leitfaden Umwelt Nr. 11 (Kägi et al. 2002)
-
Rote Listen: Gefährdete Arten der Schweiz (BAFU 2024d)
-
Lebensräume der Schweiz, Ökologie – Gefährdung – Kennarten, 3. Auflage, 2015 (Delarze et al. 2015)
-
Bewertungsmethode für Eingriffe in schützenswerte Lebensräume (Chemiesicherheit Kanton AG 2014)
-
GIS des Bundes: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN; swisstopo 2024)
-
GIS des Bundes: Bundesinventar der eidgenössischen Jagdbanngebiete (swisstopo 2024)
-
GIS des Bundes: Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung (swisstopo 2024)
-
GIS des Bundes: Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung (swisstopo 2024)
-
GIS des Bundes: Vernetzungssystem Wildtiere (swisstopo 2024)
-
GIS des Kantons Zürich: Kartierung Waldstandorte / seltene Gesellschaften, Inventar von Naturschutz-Infrastruktur-Objekten, die langfristig zielgerecht gepflegt und unterhalten werden müssen (GIS-ZH 2024)
|
PH-HU1 FFL 01 |
Feldaufnahmen Flora / Lebensräume Anhand von Feldaufnahmen vor Ort werden auf den tangierten Flächen die Flora (inkl. geschützter und Rote-Liste-Arten) sowie schützenswerte Lebensräume nach Delarze aufgenommen (inkl. Waldflächen) und die Ersatzpflicht gemäss NHV definiert. |
|
PH-HU1 FFL 02 |
Feldaufnahmen Fauna Anhand der Daten aus den CSCF-Datenbanken werden tangierte Hotspots von schützenswerten Arten identifiziert, diese mit Feldaufnahmen vor Ort verifiziert und die schützenswerten Lebensräume sowie die Ersatzpflicht gemäss NHV definiert. |
|
PH-HU1 FFL 03 |
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen Für die tangierten schützenswerten Lebensräume, die Vernetzung sowie allenfalls geschützte Einzelarten werden die Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen beschrieben und ausgewiesen. |
|
PH-HU1 FFL 04 |
Wildtierkorridore und Vernetzung Die Beeinträchtigung der Wildtierkorridore und Vernetzungselemente werden detaillierter beschrieben sowie allfällige Schutzmassnahmen definiert. |
|
PH-HU1 FFL 05 |
Lebensraumbilanzierung Die definitive ökologische Lebensraumbilanz der schützenswerten Lebensräume gemäss der Bewertungsmethode des BAFU (Chemiesicherheit Kanton AG 2014) wird erstellt und ausgewiesen. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Flora, Fauna, Lebensräume» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 FFL03 und 05 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgende ergänzende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und der KOBU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 2 BAFU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt.
-
Antrag 3 BAFU: Im Rahmen des UVB 1. Stufe erfolgte die Erhebung der vorhandenen Flora und Fauna gemäss Gesamtuntersuchungskonzept. Lichtschutzmassnahmen werden im UVB 2. Stufe abgehandelt, das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.
-
Antrag 7 BAFU: Der Antrag wird berücksichtigt.
-
Antrag 2 KOBU: Im UVB 1. Stufe wird der Ist-Zustand bezüglich Flora / Fauna / Lebensräumen im Projektperimeter beschrieben und in Plänen dargestellt. Allfällige indirekt betroffen Flächen werden im UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 3 KOBU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt.
-
Anträge 4 & 5 KOBU: Die Anträge werden berücksichtigt. Eine Ersterhebung der erwähnten Artengruppen wird durchgeführt. Zudem werden die potenziellen Lebensräume von Xylobionten, Wildbienen und Mollusken erhoben. Für den UVB 2. Stufe werden darauf basierend ergänzende Artenaufnahmen vorgesehen.
-
Antrag 6 KOBU: Der Antrag wird teilweise berücksichtigt. Da es sich um ein Bundesverfahren handelt, wird die BAFU-Bewertungsmethode für Eingriffe in schützenswerte Lebensräume nach Hintermann & Weber (Bühler et al. 2017) verwendet. Die Bilanzierung erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe.
-
Anträge 7, 8 und 9 KOBU resp. Antrag 1 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Im UVB 1. Stufe wird die ökologische Qualität der Lebensräume aufgrund des heutigen Projektstands in einer ersten Erhebung grob beurteilt. Im UVB 2. Stufe werden die ökologische Qualität beurteilt, die Ersatzmassnahmen definiert sowie deren langfristige Sicherung aufgezeigt. Das Pflichtenheft für die 2. Stufe wird entsprechend angepasst. Ebenfalls werden für das Baugesuch ökologische Ausgleichsmassnahmen definiert und im Pflichtenheft für den UVB 2 Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 2 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 3 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Anträge 4 und 5 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anpassungen werden entsprechend umgesetzt.
Inventarisierte Schutzobjekte
Der Projektperimeter überlagert das inventarisierte Landschaftsschutzobjekt Nr. 32 «Bachbestockung entlang Dorfbach, Windlach» (vgl. Fig. 5‑17). Im aktuellen Zustand kommt eine vereinzelte Bachbestockung mit Laubbäumen vom Nordrand Windlach bis ins Gebiet Deistler vor. Schutzzweck und -ziel ist es, die Bachbestockung abschnittweise zu verjüngen und Bereiche mit Dorngebüsch aufkommen zu lassen (Gemeinde Stadel 2014).
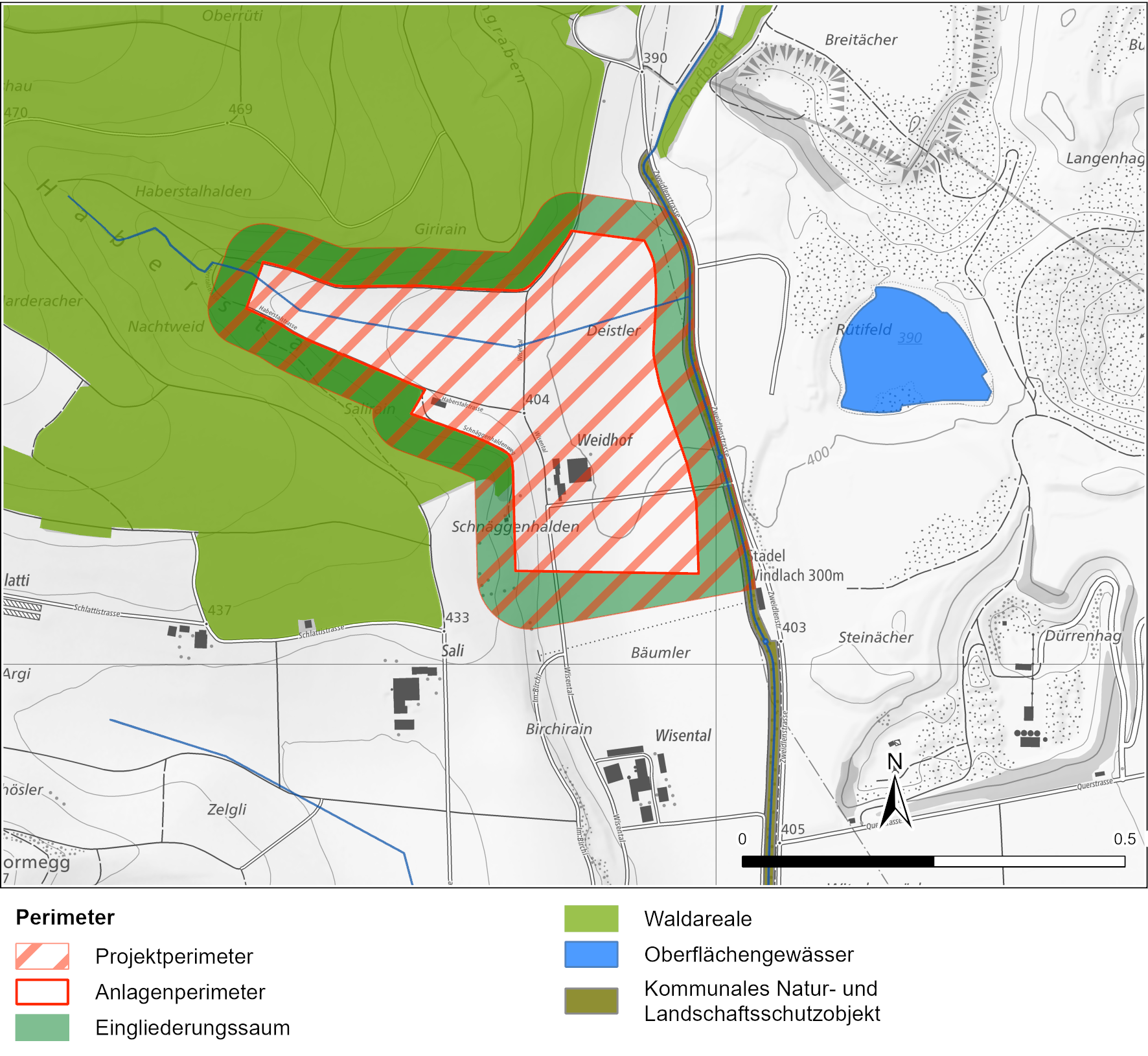
Fig. 5‑17:Schutzobjekte des kommunalen Natur- und Landschaftsschutzinventars in der Umgebung des Projektperimeters (Gemeinde Stadel 2024)
In ca. 1 km Entfernung nordöstlich des Haberstals befinden sich mehrere Kiesbiotope in der Kiesgrube Rütifeld. Zudem ist im selben Gebiet ein «Wanderobjekt» im Inventar der Amphibienschutzgebiete von nationaler Bedeutung ausgeschieden worden (vgl. Fig. 5‑19). Auf der Nord- und Westseite der Kiesgrube sind mehrere Trockenbiotope vorhanden. Gemäss kantonalem Gestaltungsplan Rütifeld (ARE Kanton ZH 2020, suisseplan Ingenieure AG 2018) ist damit zu rechnen, dass die Kiesgrube Rütifeld in ca. 15 – 20 Jahren aufgefüllt und vollständig rekultiviert ist, wodurch zusätzliche Lebensräume wie Magerwiesen, Kies- und Sandflächen sowie Feuchtwiesen entstehen können (vgl. Kap. 5.17.4).
Lebensräume
Gemäss Lebensraumkarte der Schweiz (swisstopo 2024) sind im Anlagenperimeter vor allem Feldkulturen sowie Fettwiesen vorhanden. Im Rahmen von Feldaufnahmen vor Ort in den Kalenderwochen 17, 23 und 29 / 2023 konnte dies bestätigt werden. Die im Anlagenperimeter liegenden Flächen werden grösstenteils für Feldkulturen ohne spezifische Ackerbegleitflora und teilweise als intensive Weiden verwendet. Wichtige Lebensräume sind somit vor allem die Randbereiche entlang der Flurwege und des Dorfbachs sowie der Waldrand. Bei den Aufnahmen wurden sowohl die Lebensräume gemäss Delarze et al. (2015) bestimmt (Übersichtsplan und Artenliste in der Beilage A2) als auch gefährdete Arten gemäss der Roten Liste (RL) sowie geschützte Arten aufgenommen.
Die Bewertung der gefährdeten Arten der Schweiz (Rote Liste, RL) wurde nach den Gefährdungskategorien der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) vorgenommen (vgl. Tab. 5‑10).
Neben der «nationalen Gefährdung» wird die «nationale Priorität» einer Art bzw. Lebensraum bezüglich der (Art-)Erhaltung und -förderung beurteilt (Priorität 1: sehr hoch, 2: hoch, 3: mittel, 4: mässig). Die nationale Priorität ergibt sich aus der Gefährdung und der Höhe der internationalen Verantwortung, welche die Schweiz für die Art trägt (BAFU 2019).
Tab. 5‑10:Erläuterung des RL-Status (BAFU 2024d)
|
RL - Status |
Beschreibung IUCN |
Beschreibung Schweiz |
|---|---|---|
|
RE |
regionally extinct |
In der Schweiz ausgestorben |
|
CR |
critically endangered |
Vom Aussterben bedroht |
|
EN |
endangered |
Stark gefährdet |
|
VU |
vulnerable |
Verletzlich |
|
NT |
near threatened |
Potenziell gefährdet |
|
LC |
least concern |
Nicht gefährdet |
|
DD |
data deficient |
Ungenügende Datengrundlage |
|
NE |
not evaluated |
Nicht beurteilt |
Die Lebensräume wurden anhand der Feldaufnahmen gemäss Delarze et al. (2015) eingestuft. Bei den im Perimeter vorgefundenen Lebensräumen handelt es sich um Wald und Waldrandgebiete, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Halbtrockenrasen und Fettwiesen. In Tab. 5‑11 werden die im Projektperimeter angetroffenen Lebensräume sowie deren Gefährdung zusammengefasst. Die Fauna und Flora (RL-Arten und geschützte Arten) wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben. Ein Plan der entsprechenden Lebensräume sowie die Artenliste ist in der Beilage A2 aufgeführt.
Tab. 5‑11:Lebensräume im Projektperimeter nach Delarze et al. (2015)
|
Lebensraum |
Beschreibung |
Gefährdung gemäss RL |
Nat. Priorität |
Schützenswert gemäss NHV |
Ersatzpflicht |
|---|---|---|---|---|---|
|
Typische Fromentalwiese (Arrhenatherion typicum, InfoFlora-Nr. 4.5.1.2) |
Typische Fromentalwiese entlang von Ackerflächen und weiteren intensiv genutzten Landwirtschaftsflächen, entlang des Dorfbachs sowie in der Nähe des Waldrands. Vorkommen von sehr typischen Arten (Ubiquisten), relativ artenreich (Feldaufnahme Nr. 1.1 gemäss Lebensraumkarte). Der Lebensraum ist gemäss der Roten Liste gefährdet und ist ein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |
VU |
3 |
ja |
ja |
|
Künstliche Ufer mit Vegetation (InfoFlora-Nr. 2.0.1) |
Entlang des Dorfbachs wird der Lebensraum als «künstliches Ufer mit Vegetation» eingestuft. Es handelt sich um Ufergehölze mit typischen Fromentalwiesen und trockeneren Stellen. Uferbereiche sind gemäss Art. 18 Abs. 1bis NHG besonders zu schützen und daher ersatzpflichtig. Zudem ist die Ufervegetation Teil des Landschaftsschutzobjektes Nr. 32 «Bachbestockung entlang Dorfbach, Windlach». |
- |
- |
ja |
ja |
|
Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen (Mesobromion, InfoFlora-Nr. 4.2.4) |
Trockener, magerer Standort an Bachböschung, blütenarm, praktisch nur Aufrechte Trespe - Bromus erectus (MBLL), kleinflächig. Wenige Blütenpflanzen, diese sind Trockenzeiger (Feldaufnahme Nr. 3.1). Der Lebensraum ist gemäss Anhang 1 NHVgeschützt und ist ein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |
VU |
3 |
ja |
ja |
|
Nährstoffreicher Krautsaum (Aegopodion+Alliarion, InfoFlora-Nr. 5.1.5) |
Krautsaum mit Einfluss vom angrenzenden Wald (Waldarten), Vorkommen von Ruderalarten (z.B. Huflattich – Tussilago farfara, Gänsefingerkraut – Potentilla anserina, Ruprechtskraut – Geranium robertianum) und typische Fettwiesenarten (Wiesenfuchsschwanz – Alopecurus pratensis, Fromental – Arrhenatherium elatius); nährstoffreich, teilweise stark mit invasiven Neophyten belastet (Feldaufnahme Nr. 7). Der Waldrandbereich ist stellenweise feuchter und zeigt einen deutlichen Wasseraufstoss / Hangwasser. Kleinflächig findet man dort eine andere Vegetation, dominiert durch den Schachtelhalm – Equisetum sylvaticum (Feldaufnahme Nr. 3.1). Da die feuchte Fläche sehr klein ist und nur wenige Arten vorkommen, ist eine eigene Zuteilung zu einem Lebensraum nach Delarze schwierig. Der häufigste Lebensraum (Grauerlen-Auenwald) trifft vorliegend sicher nicht zu, der Unterwuchs weist vermutlich ähnliche Bedingungen wie ein Auenwald (feucht, z.T. stehendes Wasser) auf. Der Lebensraum wird im nährstoffreichen Krautsaum zusammengefasst. Er ist gemäss Anhang 1 NHV geschützt und ist ein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |
LC |
0 |
ja |
ja |
|
Waldmeister Buchenwald (Galio-Fagenion, InfoFlora-Nr. 6.2.3) |
Typischer Wald des Mittellands mit Rotbuchen und weiteren typischen Arten, am Waldrand Einflüsse der nährstoffreichen Landwirtschaftsböden, teilweise feuchte Stellen (Feldaufnahme Nr. 8.1). Der Lebensraum ist gemäss nicht geschützt und ist kein Habitat von geschützten Tierarten gemäss Anhang 3 NHV (vgl. Fauna). |
LC |
0 |
nein |
nein |
|
Talfettweide (Cynosurion, InfoFlora Nr. 4.5.3) |
Intensiv und dauerhaft beweidete Wiese mit einem Obstbaum. Aufgrund der Beweidung durch Alpakas konnten keine detaillierten Vegetationsaufnahmen durchgeführt werden. Durch die Beanspruchung sind keine seltenen und/oder geschützten Arten zu erwarten. |
LC |
0 |
nein |
nein |
Flora
Im gesamten Projektperimeter konnten weder geschützte noch gefährdete Arten gemäss der RL festgestellt werden. Die Artenzusammensetzung der Lebensräume ist aufgrund der intensiven Bewirtschaftung der Flächen eher artenarm und stark nährstoffgeprägt. Die teilweise kleinräumig vorkommenden, trockeneren bzw. magereren Lebensräume sind vergleichsweise artenarm (Dominanz der Trespe, wenige Blütenpflanzen). Eine höhere Diversität ist vor allem im Bereich des Dorfbachs zu finden (vgl. Tab. 5‑11).
Fauna
Wild, Wildtierkorridore und Vernetzung
Der überregionale WTK ZH-10 Glattfelden (FORNAT AG 2020) grenzt direkt nördlich an den Anlagenperimeter und liegt innerhalb des rund 50 m breiten Streifens des nördlichen Eingliederungssaums (vgl. Fig. 5‑18). Der WTK verbindet die Lebensräume der Waldgebiete des Ämperg im Westen und des Chatzenstigs im Osten (vgl. Fig. 3‑1). Die Durchgängigkeit des WTKs ist durch Infrastrukturanlagen wie die Zweidlenstrasse und das Kiesabbaugebiet im Rütifeld mit seinen umzäunten Flächen gestört. Der WTK wird daher als «beeinträchtigt» eingestuft. Im Objektblatt des WTKs sind entsprechend spezifische Massnahmen zur Verbesserung der Durchlässigkeit gefordert (FORNAT AG 2020). Regionale Vernetzungsachsen sind durch den Projektperimeter keine betroffen. Eine Vernetzungsachse von nationaler Bedeutung verläuft hingegen rund 215 m nördlich des Projektperimeters und ist aufgrund der bewaldeten Flächen des Ämpergs für die übergeordnete Lebensraumvernetzung von Bedeutung (vgl. Fig. 5‑18).
Der Anlagenperimeter grenzt im Haberstal an die Waldränder, welche als Vernetzungsachsen und Übergangslebensräume dienen. Die Ruderalflächen des Haberstals bieten Weidemöglichkeiten für Wildtiere. Gemäss den Daten der Info Fauna (2024) wurden im Anlagenperimeter Dachs, Feldhase, Reh, Rotfuchs und Wildschweine gesichtet.
Im östlichen Teil des Eingliederungssaums verläuft der Dorfbach, welcher für die gewässerfolgende und gewässerlebende Fauna als Vernetzungsachse dient. Im nördlichen Abschnitt des Dorfbachs wurde im Rahmen der Feldaufnahmen eine Biberaktivität (Einstauung/Biberdamm) festgestellt.
Die Flächen im Anlagenperimeter werden grösstenteils landwirtschaftlich genutzt und bieten nur wenige Vernetzungselemente für Kleinsäuger. Während der Feldaufnahmen wurde festgestellt, dass vom Projektperimeter in Richtung der Kiesgrube Rütifeld eine relevante Amphibienwanderung über die Zweidlenstrasse hinweg stattfindet, wobei dort Querungshilfen fehlen. Die Vernetzung der Amphibienlebensräume ist daher heute beeinträchtigt.
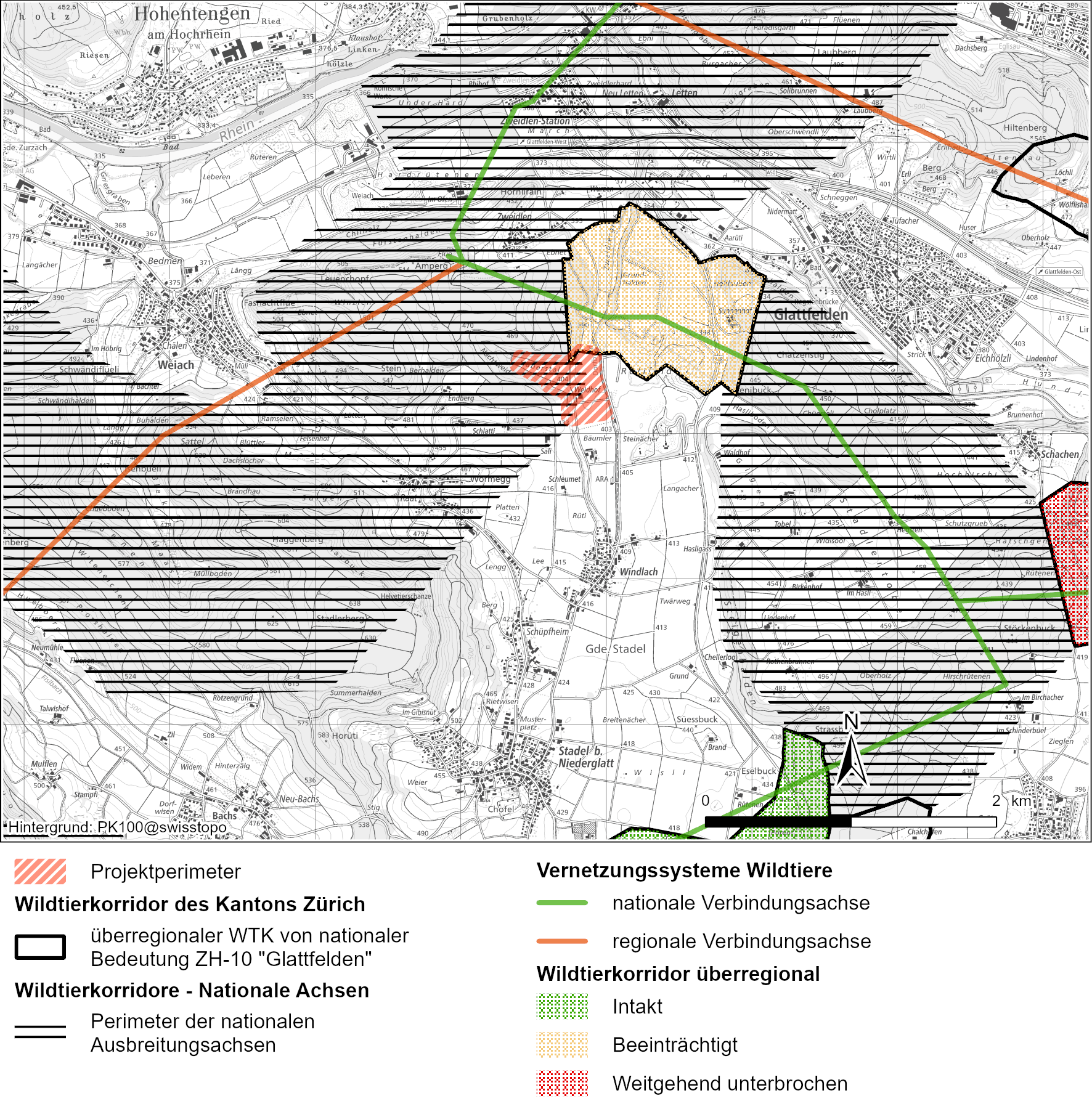
Fig. 5‑18:Wildtierkorridore und Vernetzungssysteme für Wildtiere (GIS-ZH 2024)
Fledermäuse
Aufgrund der vorhandenen Lebensräume Wald, Waldrand und offenes Feld sind sowohl das passende Nahrungsangebot als auch notwendige Quartiere vorhanden, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich verschiedene Fledermausarten in der Nähe oder innerhalb des Projektperimeters aufhalten. Gemäss den CSCF-Daten wurden folgende Arten im Projektperimeter festgestellt (Info Fauna 2024):
-
Grosses Mausohr – Myotis myotis
-
Wasserfledermaus – Myotis daubentonii
Amphibien
Im Norden der Kiesgrube Rütifeld (Mittlerboden) befindet sich ein Wanderobjekt des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (ZH 306, BUWAL 2002b). Im Bereich der Kiesgruben Rüteren/Hardrütenen ist zudem im Bundesinventar ein ortsfestes Objekt (ZH953, BAFU 2017a; ca. 2.6 km entfernt) verzeichnet (vgl. Fig. 5‑19). Zwischen den beiden Objekten und dem Projektperimeter ist aufgrund der Distanz von ca. 1 km resp. 2.6 km sowie den zahlreichen Hindernissen (Strassen, Zäune) keine Amphibienwanderung zu erwarten.
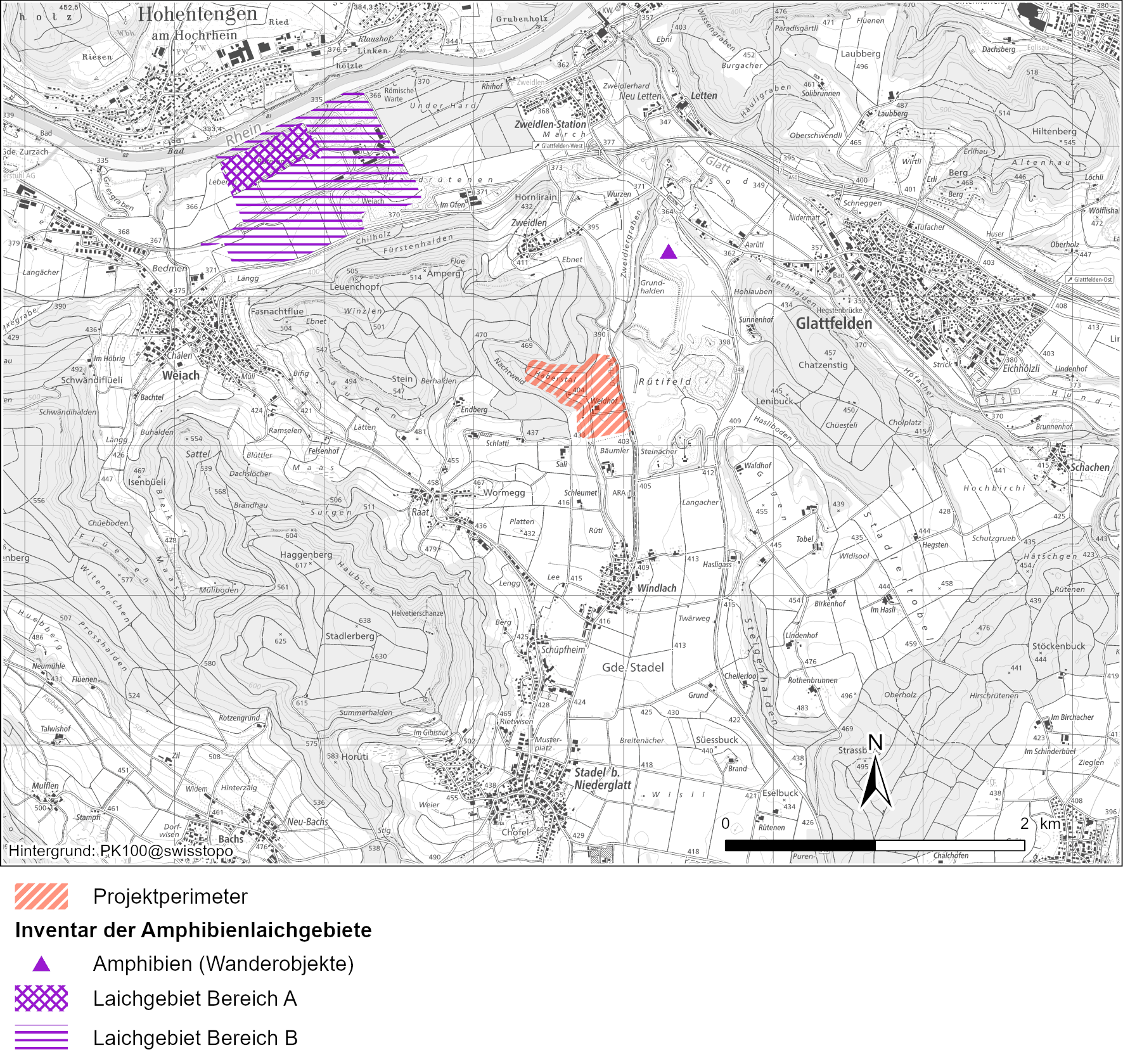
Fig. 5‑19:Amphibienschutzgebiete von nationalem Interesse (GIS-ZH 2024)
Für den Projektperimeter relevant ist hingegen die Amphibienwanderung vom Waldgebiet im Haberstal zum Dorfbach am Ostrand des Projektperimeters sowie in die Kiesgrube Rütifeld (Kiesbiotop von regionaler Bedeutung resp. Gruben- und Ruderalbiotop gemäss Richtplan) rund 520 m östlich des Projektperimeters. Während sechs Begehungen zwischen Mai und Juni 2023 wurden die im Untersuchungsperimeter vorkommenden Amphibienarten und deren Fortpflanzungsgewässer kartiert (vgl. Beilage A3). Als Fortpflanzungsgewässer konnten der unverbaute Teil des Haberstalgrabens im Westen (Larven des Feuersalamanders), der Brunnentrog der Quellfassung Haberstal (vgl. Kap. 5.6.4; Grasfroschlaich) und ein kleiner Tümpel oberhalb der Quellfassung (Grasfroschlaich) bestimmt werden. Die Populationsgrösse wurde mittels Vollzugshilfe Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und der Populationsgrössentabelle Amphibien der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) festgelegt (BUWAL 2002b, Karch 2019).
Im privaten, künstlich angelegten Gartenteich des Weidhofs wurden Seefrösche aufgenommen. Es handelt sich um eine eingeschleppte Art, welche nicht schützenswert ist und für die daher keine Schutzmassnahmen vorzunehmen sind. Der Teich wird mit dem Rückbau des Weidhofs (vor Baubeginn) aufgehoben.
Insgesamt wurden im Untersuchungsperimeter die Arten gemäss Tab. 5‑12 resp. Beilage A3 ermittelt:
Tab. 5‑12:Auflistung der angetroffenen Amphibienarten mit RL-Status und Populationsgrösse
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Populationsgrösse |
Priorität |
|---|---|---|---|---|
|
Erdkröte |
Bufo bufo |
VU |
Mittel |
4 |
|
Grasfrosch |
Rana temporaria |
LC |
Gross |
- |
|
Gelbbauchunke |
Bombina variegata |
EN |
Mittel |
3 |
|
Wasserfrosch-Komplex |
Pelophylax sp. |
NT |
Klein |
- |
|
Seefrosch |
Pelophylax ridibundus |
NE |
Klein |
- |
|
Feuersalamander |
Salamandra salamandra |
VU |
Klein |
4 |
|
Bergmolch |
Triturus alpestris |
LC |
Klein |
- |
Reptilien
Im Haberstal wurden während der Monate Mai, Juni und September 2023 bei insgesamt drei Begehungen frühmorgens sowie bei warmen und sonnigen Bedingungen die vorhandenen Reptilienarten kartiert. Weiter wurden entlang des Dorfbachs, bei der Schnäggenhalden und am Waldrand des Girirain Bitumenwellbleche ausgelegt. Die Standorte waren gegen Osten und/oder Süden ausgerichtet und die Bleche dienten den Reptilien als Unterschlupf oder Sonnenplatz, wodurch diese einfacher erfasst und beobachtet werden konnten.
Entlang des Waldrands und im nördlichen Teil des Haberstals (Eingliederungssaum) konnten mehrere Vorkommen der Zauneidechse und der Blindschleiche kartiert werden. In der Schnäggenhalden oder entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) wurden keine Reptilienvorkommen gefunden.
Die im Untersuchungsperimeter gefundenen Arten sind in Tab. 5‑13 sowie in der Beilage A4 aufgeführt:
Tab. 5‑13:Auflistung der angetroffenen Reptilienarten inkl. RL-Status und Priorität
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Priorität |
|---|---|---|---|
|
Zauneidechse |
Lacerta agilis |
VU |
4 |
|
Blindschleiche |
Anguis fragilis |
LC |
- |
Der nördliche und westliche Waldrand sowie das Waldgebiet «Girirain» (Eingliederungssaum) gelten somit als Reptilienlebensräume und sind gemäss Art. 14 und Art. 20 Abs. 2 resp. Anhang 3 NHV geschützt. Bei Eingriffen in diese Biotope sind Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen nötig.
Bei der Zauneidechse handelt es sich um eine gefährdete Art, welche gemäss RL als «verletzlich» eingestuft ist. In der Liste der national prioritären Arten der Schweiz weist die Zauneidechse eine mässige Priorität Stufe 4 und eine geringe Verantwortung der Stufe 1 auf. Die Blindschleiche ist nicht gefährdet und in der Liste der national prioritären Arten nicht aufgeführt.
Tagfalter
Anlässlich der Begehungen im Untersuchungsperimeter wurden 21 Tagfalterarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑14 und Beilage A6). Die Abundanz und Diversität an Tagfaltern war durchschnittlich, in einigen Gebieten aufgrund eines guten Angebots an Raupenfutter- und Nektarpflanzen jedoch überdurchschnittlich.
Am häufigsten festgestellt wurden typische Arten des Lebensraums «Fromentalwiesen» wie Grosses Ochsenauge und Kleiner Heufalter. Mit dem Kleinen Kohlweissling aber auch eine typische Art des Ackerlands vorhanden. Folgende potenziell gefährdete Arten der RL wurden im Untersuchungsperimeter nachgewiesen (vgl. Tab. 5‑14).
Tab. 5‑14:Auflistung der angetroffenen Tagfalterarten inkl. RL-Status
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Anzahl Nachweise |
|---|---|---|---|
|
Kurzschwänziger Bläuling |
Cupido argiades |
NT |
wenige (2 – 4) |
|
Gewöhnliches Widderchen |
Zygaena filipendulae |
NT |
verbreitet (5 – 10) |
Mit dem Rotklee und dem Hornklee wurden wichtige Raupenfutterpflanzen dieser Arten nachgewiesen, womit die Fortpflanzung der genannten Arten im Untersuchungsperimeter möglich ist.
Heuschrecken
Anlässlich der Begehungen wurden im Untersuchungsperimeter 14 Heuschreckenarten festgestellt (siehe Artenliste in der Beilage A6). Die Artenzahl Heuschrecken war im Hinblick auf die festgestellten Lebensraumtypen durchschnittlich, wobei die Abundanz aufgrund der Verbreitung von eher anspruchslosen Arten wie Gemeiner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer, Brauner Grashüpfer, Rote Keulenschrecke und Waldgrille stellenweise hoch ist. Folgende gefährdeten und potenziell gefährdeten Arten der RL wurden im Untersuchungsperimeter festgestellt (vgl. Tab. 5‑15):
Tab. 5‑15:Auflistung der angetroffenen Heuschreckenarten inkl. RL-Status.
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Anzahl Nachweise |
|---|---|---|---|
|
Zweifarbige Beissschrecke |
Metrioptera bicolor |
VU |
8 (stridulierend) |
|
Grosse Schiefkopfschrecke |
Ruspolia nitidula |
NT |
1 (Sichtung) |
|
Westliche Beissschrecke |
Platycleis albopunctata albopunctata |
NT |
8 (stridulierend) |
Sämtliche der oben aufgeführten RL-Arten wurden im Gebiet Schnäggenhalden sowie in der Fromentalwiese am Hangfuss der Schnäggenhalden, d.h. im Eingliederungssaum nachgewiesen.
Libellen
Anlässlich der Begehungen wurden im Untersuchungsperimeter 10 Libellenarten festgestellt (vgl. Beilage A6). Die Libellenaufnahmen wurden koordiniert mit den Tagfalter- und Heuschreckenaufnahmen durchgeführt.
Als Fortpflanzungsgewässer für die nachgewiesenen Libellen dienen insbesondere stille Wasserbereiche im Dorfbach (Aufstaubereich des Bibers) sowie im Haberstalgraben. Libellen sind während ihrer Reifephase sehr mobil und halten sich gerne auch weit abseits der Fortpflanzungsgewässer auf. Daher ist anzunehmen, dass sich nicht alle nachgewiesenen Arten im Untersuchungsgebiet auch fortpflanzen.
An den Begehungen wurden keine potenziell gefährdeten oder gefährdeten RL-Arten (Status NT oder höher), keine nach NHV geschützten Arten sowie keine prioritären Libellenarten festgestellt, womit keine artspezifischen Massnahmen erforderlich sind.
Xylobionte Käfer
Für den UVB 1. Stufe wurde eine Ersteinschätzung der Waldlebensräume im Bereich des Haberstals durchgeführt (Eingliederungssaum) und auf ihre potenzielle Eignung als Habitat für xylobionte Käfer beurteilt. Zudem wurde der Totholzanteil untersucht und dokumentiert (Frei 2024 und Beilage A7).
Aufgrund der unterschiedlichen Waldgesellschaften und Zusammensetzungen der Baumarten wurden die vom Vorhaben tangierten Waldflächen im Eingliederungssaum in die Teilflächen «Haberstal Nord» (Girirain, vgl. Fig. 3‑1) und «Haberstal West Süd» (Nachtweid und Salirain) unterteilt.
-
Teilfläche Haberstal Nord: vorwiegend dichte, gepflanzte Bestände von Fichten, Waldföhren und Buchen, wirtschaftlich genutzt. Nur wenig Totholz. Einige kleinere Bäume sind aufgrund des Konkurrenzdrucks abgestorben und werden voraussichtlich geerntet. Zudem befindet sich auf der ganzen Fläche verteilt dünnes Nadelholz-Astmaterial.
-
Teilfläche Haberstal West Süd: Lückige, relativ vitale Bewaldung. Angebot an Totholz eher gering (z.B. Wipfel einiger Buchen, abgestorbene Holundergebüsche). Für blütensuchende xylobionte Käfer wie den Rothalsbock (LC, nicht gefährdet) ist das Blütenangebot durch Zwergholunder und Disteln entlang der westlichen Waldränder grundsätzlich vorhanden.
Grundsätzlich weisen die Waldflächen rund um den Haberstal zu wenige alte und/oder dicke Bäume resp. Totholzstrukturen als Habitate auf. Es sind somit keine seltenen und geschützten Arten zu erwarten.
Wildbienen
Im und um den Projektperimeter wurde eine Ersteinschätzung der Lebensräume für Wildbienen durchgeführt und die Flächen bzgl. ihrer Eignung als Habitat untersucht und dokumentiert (Sedivy 2024 und Beilage A8).
Ein Grossteil der Flächen im Projektperimeter ist aufgrund der dichten Bewaldung und der intensiv bewirtschafteten Wiesen und Feldern als Lebensraum für Wildbienen vermutlich uninteressant.
Die östlich angrenzende Kiesgrube Rütifeld wurde im Jahr 2020 auf Wildbienenvielfalt untersucht. Insgesamt konnten im Rütifeld über 130 verschiedene Arten festgestellt werden, wobei gemäss RL-Status davon 6 Arten als verletzlich (VU), 8 Arten als potenziell gefährdet (NT) und 118 Arten als nicht gefährdet (LC) klassiert sind. Aufgrund der Nähe des Projektperimeters zur Kiesgrube Rütifeld sind daher auch Wildbienenvorkommen in den blütenreichen Randgebieten, in den Extensivwiesen entlang der Waldränder des Haberstals sowie entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) möglich. Die in diesen Flächen vorhandenen Bestände von Feld-Wittwenblumen, Wiesen-Flockenblumen, Rotklee und Kohldisteln bieten aufgrund des Pollen- und Nektarangebots geeignete Futterplätze als Nahrungsgrundlage für Wildbienen (vgl. Beilage A8).
Mollusken
Im und um den Projektperimeter wurde zudem eine Ersteinschätzung der Lebensräume für gefährdete Molluskenarten durchgeführt und die Flächen bzgl. ihrer Eignung als Habitat untersucht und dokumentiert (Müller 2024 und Beilage A9). Die Einschätzung erfolgte aufgrund der Lebensraumkartierungen (vgl. Tab. 5‑7) und den Gegebenheiten vor Ort. Insbesondere die Waldflächen um den Haberstal sowie die bestockten Flächen entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) eignen sich aufgrund der angetroffenen Verhältnisse grundsätzlich als Lebensraum für gefährdete Molluskenarten (vgl. Beilage A9). In den restlichen Bereichen sind keine gefährdeten Arten zu erwarten.
Inventarisierte Schutzobjekte
Das inventarisierte, kommunale Naturschutzobjekt Nr. 32 (Bachbestockung entlang Dorfbach, Windlach) liegt innerhalb des Eingliederungssaums. Durch den Bau der Arealzufahrten wird die Ufervegetation des Dorfbachs stellenweise langfristig beansprucht, wobei das Schutzobjekt, abgesehen von diesen standortgebundenen Anlagen von Bauten und Anlagen freigehalten wird. Die tangierte Ufervegetation wird ersetzt. Im UVB 2. Stufe werden für diese Beeinträchtigungen entsprechende Ersatzmassnahmen nach NHG geschaffen.
Lebensräume – Beurteilung Eingriffe und Ersatzpflicht
Im Anlagenperimeter und im Eingliederungssaum sind schützenswerte Lebensräume gemäss NHG betroffen (vgl. Kap. 5.16.4 und Tab. 5‑16), wobei für den Bau der Anlage ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und eine raumplanerische Standortbegründung für den Bau der OFA vorliegt (vgl. Nagra 2025a und Nagra 2025d). Gemäss Art. 18 Abs. 1ter NHG sind Beeinträchtigungen von schutzwürdigen Lebensräumen durch technische Eingriffe ersatzpflichtig. Die Eingriffe in die Vegetation finden hauptsächlich in der Bauphase statt. In dieser Phase werden im Eingliederungssaum der Wald umgestaltet (Rodung und Abstufung des Waldrands durch Pflegeeingriffe, vgl. Kap. 4.1.2.2) sowie im Anlagenperimeter der Boden abgetragen (vgl. Kap. 5.9.5.1). Ebenfalls werden die Arealzufahrten über den Dorfbach erstellt (vgl. Kap. 4.4.1).
Dabei werden vor allem die als ökologisch wertvoll eingestuften Lebensräume entlang des Dorfbachs (z.B. typische Fromentalwiesen, grasreiche mitteleuropäische Halbtrockenrasen, Ufervegetation und nährstoffreiche Krautsäume) sowie der nährstoffreiche Krautsaum entlang des Waldrands im Haberstal tangiert. Diese dienen als Habitat für Reptilien und Amphibien und sind gemäss Anhang 1 NHV aufgrund des Lebensraumtyps und andererseits gemäss Anhang 2 NHV als Habitat von gefährdeten und/oder geschützten Tierarten als schützenswert und damit ersatzpflichtig einzustufen. Allerdings sind die baulichen Eingriffe voraussichtlich einmalig (während der Erstellung) und der Eingliederungssaum wird während der übrigen Realisierungsphasen lediglich unterhalten. Zu gegebener Zeit (vgl. Kap. 3.5) wird in Absprache mit den zuständigen Behörden eine geeignete Nachnutzung des Eingliederungssaums definiert.
Total sind im Projektperimeter rund 6.9 ha schützenswerte, ersatzpflichtige Lebensräume betroffen, was knapp 30% der Gesamtfläche des Projektperimeters entspricht (vgl. Tab. 5‑16).
Tab. 5‑16:Tangierte Flächen von schützenswerten, ersatzpflichtigen Lebensraumtypen im Projektperimeter
Der Flächenanteil wurde entsprechend der Gesamtfläche nach Tab. 4‑1 berechnet.
|
Lebensraumtyp (Delarze et al. 2015) |
Teilfläche Anlagenperimeter |
Teilfläche Eingliederungssaum |
Projektperimeter |
|---|---|---|---|
|
Typische Fromentalwiese |
1.6 ha |
0.2 ha |
1.8 ha |
|
Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen |
– |
< 0.1 ha |
< 0.1 ha |
|
Nährstoffreicher Krautsaum (Habitat geschützter Arten gemäss Anhang 2 NHV) |
– |
0.5 ha |
0.5 ha |
|
Waldmeister Buchenwald (Habitat geschützter Arten Anhang 2 NHV ) |
– |
4.2 ha |
4.2 ha |
|
Ufergehölz |
– |
0.3 ha |
0.3 ha |
|
Total |
1.6 ha |
5.3 ha |
6.9 ha |
|
Flächenanteil der Gesamtfläche |
12 % |
50 % |
29 % |
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen
Im Rahmen der weiteren Projektplanung wird aufgezeigt, welche der gemäss Tab. 5‑16 tangierten Lebensraum-Flächen tatsächlich betroffen sind. Die tangierten schützenswerten bzw. ersatzpflichtigen Lebensräume werden nach der Methode Hintermann & Weber (Bühler et al. 2017) im UVB 2. Stufe bewertet. Den wegfallenden ersatzpflichtigen Lebensräumen werden die geplanten Ersatzmassnahmen gegenübergestellt. Mit einer artspezifischen Lebensraumbilanzierung wird für den UVB 2. Stufe der Nachweis erbracht, dass die Ersatzmassnahmen einen gleichwertigen Ersatz, d.h. eine ausgeglichene Bilanz für die Eingriffe in die geschützten Lebensräume bieten. Somit stellen die Ersatzlebensräume bzgl. Qualität und Ausprägung möglichst gleichwertige Lebensraumfunktionen sicher.
Wo die Anforderungen von Bau und Betrieb es erlauben, werden Anliegen aus dem Natur- und Heimatschutz berücksichtigt. Geprüft werden kann beispielsweise ob und in welchem Umfang ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum geleistet werden können z.B. durch die Schaffung eines ökologisch aufgewerteten Waldrandes (vgl. Kap. 4.1.2.2). Die konkrete Gestaltung des Eingliederungssaums wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden definiert und im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) des UVB 2. Stufe festgehalten.
Der für das Baugesuch zu erstellende LBP stellt die Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen auf Plänen dar und legt deren Erstellungs- und Unterhaltspflege fest. Dabei umfasst das Projekt auch sämtliche Ersatz- und Wiederherstellungsflächen, welche ausserhalb des Projektperimeters liegen. Bei Bedarf werden für das Baubewilligungsverfahren auch weitere Dokumente zur Sicherstellung der Ersatzlebensräume (z.B. Pflegeverträge, Vereinbarungen mit Dritten) erstellt.
Ökologische Ausgleichsmassnahmen
Gemäss Art. 78 Abs. 4 BV hat der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben (z.B. Realisierung von Bundesvorhaben) auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes Rücksicht zu nehmen und bedrohte Arten vor Ausrottung zu schützen. Durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen kann dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten entgegengewirkt werden (Art. 18 Abs. 1 NHG). Sowohl beim Schutz von Biotopen von regionaler und lokaler Bedeutung wie auch dem ökologischen Ausgleich handelt es sich um solche geeigneten Massnahmen.
Im Rahmen des Baugesuchs werden geeignete ökologische Ausgleichsmassnahmen in angemessenem Umfang und mit hoher ökologischer Qualität definiert.
Fauna
Wild, Wildtierkorridore und Vernetzung
Der Projektperimeter liegt innerhalb der Wildtier-Lebensräume des Ämpergs (vgl. Fig. 5‑18). Der nationale WTK ZH-10 wird durch das Projekt nicht tangiert und die Funktion des übergeordneten Wildtierverbundsystems wird somit nicht direkt beeinträchtigt. Allerdings können aufgrund der Bauarbeiten im Projektperimeter sowie wegen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf den nahe liegenden Verkehrsachsen (d.h. Zweidlen- und Schwarzrütistrasse) entstehende Lärm- und Lichtemissionen zu Störungen des WTK führen, welche die Funktionalität des WTK beeinträchtigen. Im Rahmen des Baugesuchs werden die genannten Auswirkungen auf den WTK für die Bauphase beurteilt und gegebenenfalls Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Funktionalität des WTK für angetroffene Zielarten ausgearbeitet. Grundsätzlich wird sich die Vernetzungssituation aufgrund der ab 2040 vorgesehenen Rekultivierung der Kiesgruben Rütifeld durch die Betreibergesellschaften (ARE Kanton ZH 2020) gegenüber heute künftig tendenziell verbessern.
Die Vernetzungsachsen entlang der Randbereiche des Haberstals (Waldrand, Dorfbach) werden während der Erstellung des Eingliederungssaums in den Phasen 1 und 3 vermutlich temporär unterbrochen bzw. aufgrund von Licht- und Lärmemissionen gestört. Sobald der Eingliederungssaum erstellt ist, ist die Wanderung entlang der Waldränder und des Dorfbachs wieder möglich, sodass Wildtiere den Anlagenperimeter umgehen können und die Vernetzung der Lebensräume wiederhergestellt wird. Tierfallen für Amphibien, Reptilien und Kleintiere werden mittels geeigneter Abschrankungen des Anlagenperimeters verhindert. Bei der Gestaltung des Eingliederungssaums sind Massnahmen zur Vernetzung vorzusehen. Dabei sind Ansprüche der verschiedenen Artengruppen im Rahmen des LBP aufeinander abzustimmen und entsprechende Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen. Die Ergebnisse der für UVB 2. Stufe getätigten Wildbienen, Mollusken- und Fledermausaufnahmen werden einbezogen. Durch den neugestalteten, stufigen Waldrand wird die Vernetzungsachse ökologisch aufgewertet und durch die Verkehrserschliessung von Süden her über die Zweidlen- und Querstrasse (vgl. Kap. 4.4.1 und Fig. 4‑7) nicht massgeblich verändert. Die Verkehrszunahme nach Norden via die Schwarzrütistrasse kann – insbesondere nachts – als gering beurteilt werden, weshalb von keiner Beeinträchtigung der Funktionalität des WTK während der Bauphase auszugehen ist. Dies wird für das Baugesuch bestätigt.
Beim Bau der Arealzufahrten über den Dorfbach ist die Durchgängigkeit für Kleintiere mit geeigneten Massnahmen sicherzustellen und für den UVB 2. Stufe zu definieren. Bei der Auslegung und Gestaltung von Bauten und Anlagen wird zudem auf den Vogelschutz geachtet.
Die Grünflächen im Anlagenperimeter gehen für die Äsung langfristig verloren, womit das Nahrungsangebot für Rotwild verkleinert wird. Im Rahmen der für den UVB 2. Stufe zu definierenden Massnahmen im Eingliederungssaum werden diese Ansprüche falls möglich einbezogen.
Fledermäuse
Die für Fledermäuse geeigneten Lebensräume Wald, Waldrand und offenes Feld im Projektperimeter werden während der Bauphase beansprucht. Die gemäss CSCF-Daten vorhandenen Arten werden gemäss RL als gefährdet (VU) mit national sehr hoher Priorität (1) resp. als potenziell gefährdet (NT) eingestuft. Sie sind nach NHV geschützt, womit artspezifischen Massnahmen bzw. Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen gemäss NHV erforderlich sind.
Aufgrund der Befunde sind für den UVB 2. Stufe entsprechende Felduntersuchungen bzgl. Fledermausvorkommen vorzusehen und deren Ansprüche für den LBP im UVB 2. Stufe abzustimmen sowie Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen.
Amphibien
Durch die Arbeiten im Eingliederungssaum (Freihaltung im Waldrandbereich Haberstal) sowie entlang des Dorfbachs zu Beginn der Bauphase sind Habitatverluste unvermeidbar. Betroffen davon sind die Arten Bergmolch, Erdkröte, Gelbbauchunke und Grasfrosch. Im Bereich des Dorfbachs wurde zudem eine Kreuzkröte gesichtet. Amphibien sind nach Art. 2 NHV geschützt und Eingriffe in deren Lebensräume daher ersatzpflichtig. Geprüft werden kann beispielsweise ob und in welchem Umfang ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum geleistet werden können, um Habitate langfristig zu ersetzen (z.B. dann, wenn eine Teil-/Offenlegung des Haberstalgrabens im nördlichen Eingliederungsaums realisiert werden kann, vgl. Kap. 5.7.5.1).
Die Eingriffe am Waldrand sind temporär und durch die neuen Strukturen wird die Situation für Amphibien langfristig verbessert. Beim Lebensraum «Waldrand» handelt es sich um einen Landlebensraum der Amphibien, welchen sie ausserhalb der Laichzeit aufsuchen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Amphibien in der Bauphase weiter in den Wald hinein zurückziehen. Die Bestände entlang des Dorfbachs sind vermutlich hauptsächlich auf die Wanderung in Richtung Kiesgrube zurückzuführen und daher massgeblich im Frühling während der Wanderung betroffen. Durch die lediglich punktuellen Eingriffe in den Dorfbach für den Bau der neuen Arealzufahrten bleibt der grösste Teil des Uferbereichs ungestört, sodass sich Amphibien zurückziehen können. Geeignete Massnahmen sind für UVB 2. Stufe abzuwägen und zu prüfen.
Während des Baus wird – unter Berücksichtigung der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben – mittels geeigneter Massnahmen und unter Beizug einer Fachperson sichergestellt, dass Amphibien während der Wanderung möglichst nicht in den Anlagenperimeter gelangen.
Reptilien
Für die Reptilien im Projektperimeter sind während der Bauphase vor allem die Eingriffe im Norden des Eingliederungssaums durch Freihaltung und Abstufung des Waldrands relevant. Davon sind die Rote-Liste-Arten Zauneidechse und Blindschleiche (vgl. Tab. 5‑13) betroffen, welche auf Eingriffe in ihr Habitat empfindlich reagieren. Für die Bauphase sind bedarfsgerechte Rückzugslebensräume vorzusehen, sodass eine Restpopulation gesichert werden kann. Geprüft werden kann ob und in welchem Umfang ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum geleistet werden können, um die Verluste des Habitats entlang des Waldes langfristig zu ersetzen. Innerhalb des Anlagenperimeters sind keine Reptilienpopulationen betroffen.
Tagfalter, Heuschrecken, Libellen
Die Feldaufnahmen zeigen, dass im Projektperimeter zwar Tagfalter und Heuschrecken vorhanden sind, die Vielfalt jedoch eher gering ist (vgl. Tab. 5‑14 und Tab. 5‑15), wobei die Abundanz von Heuschrecken stellenweise hoch war. Bei den Begehungen wurden zwei potenziell gefährdete RL-Tagfalterarten gesichtet. Drei nachgewiesene Heuschreckenarten (Westliche Beissschrecke, Grosse Schiefkopfschrecke, Zweifarbige Beissschrecke) sind ebenfalls potenziell gefährdet oder gefährdet (national prioritäre Art, Prioritätsstufe 4). Sie sind nach NHV geschützt, womit artspezifischen Massnahmen bzw. Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen gemäss NHV erforderlich sind.
Die während den Begehungen angetroffenen Libellenarten sind gemäss RL als nicht gefährdet (LC) eingestuft (vgl. Beilage A6). Es wurden keine gefährdeten RL-Arten (Status VU oder höher), keine nach NHV geschützten Arten und keine prioritären Libellenarten festgestellt, womit keine artspezifischen Massnahmen bzw. Ersatz der Lebensräume gemäss NHV erforderlich sind.
Bei der Ausgestaltung der ohnehin für andere Themen des Umweltbereichs «Flora, Fauna, Lebensräume» benötigten Ersatzmassnahmen werden die Ansprüche der gefährdeten sowie der potenziell gefährdeten Heuschreckenarten, als auch der potenziell gefährdeten Tagfalterarten auf ihren Lebensraum mit geeigneten Massnahmen miteinbezogen.
Xylobionte Käfer
Die Resultate der Ersteinschätzung zeigen, dass im Projektperimeter keine geeigneten Habitate für Xylobionten vorhanden sind. Entsprechend werden für den UVB 2. Stufe keine Aufnahmen von xylobionten Käfern vorgesehen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Auflichtung der Waldflächen im Eingliederungssaum künftig geeignete Habitate für Xylobionten geschaffen werden.
Wildbienen
Die im Eingliederungssaum vorhandenen, blütenreichen Randgebiete, Extensivwiesen entlang der Waldränder des Haberstals sowie entlang des Dorfbachs bieten aufgrund der dort vorhandenen Bestände von Feld-Witwenblumen, Wiesen-Flockenblumen, Rotklee und Kohldisteln wertvolle Futterplätze als Nahrungsgrundlage für Wildbienen. Der Eingliederungssaum wird im Rahmen der Bauphase beansprucht. Die Nisthabitate (Kiesgrube Rütifeld) werden durch das Vorhaben nicht tangiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund des Freihaltestreifens und Auflichtung der Waldflächen im Eingliederungssaum mehr Nisthabitate für Wildbienen geschaffen werden.
Aufgrund der Befunde der Ersteinschätzung sind im Eingliederungssaum für UVB 2. Stufe entsprechende Felduntersuchungen bzgl. Wildbienenvorkommen vorzusehen und deren Ansprüche für den LBP im UVB 2. Stufe abzustimmen sowie Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen. Für UVB 2. Stufe ist zudem zu prüfen, ob Teile der Ruderalflächen direkt im Projekt wiederhergestellt werden können. Die restlichen Flächen sind zu ersetzen.
Mollusken
Insbesondere die Waldflächen um den Haberstal sowie die bestockten Flächen entlang des Dorfbachs (Eingliederungssaum) eignen sich aufgrund der angetroffenen Verhältnisse als Lebensraum für gefährdete Molluskenarten (vgl. Beilage A9). Die potentiell vorhandenen Molluskenarten sind nicht im Anhang 3 NHV aufgeführt, sind aber gemäss Art. 18 NHG und Art. 14 NHV als schützenswert einzustufen. In den restlichen Bereichen des Projektperimeters sind keinen gefährdeten Arten zu erwarten.
Aufgrund der Ergebnisse der Ersteinschätzung sind für den UVB 2. Stufe auf den genannten Flächen im Eingliederungssaum Molluskenaufnahmen vorgesehen und deren Ansprüche für den LBP im UVB 2. Stufe abzustimmen sowie Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen.
Beleuchtung
Grundsätzlich finden die Bauarbeiten tagsüber statt. In Ausnahmefällen werden Nachtarbeiten ausgeführt (vgl. Kap. 4.2.4). Für Arbeiten in der Nacht und am Abend sind Lichtquellen notwendig, welche vor allem nachtaktive Kleintiere und Insekten stören. Für den UVB 2. Stufe wird ein Beleuchtungskonzept für die Bauphase nach den geltenden Richtlinien (SIA 2013) ausgearbeitet (vgl. auch Kap. 5.17.5.1).
Die Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter werden in voraussichtlich rund 100 Jahren rückgebaut (vgl. Kap. 3.5.2), wobei die Nachnutzung der verschiedenen Flächen im Projektperimeter erst im Rahmen des Stilllegungsverfahrens definiert wird (vgl. Kap. 3.5.2). Während der Bauphase werden im Eingliederungssaum mittels Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen (vgl. Kap. 5.16.5.1) neue Lebensräume geschaffen, ggf. auch innerhalb des Anlagenperimeters. Bei einem allfälligen Rückbau ist diese Situation mit geeigneten Massnahmen zu berücksichtigen.
Während der Betriebsphase sind keine baulichen Eingriffe in die Lebensräume vorgesehen. Entsprechend sind keine negativen Auswirkungen auf Fauna, Flora und Lebensräume zu erwarten. Der induzierte Verkehr während der Betriebsphase ist zudem als gering einzuschätzen (vgl. Kap. 4.4.2.2). Für den UVB 2. Stufe werden die Erstellungspflege (Pflegearbeiten nach Pflanzarbeiten während 1 bis 2 Vegetationsperioden) sowie die nachfolgende Pflege und der Unterhalt von Ersatzflächen definiert.
Aus Sicherheitsgründen wird der Anlagenperimeter voraussichtlich jederzeit ausleuchtbar sein, jedoch nicht ständig voll beleuchtet (vgl. Kap. 4.2.5). Die Beleuchtung des Anlagenperimeters ist daher im Sinne der Vorsorge gemäss Art. 11 Abs. 2 USG zu begrenzen und die Ausgestaltung und Auswirkungen auf die Umgebung und die nachtaktive Fauna in einem Beleuchtungskonzept für die Betriebsphase darzulegen (vgl. Kap. 5.17).
Die Auswirkungen auf die Funktionalität des WTK werden für die Betriebsphase beurteilt und gegebenenfalls Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Funktionalität des WTK für angetroffene Zielarten ausgearbeitet.
In der Bauphase sind im Anlagenperimeter und im Eingliederungssaum aufgrund der baulichen Massnahmen Eingriffe in gemäss NHV als schützenswert eingestufte Lebensräume und Habitate von diversen vorhandenen Tierarten vorgesehen. Bei den ersatzpflichtigen Lebensräumen handelt es sich um extensiv genutzte Standorte, welche im Schweizer Mittelland unter Druck stehen und im Rückgang sind. Im Rahmen des UVB 2. Stufe wird mittels einer Lebensraumbilanzierung die Ersatzpflicht bestimmt.
Für permanente Eingriffe ist eine Interessenabwägung erforderlich, zudem ist eine raumplanerische Standortbegründung herzuleiten. Der Standort ist das Ergebnis einer umfangreichen Interessenabwägung im Rahmen des Sachplanverfahrens. Weiterführende Informationen dazu sowie eine raumplanerische Standortbegründung wird im BAR dargelegt (Nagra 2025a).
Ein Teil der ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen wird durch Aufwertungen im Eingliederungssaum geleistet, falls möglich auch innerhalb des Anlagenperimeters. Der ökologische Wert der Flächen im Eingliederungssaum kann dadurch gegenüber heute ausgeglichen werden. Damit eine ausgeglichene Gesamtbilanz erreicht wird, werden für das Baugesuch zusätzliche, ggf. projektexterne Ersatzflächen eruiert, welche ebenfalls zum Projekt gehören. Die Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen werden für den UVB 2. Stufe festgelegt, in einem entsprechenden Projekt dargelegt und in einem Plan dargestellt. Dabei ist deren langfristige Sicherung aufzuzeigen.
In der Betriebsphase sind neben dem Einfluss der Arealeinzäunung und der partiellen nächtlichen Beleuchtung im Anlagenperimeter keine negativen Auswirkungen auf den Umweltbereich «Flora, Fauna, Lebensräume» zu erwarten.
Vorbehältlich der Sicherung von Ersatz- und Wiederherstellungsflächen, unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Flora, Fauna, Lebensräume» eingehalten werden.
|
PH-HU2 FFL 01 |
Ergänzende Feldaufnahmen Flora / Lebensräume Falls notwendig, werden zusätzliche Feldaufnahmen ergänzend zu den Erhebungen aus dem UVB 1. Stufe durchgeführt (inkl. allfällige indirekt betroffene Flächen) und die Ersatzpflicht gemäss NHV definiert. |
|
PH-HU2 FFL 02 |
Ergänzende Feldaufnahmen Fauna: Wildbienen, Mollusken und Fledermäuse Innerhalb der für die Arten geeigneten Teilflächen werden Feldaufnahmen von Wildbienen, Mollusken und Fledermäusen durchgeführt. |
|
PH-HU2 FFL 03 |
Bewertung von Eingriffen und Bemessung von Ersatzmassnahmen Bewertung der Eingriffe und Angaben zur Ersatzpflicht anhand der BAFU-Bewertungsmethode von Eingriffen in schützenswerte Lebensräume nach Bühler et al. (2017). |
|
PH-HU2 FFL 04 |
Definition der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen, Sichern von Ersatzflächen Die notwendigen Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen werden beschrieben (inkl. Bestimmung der Ziel- und Leitarten) und in einem Plan dargestellt. Ersatzflächen ausserhalb des Projektperimeters werden festgelegt und rechtlich gesichert. |
|
PH-HU2 FFL 05 |
Definition von ökologischen Ausgleichsmassnahmen Im Rahmen des Baugesuchs sind ökologische Ausgleichsmassnahmen in angemessenem Umfang und hoher ökologischer Qualität zu definieren. |
|
PH-HU2 FFL 06 |
Erstellung der Lebensraumbilanzierung Es wird eine nach BAFU-Bewertungsmethode für Eingriffe in schützenswerte Lebensräume (Bühler et al. 2017) ausgeglichene Bilanz erreicht. |
|
PH-HU2 FFL 07 |
Vogelfreundliche Gestaltung Die Bauten und Anlagen werden gemäss geltenden Empfehlungen von anerkannten Fachspezialisten vogelfreundlich gestaltet. |
|
PH-HU2 FFL 08 |
Verhinderung von Wildtierfallen Während des Baus werden – unter Berücksichtigung der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben – geeignete Massnahmen zur Verhinderung von Wildtierfallen getroffen. Die Umsetzung der Massnahmen ist durch einen Amphibien- und Reptilienspezialisten zu begleiten. |
|
PH-HU2 FFL 09 |
Verbesserung Lebensraumvernetzung Für die Verbesserung der Lebensraumvernetzung für Kleintiere und Amphibien sind geeignete Massnahmen vorzusehen und in einem Plan festzuhalten. Die Umsetzung der Massnahmen ist durch einen Amphibien- und Reptilienspezialisten zu begleiten. |
|
PH-HU2 FFL 10 |
Auswirkungen von Zusatzverkehr auf die Durchlässigkeit des WTK Die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens auf der Zweidlenstrasse und Schwarzrütistrasse während des Baus und/oder des Betriebs des Tiefenlagers auf die Durchlässigkeit des WTK sind darzulegen. Es sind gegebenenfalls Massnahmen zur Sicherstellung der Durchlässigkeit der Strassen für die Zielarten des WTK zu ergänzen. |
|
PH-HU2 FFL 11 |
Licht und Lärm Auswirkungen auf den WTK Die Auswirkungen auf den überregionalen WTK ZH-10 «Glattfelden» bzgl. Licht und Lärm sind zu beurteilen. Es sind gegebenfalls Schutzassnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität des WTK auszuarbeiten. |
|
PH-HU2 FFL 12 |
Schutz gefährdeter Lebensräume während der Bauphase Die nach NHG schützenswerten Flächen im und angrenzend an den Projektperimeter werden mit geeigneten Massnahmen geschützt und abgegrenzt. |
|
PH-HU2 FFL 13 |
Rückzugslebensräume während der Bauphase In der Bauphase werden Rückzugslebensräume für Amphibien und Reptilien vorgesehen. Die Umsetzung der Massnahmen ist durch einen Amphibien- und Reptilienspezialisten zu begleiten. |
|
PH-HU2 FFL 14 |
Erstellung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) für die Betriebsphase Die vorgesehenen Ersatzmassnahmen inkl. deren langfristiger Unterhalt / Pflege werden im LBP festgehalten. |
|
PH-HU2 FFL 15 |
Sicherstellung Unterhalt Ersatzflächen, ggf. Vereinbarungen mit Dritten für die Betriebsphase Nach Bedarf wird der Unterhalt der Ersatzflächen (vgl. PH-HU2 FFL 04) während der Betriebsphase mittels Pflegeverträgen und/oder Vereinbarungen mit Dritten geregelt. |
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966, Stand 1. Januar 2022, SR 451 (NHG)
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991, Stand 1. Juni 2017, SR 451.1 (NHV)
Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 04. Oktober 1985, Stand 1. Januar 2023, SR 704 (FWG)
Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Denkmäler vom 10. August 1977, Stand 1. Juni 2017, SR 451.11 (VBLN)
Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, vom 9. September 1981, Stand 1. Mai 2024, SR 451.12 (VISOS)
Verordnung über Fuss- und Wanderwege vom 26. November 1986, Stand 1. Juli 2008, SR 704.1 (FWV)
Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung vom 20. Juli 1977, Stand 1. Januar 2018, LS 702.11 (KNHV)
Kantonaler Richtplan (Kantonsrat Zürich 2024)
Zonenplan Gemeinde Stadel (Gemeinde Stadel 2010)
Zonenplan Gemeinde Glattfelden (Gemeinde Glattfelden 2017)
Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte – Neufestsetzung (Baudirektion des Kantons Zürich 2022)
Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte, Objekt 6005, Kulturerbelandschaft Ämperg (ARE Kanton ZH 2019)
Landschaftsgerecht planen und bauen. Wegleitung zur landschaftspflegerischen Begleitplanung. Dokumentation SIA, D 0167 (Kleiner & Schmitt 2001)
Landschaft 2020: Leitbild des BUWAL für Natur und Landschaft (BUWAL 2003b)
Arbeitshilfe Landschaftsästhetik. Wege für das Planen und Projektieren (Gremminger et al. 2001)
Schweiz Mobil: Wanderweg-, Velo- und Skaterouten (swisstopo 2024)
Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissionen, Umwelt-Vollzug Nr. 2117 (BAFU 2021b)
Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum SIA 491 (Schweizer Norm SN 586 491; SIA 2013)
Kantonaler Gestaltungsplan «Rütifeld», Verbesserung der Endgestaltung Rütifeld mit Umweltverträglichkeitsprüfung (suisseplan Ingenieure AG 2018)
GIS des Bundes: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN; swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS; swisstopo 2024)
Landschaftskonzept Schweiz. Landschaft und Natur in den Politikbereichen des Bundes, Umwelt-Info Nr. 2011 (BAFU 2020b)
Die Landschaften der Schweiz. Landschaftstypologie Schweiz, Teil 2 – Beschriebe der Landschaftstypen (ARE 2011)
|
PH-HU1 Lan 01 |
Eigenschaften der Landschaft Die typischen Eigenschaften der Landschaft sind zu beschreiben und in einem breiteren landschaftlichen Zusammenhang qualitativ zu bewerten: traditionelle Kulturlandschaften (Werte, Gefährdungen), Naturdenkmäler, Inventare. |
|
PH-HU1 Lan 02 |
Einfluss auf das Landschaftbild Der Einfluss auf das Landschaftsbild ist stufengerecht anhand der vorliegenden Projektunterlagen zu beschreiben und mit Visualisierungen zu veranschaulichen. |
|
PH-HU1 Lan 03 |
Landschaftschutz Die zum Schutz der Landschaft vorgesehenen Massnahmen sind darzulegen und allfällige gesetzlich erforderliche Ersatzmassnahmen sind zu definieren, unter Berücksichtigung der derzeit noch nicht bekannten Standorte für Deponien und Schachtkopfanlagen. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen)» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Lan 02 und 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Die Abteilung Koordination Bau und Umwelt (KOBU) des Kanton Zürichs hat in seiner Stellungnahme vom 13. Dezember 2022 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1.2):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 29. April 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und der KOBU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 4 BAFU: Der Antrag wird berücksichtigt.
-
Antrag 6 BAFU: Der Antrag wird berücksichtigt.
-
Antrag 11 KOBU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Der Entscheid über die Notwendigkeit eines Umladebahnhofs, dessen Standort sowie dessen Ausgestaltung wird für das Baugesuch getroffen und die Auswirkungen im UVB 2. Stufe beurteilt.
-
Antrag 12 KOBU: Die Kiesvorkommen im Projektperimeter bleiben für allfälligen künftigen Abbau erhalten. Ein ggf. projektbedingter Kiesabbau wird erst im UVB 2. Stufe evaluiert. Der Antrag wird somit in den UVB 2. Stufe verschoben und das Pflichtenheft entsprechend ergänzt.
-
Antrag 13 KOBU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Im UVB 1. Stufe wurde lediglich eine grobe Zonierung des Projektperimeters (Eingliederungssaum, Anlagenperimeter) vorgenommen.
-
Antrag 14 KOBU: Der Antrag wird im UVB 1. Stufe berücksichtigt. Es wird ein Grobkonzept der Flächenreservationen und des Eingliederungssaums erstellt. Zum UVB 2. Stufe folgt eine Detailplanung aufgrund der Areal- und Gebäudelayouts.
-
Anträge 46 & 48 KOBU: Das Beleuchtungskonzept inkl. Massnahmen zur Reduzierung der Lichtemissionen resp. zur Minimierung negativer Auswirkungen durch Lichtimmissionen auf die Umgebung und die nachtaktive Fauna werden im UVB 2. Stufe definiert, das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.
-
Antrag 47 KOBU: Der Antrag wird teilweise angenommen. Im UVB 1. Stufe werden die Tier- und Pflanzenarten aufgenommen und gemäss ihrem RL-Status eingeteilt (vgl. Kap. 5.16.4). Die Abschirmung der Umgebung vor allfälligen Lichtimmissionen wird im UVB 2. Stufe behandelt. Das Pflichtenheft wird entsprechend ergänzt.
-
Antrag 6 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird entsprechend umgesetzt.
Die Talebene des Windlacherfelds liegt auf der Ostseite des Ämpergs und ist vor allem geprägt durch das ausgedehnte Kiesabbaugebiet Rütifeld (mit Kies- und Betonwerk). Westlich davon und nördlich des Stadler Ortsteils Windlach öffnet sich, topografisch leicht tiefer gelegen, eine flach gegen Nordosten abfallende Ebene, welche im Osten vom Dorfbach gesäumt und daher Dorfbachtal genannt wird. Durch die östlichen Ausläufer des Ämpergs verengt sich das Dorfbachtal gegen Norden wieder und geht in den schmalen Zweidlergraben (Fortsetzung des Dorfbachs) über. Rund 1 km nördlich von Windlach zweigt ein seitliches Kerbtal gegen Westen vom Dorfbachtal ab und bildet den Haberstal. Das von West nach Ost leicht geneigte Seitental ist auf drei Seiten umrahmt durch die rasch ansteigenden, bewaldeten Ausläufer des Ämpergs (vgl. Fig. 3‑1).
Topografie und Morphologie
Die Morphologie der Landschaft um den Projektperimeter ist glazial geprägt und durch die vier Molasseerhebungen Ämperg (488 m ü. M. im Westen), Stadlerberg (638 m ü. M. im Südwesten), Strassberg (495 m ü. M. im Südosten) und Chatzenstig (455 m ü. M. im Nordosten) umrahmt (vgl. Fig. 3‑1). Alle vier Erhebungen sind mit ausgedehnten Wäldern bestockt, welche ihre landschaftsprägende Wirkung verstärken. Im Norden schliesst der Waldstreifen zwischen Rütifeld und Zweidlergraben die Talebene zum höher gelegenen Kiesabbaugebiet des Rütifelds ab und bildet so eine landschaftliche Zäsur zwischen dem Ämperg und dem Chatzenstig. Im Süden geht die Talebene nahtlos in die Glaziallandschaft bei Neerach über.
Landschaftstypologie
Gemäss Landschaftstypologie wird das Gebiet dem Landschaftstyp 12 «Ackergeprägte Hügellandschaft des Mittellandes» zugeordnet (ARE 2011). Die Beschreibung lautet treffend: «Die Hügellandschaft des tieferen Mittellandes wird geprägt durch zahlreiche Dörfer und intensive Landwirtschaft mit Ackerbau und regionalem Obstbau. Insbesondere in Agglomerationsnähe findet eine starke, teilweise disperse Siedlungsausdehnung (Periurbanisierung) statt. Zahlreiche bedeutende Verkehrsverbindungen und Energieleitungen durchqueren die Landschaft» (BAFU 2020b).
Die Landschaft ist einerseits durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie durch den langjährigen, flächenintensiven Kiesabbau geprägt. Anderseits ist diese abwechslungsreich und zeichnet sich durch die glaziale Formenvielfalt und ein mosaikartiges Landnutzungsmuster aus. Die Lage und Fliessrichtung der letzten Vergletscherungen ist anhand des breit ausgeformten Tals mit benachbarten, höher gelegenen Flächen gut erkennbar.
Schonender Umgang mit Landschaft (Landschaftskonzept Schweiz)
Das Landschaftskonzept (BAFU 2020b) wurde durch den Bundesrat als Konzept des Bundes verabschiedet und formuliert sieben allgemeine Landschaftsqualitätsziele und sieben Qualitätsziele für spezifische Landschaften. Die allgemeinen Landschaftsqualitätsziele sollen durch eine sorgfältige Projektierung und landschaftliche Begleitung aufgegriffen werden (z.B. 1 – Landschaftliche Vielfalt und Schönheit wahren, 3 –Landnutzungen standortgerecht gestalten, 4 – Eingriffe sorgfältig und qualitätsorientiert ausführen, 5 – Kulturelles und natürliches Erbe der Landschaft anerkennen).
Für landschaftsrelevante Sektoralpolitiken, wie Bundesbauten, nennt das Landschaftskonzept Schweiz folgende spezifischen Sachziele, den folgenden Planungs- und Projektierungsschritten zu erfüllen sind:
-
Ziel 1.A: Gute Einpassung, hohe Baukultur und qualitätssichernde Verfahren
-
Ziel 1.B: Eine vielfältige und hohe Qualität der Umgebung sowie eine naturnahe Gestaltung
-
Ziel 1.C: Eine der Öffentlichkeit möglichst zugängliche Umgebung
-
Ziel 1.D: Die Wahrung (und möglichst Aufwertung) der landschaftlichen Werte
Besiedlung
Das nähere Projektumfeld tritt als wenig besiedelte Kulturlandschaft in Erscheinung. Zwischen dem Projektperimeter und der Siedlung Windlach liegen einige Bauernhöfe (vgl. Fig. 3‑1).
Einsehbarkeit
Aufgrund des eher offenen Charakters des Dorfbachtals und des Rütifelds mit leichter Neigung gegen Norden zum Rheintal ist der Projektperimeter von Norden, Osten und Süden auch von entfernteren Standorten teilweise gut einsehbar. Die umliegenden Hänge und Wälder des Ämpergs bilden nach Westen und Nordwesten eine wirksame Abschirmung. Auch vom Dorfbachtal selbst, dem Rütifeld sowie den beiden Anhöhen im Osten (Chatzenstig und Strassberg) mit ihren Aussichtspunkten, Wander- und Erschliessungswegen kann der Projektperimeter teilwiese gut eingesehen werden. Dasselbe gilt für die Einsehbarkeit des Projektperimeters vom Siedlungsgebiet Windlach her sowie den davor vorhandenen Liegenschaften «Bäumler».
Zwischen Chatzenstig, Strassberg und Neerach ist ein BLN-Objekt Nr. 1404 «Glaziallandschaft zwischen Neerach und Glattfelden» inventarisiert (vgl. Fig. 5‑20; BAFU 2015b). Das nördliche Ende dieses BLN-Objekts liegt hinter der Verbindungsstrasse K 348 («Kiesstrasse») und damit rund 600 m östlich des Projektperimeters. In 1.7 km nördlicher Distanz zum Projektperimeter befindet sich weiter das BLN-Objekt Nr. 1411 «Untersee – Hochrhein» (BAFU 2017b), welches sich entlang des Hochrheins von Kreuzlingen bis zum Kraftwerk Eglisau-Glattfelden erstreckt.
Der Anlagenperimeter tangiert keine kantonalen Landschaftsschutzgebiete (vgl. Fig. 5‑20). Gemäss kantonalem Inventar der Landschaftsschutzobjekte grenzt die «Kulturerbelandschaft Ämperg» (Objekt Nr. 6005; ARE Kanton ZH 2019) direkt nördlich und westlich an den Anlagenperimeter an, der Eingliederungssaum überschneidet sich in diesem Bereich mit dem Objektperimeter (vgl. Fig. 5‑20). Das Inventar benennt die gute Erholungseignung dieses Gebiets durch zahlreiche Wege und mehrere Wanderwege (vgl. Fig. 5‑21). Zudem gibt es mehrere Aussichtspunkte, die durch «zahlreiche überirdisch erhaltene Kulturrelikte im Gelände (v.a. in der vegetationslosen Zeitperiode) gut sichtbar sind und problemlos erwandert werden können». So ist auch der Verweis auf die «grosse Zahl von Nutzungsspuren aus vergangenen Zeiten sowie deren Qualität» zu verstehen. Der Erhalt der oberirdisch sichtbaren Kulturrelikte wird als ein allgemeines Schutzziel genannt.
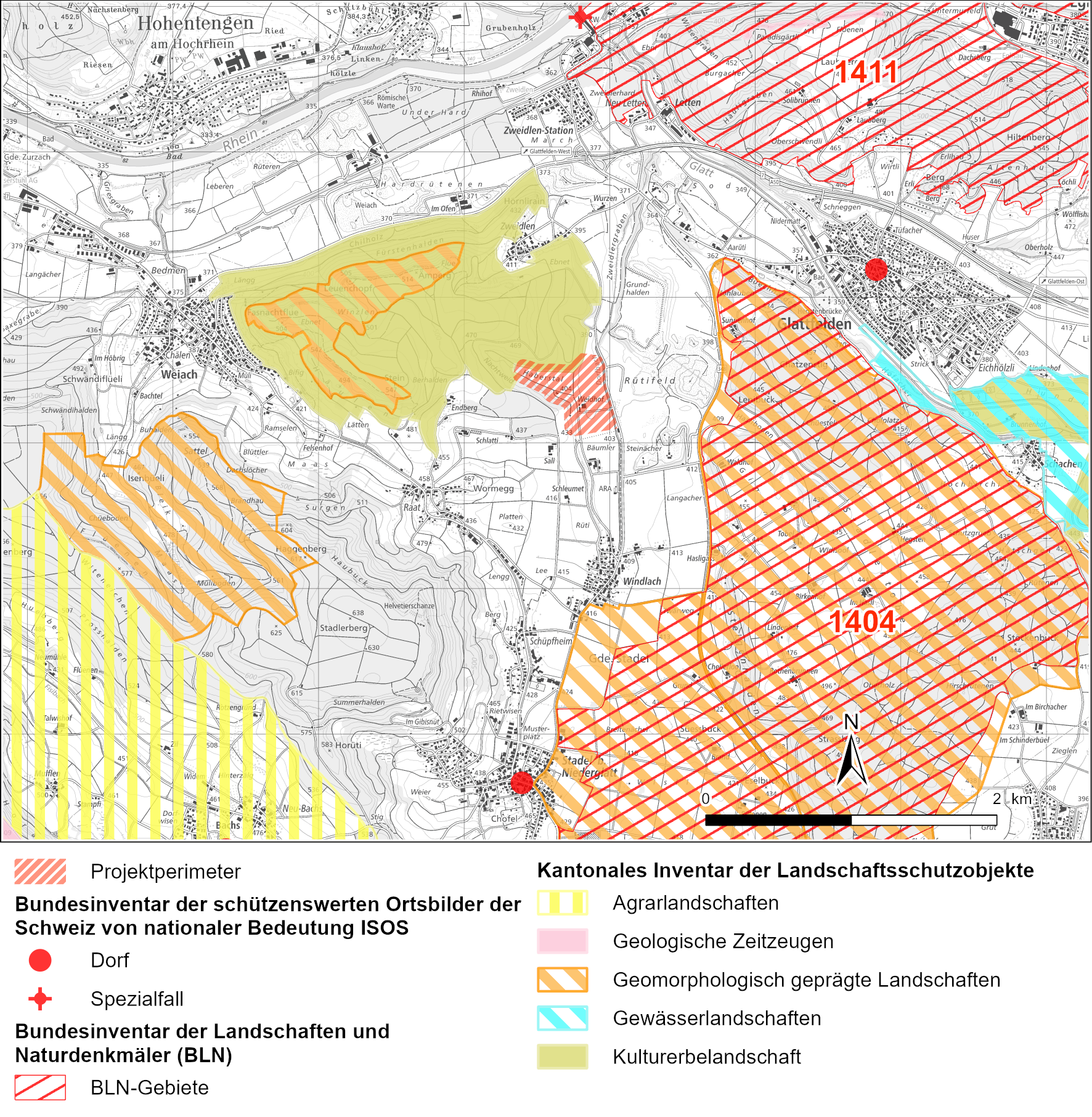
Fig. 5‑20:Landschaftsschutzgebiete und -inventare im Umkreis des Projektperimeters (GIS-ZH 2024)
Im Natur- und Landschaftsschutzinventar 1980 des Kantons Zürich sind die rund 1 km nord-westlich des Anlagenperimeters liegenden Felsaufschlüssen am Leuenchopf und Fürstenhalden am Ämperg als geomorphologisches Objekt von überkommunaler Bedeutung bezeichnet (ALN Kanton ZH 1979a). Weiter ist dort der rund 700 m nordwestlich liegende Steinbruch Zweidlen als geomorphologisches Objekt (ALN Kanton ZH 1979b) aufgeführt. Landschaftsfördergebiete zur langfristigen Erhaltung und Förderung von Eigenart, Vielfalt, Natürlichkeit und Erholungswert eines Gebiets nach kantonalem Richtplan sind im Projektperimeter nicht verzeichnet.
Am Nordende des Kiesabbaugebiets Rütifeld sind zwei Kiesbiotope von regionaler Bedeutung bezeichnet (ALN Kanton ZH 1979b). Trotz heute fehlender rechtlicher Bedeutung dokumentiert die Aufnahme ins Inventar den Stellenwert dieser Landschaftselemente.
Das nächstgelegene, im Bundesinventar der schützenwerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) aufgenommene Objekt ist die Ortschaft Stadel (ISOS Nr. 5694; BAK 2012a). Gemäss kantonalem Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder kommt dem Dorf regionale Bedeutung zu. Weiter ist das Kraftwerk Eglisau-Glattfelden im ISOS als Spezialfall aufgenommen (ISOS Nr. 6202; BAK 2012b). Beide Objekte weisen eine Entfernung von > 2 km zum Projektperimeter auf.
Das Gebiet um Windlach, Raat und Zweidlen mit den umliegenden Anhöhen stellt für die lokale Bevölkerung ein Erholungsgebiet dar und ist entsprechend von Wanderwegen und Velorouten durchzogen (vgl. Fig. 5‑21).
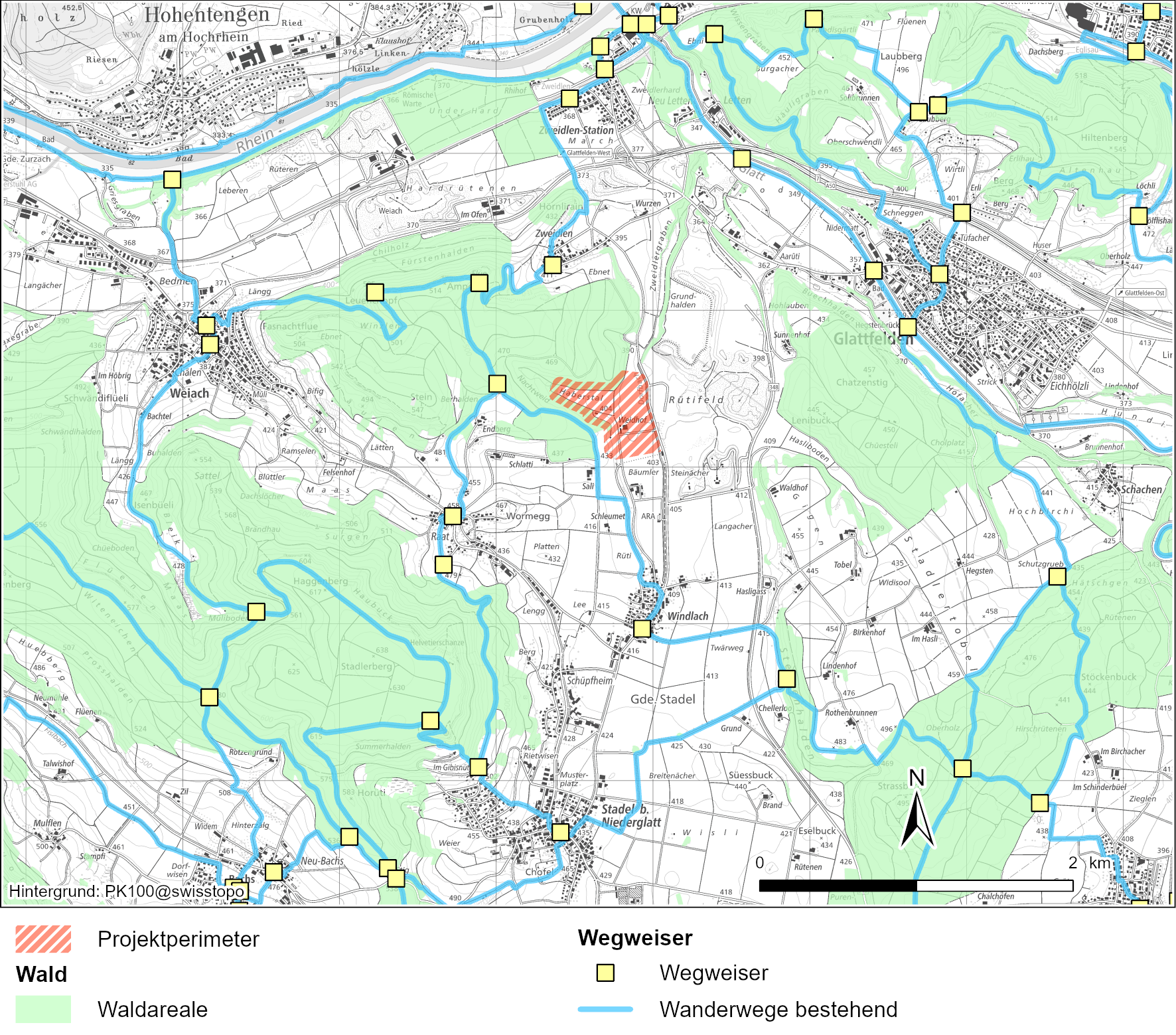
Fig. 5‑21:Wanderwege entlang des Anlagenperimeters (GIS-ZH 2024)
Ein Wanderweg mit lokaler Bedeutung führt auf der Südseite des Ämpergs nahe der Südwestgrenze des Projektperimeters vorbei nach Windlach und weiter zum Strassberg. Im Talkorridor südlich des Ämpergs führt in rund 1 km zum Projektperimeter die Veloroute Nr. 1562 von Weiach via Raat nach Stadel und Neerach (GIS-ZH 2024). Entlang der Glattfelderstrasse (HSV7) rund 1.1 km nördlich des Projektperimeters verläuft die national bedeutende Veloroute Nr. 2 Rheinroute mit Verbindung nach Glattfelden (swisstopo 2024). Von beiden Routen besteht keine direkte Sichtverbindung zum Projektperimeter. Der Ämperg sowie die östlich des Rütifeldes gelegenen Anhöhen des Chatzenstigs und des Strassbergs weisen einige Aussichtspunkte auf und bieten Weitblick auf das Alpenpanorama und in die Rheinebene. Das Gebiet Rütifeld im Talgrund hat aufgrund des Kiesabbaus für die Erholungsnutzung keine Bedeutung.
Landschaft
Die Landschaft des bisher offenen Dorfbachtals und des angrenzenden Rütifelds wird bereits ab der Bauphase eine Veränderung erfahren und von den neuen anthropogenen Siedlungselementen geprägt werden.
Der Anlagenperimeter wird mit einem Eingliederungssaum umfasst (vgl. Fig. 4‑1), um das Dorfbachtal zum sich langsam einschneidenden Zweidlergraben und östlich leicht aufsteigenden Rütifeld nicht visuell und funktional abzuriegeln. Dadurch wird die räumliche Erscheinung des Dorfbachtals neu definiert. Mit geeigneten Eingliederungsmassnahmen inkl. Bepflanzung innerhalb des Eingliederungssaums (vgl. Kap. 4.1.2.2) kann die Anlage gegen Süden visuell eingebunden, jedoch nicht «versteckt» werden.
Besonders vor und während der Erstellung des Eingliederungssaums werden die Beeinträchtigungen visuell und akustisch deutlich sein (vgl. Kap. 4.1.2). Licht- und Lärmemissionen werden den Landschaftsraum während der Bauphase in seiner Funktion als Kultur- und Erholungslandschaft beeinträchtigen. Betroffen davon sind der offene Talgrund des Windlacherfelds und des Dorfbachtals, wie auch den seitlichen Haberstal und die direkt angrenzende Wald- und Erholungslandschaft (Kulturerbelandschaft Ämperg).
Bei der Erstellung des Eingliederungssaums sind keine Eingriffe in das geomorphologische Objekt vorgesehen. Eingriffe in Elemente der Kulturerbelandschaft Ämperg sind nur im Bereich des Eingliederungssaums (Freihaltung) zu erwarten (vgl. Fig. 5‑20).
Bezüglich der Einsehbarkeit wurde eine entsprechende Sichtbarkeitsanalyse erstellt, welche v.a. den Betriebszustand abbildet (vgl. Kap. 5.17.5.2 und Beilage A10).
Die Landschaftsveränderung am Standort Haberstal wird von entsprechenden Aussichtsbereichen im BLN-Objekts Nr. 1404 östlich des Rütifelds erkennbar sein (anthropogene Nutzungsspuren durch bauliche Eingriffe, Lärm- und Lichtemissionen). Die Schutzziele des BLN-Objekts selbst werden durch das Vorhaben indes nicht beeinträchtigt. Dasselbe gilt für die Schutzziele des BLN-Objekts Nr. 1411 (Untersee – Hochrhein).
Erholung
Die Wegverbindung (Feldweg) zwischen der Schiessanlage Stadel-Windlach und dem unteren Dorfbachtal, welche heute neben der Nutzung für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebiets auch als Spazier- und Veloweg genutzte wird, wird infolge der Umgestaltung des Projektperimeters voraussichtlich in den Eingliederungssaum verlegt und so den Anlagenperimeter umlaufen. Im Bereich der Arealzufahrten werden sich die beiden Verkehrsträger kreuzen. Für das Baugesuch (UVB 2. Stufe) werden die entsprechenden gestalterischen Massnahmen dazu ausgearbeitet. Auf den ebenfalls zur Erholung genutzten Wegen im Wald um den Haberstal werden Beeinträchtigungen durch Lärm- und Lichtimmissionen bemerkbar sein. Massnahmen zur Reduktion der Beeinträchtigungen sind im UVB 2. Stufe darzulegen und zu beurteilen.
Lichtimmissionen
Grundsätzlich finden die Bauarbeiten tagsüber statt. In Ausnahmefällen werden Nachtarbeiten ausgeführt (vgl. Kap. 4.2.4).
Für den UVB 2. Stufe wird ein Beleuchtungskonzept für die Bauphase ausgearbeitet, in dem der Perimeter der Auswirkungen der Lichtimmissionen in der Umgebung und für die nachtaktive Fauna nachvollziehbar dargelegt wird. Die Auswirkungen werden gemäss den geltenden Richtlinien (SIA 2013) konzipiert und entsprechend umgesetzt.
Aufgrund des heute offenen Talcharakters wird die Landschaft durch die Anlagen im Anlagenperimeter eine langfristige Veränderung erfahren, welche auch in der entfernteren Umgebung (BLN-Objekt Nr. 1404) sichtbar sein wird (vgl. Kap. 5.17.5.1; die Aussagen zur Bauphase gelten gleichermassen). Der Anlagenperimeter wird in Phase 1 mit einem Eingliederungssaum in die Landschaft eingepasst, wodurch dieser zwar weniger einsehbar sein wird, jedoch die landschaftlichen Beeinträchtigungen nicht vollständig aufgegriffen werden können.
Aus Sicherheitsgründen wird der Anlagenperimeter voraussichtlich jederzeit ausleuchtbar sein, jedoch nicht ständig voll beleuchtet (vgl. Kap. 4.2.5). Die Beleuchtungsanlage wird in erster Linie nach den Vorgaben der sicherheits- und sicherungstechnischen Anforderungen einer Kernanlage sowie der Arbeitssicherheit ausgelegt und wird zudem auf die Anordnung der Gebäude, der Zu-/Aus- und Eingänge sowie die Nutzung der Aussenflächen abgestimmt. Die Beleuchtung des Anlagenperimeters ist im Sinne der Vorsorge gemäss Art. 11 Abs. 2 USG zu begrenzen und in einem Beleuchtungskonzept für die Betriebsphase darzulegen. Beim Erstellen des Beleuchtungskonzepts (für den UVB 2. Stufe) werden – insbesondere wegen der Waldnähe – Grundsätze zur Reduktion und Vermeidung von unnötigen Lichtemissionen (z. B. gemäss BAFU 2021b) berücksichtigt, soweit dies betrieblich und sicherheitstechnisch möglich ist.
Zur Beurteilung der Einsehbarkeit der Anlagen wurde eine GIS-gestützte (theoretische) Sichtbarkeitsanalyse durchgeführt (vgl. Beilage A10). Sie untersucht die Sichtbarkeit von Schachtkopfanlagen mit einer Höhe von 35 m resp. 45 m an 3 repräsentativen Standorten im Anlagenperimeter (vgl. Fig. 5‑22) und beurteilt diese jeweils in Bezug auf den Nah- (bis 2.5 km Luftlinie), den Mittel- (bis 5 km Luftlinie) und den Fernbereich (bis 10 km Luftlinie; vgl. Fig. 5‑23). Diese drei Schachtkopfanlagen sind die höchsten Bauwerke der OFA. Alle weiteren Bauwerke werden weniger hoch und damit weniger weit sichtbar sein. Mit der Variation der Maximalhöhe wird zudem veranschaulicht, in welchen Gebieten nur die obersten 10 m der Schachtkopfanlagen (Turmspitze) zu sehen sind. Die theoretischen Grundlagen sowie sämtliche Auswertungen sind in Beilage A10 zu finden.
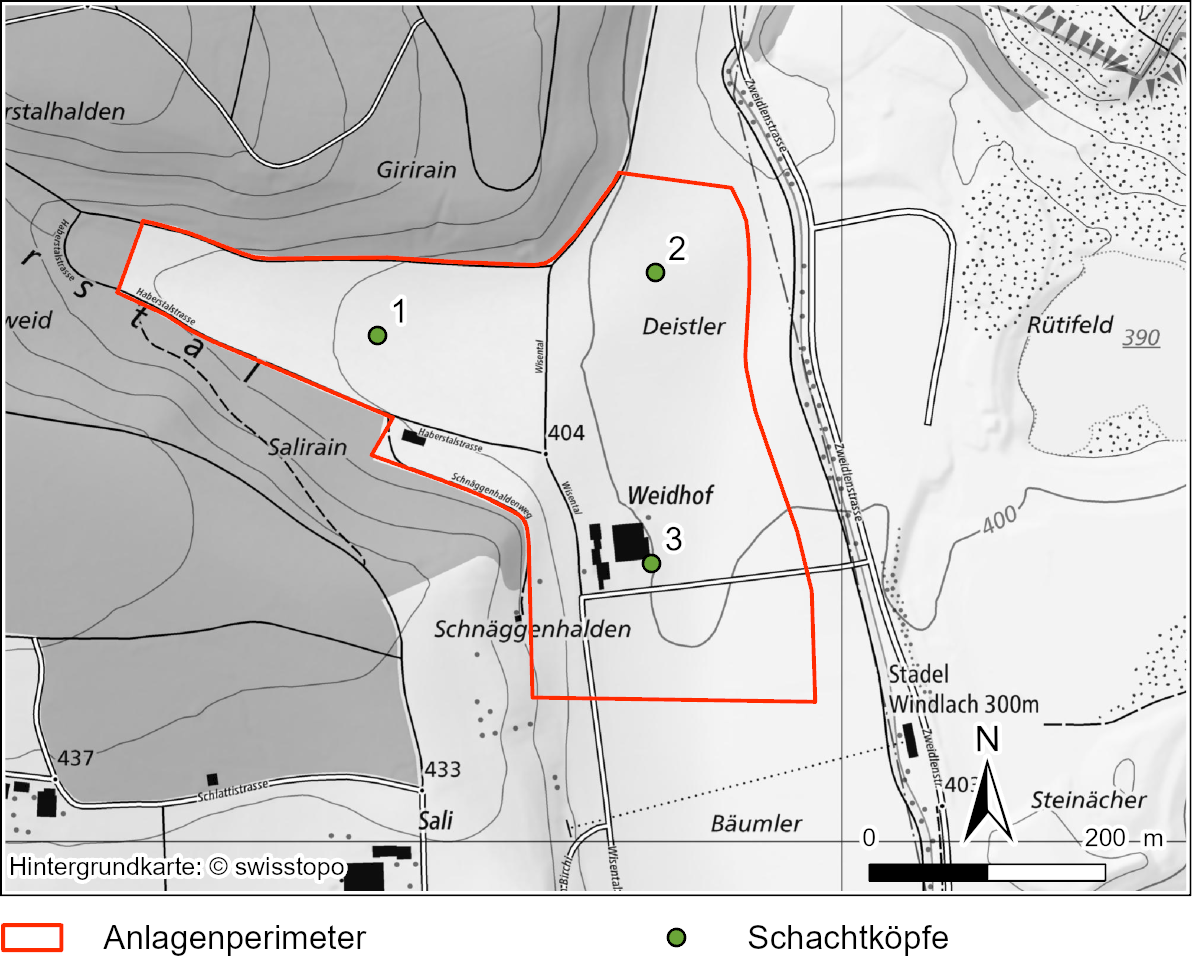
Fig. 5‑22:Für die Analyse gewählte repräsentative Standorte der exemplarischen Schachtkopfanlagen innerhalb des Anlageperimeters
Die Schachtkopfanlagen sind von westlichen Betrachtungsorten aufgrund der topographischen Abschirmung durch den Ämperg generell nicht sichtbar (vgl. Fig. 5‑23). Von östlichen und südlichen Betrachtungsorten sind die Schachtkopfanlagen im Nahbereich (bis 2.5 km) einsehbar, wobei aus dieser Richtung meist zwei oder drei Objekte sichtbar sind (blaue resp. dunkelblaue Einfärbung in Fig. 5‑23). Aus südlichen, nördlichen und östlichen Bereichen sind von einzelnen erhöht liegenden Standorten aus ein oder zwei Schachtkopfanlagen sichtbar. Aus nördlichen Sichtbereichen (Mittel- und Fernbereich) treten die Anlagen nur von den Südhängen oberhalb von Hüntwangen und Wasterkingen in Erscheinung (oft bewaldete Bereiche). Aus den übrigen nördlichen Gebieten wie Eglisau und Rafz bis zum Rhein sowie in den Siedlungsgebieten der grenznahen Ortschaften Deutschlands (Küssnach, Hohentengen a. H., Griessen, Bühl, Dettighofen, Baltersweil und Lottstetten) werden die Anlagen nicht sichtbar sein.
Die Schachtkopfanlage 1 im Haberstal (vgl. Fig. 5‑22) ist nur aus östlicher Richtung sichtbar, denn in der Nord-Süd-Sichtachse ist sie durch den Taleinschnitt topographisch weitgehend abgeschirmt. Der vorgesehene Eingliederungssaum kann v.a. in dieser Sichtachse für die Schachtkopfanlagen im Dorfbachtal (Schachtkopfanlagen 2 und 3, vgl. Fig. 5‑23) dazu beitragen, die Anlagen visuell einzubinden. Aufgrund der Höhe der Schachtkopfanlagen vermag der Eingliederungssaum diese jedoch nicht zu verdecken.
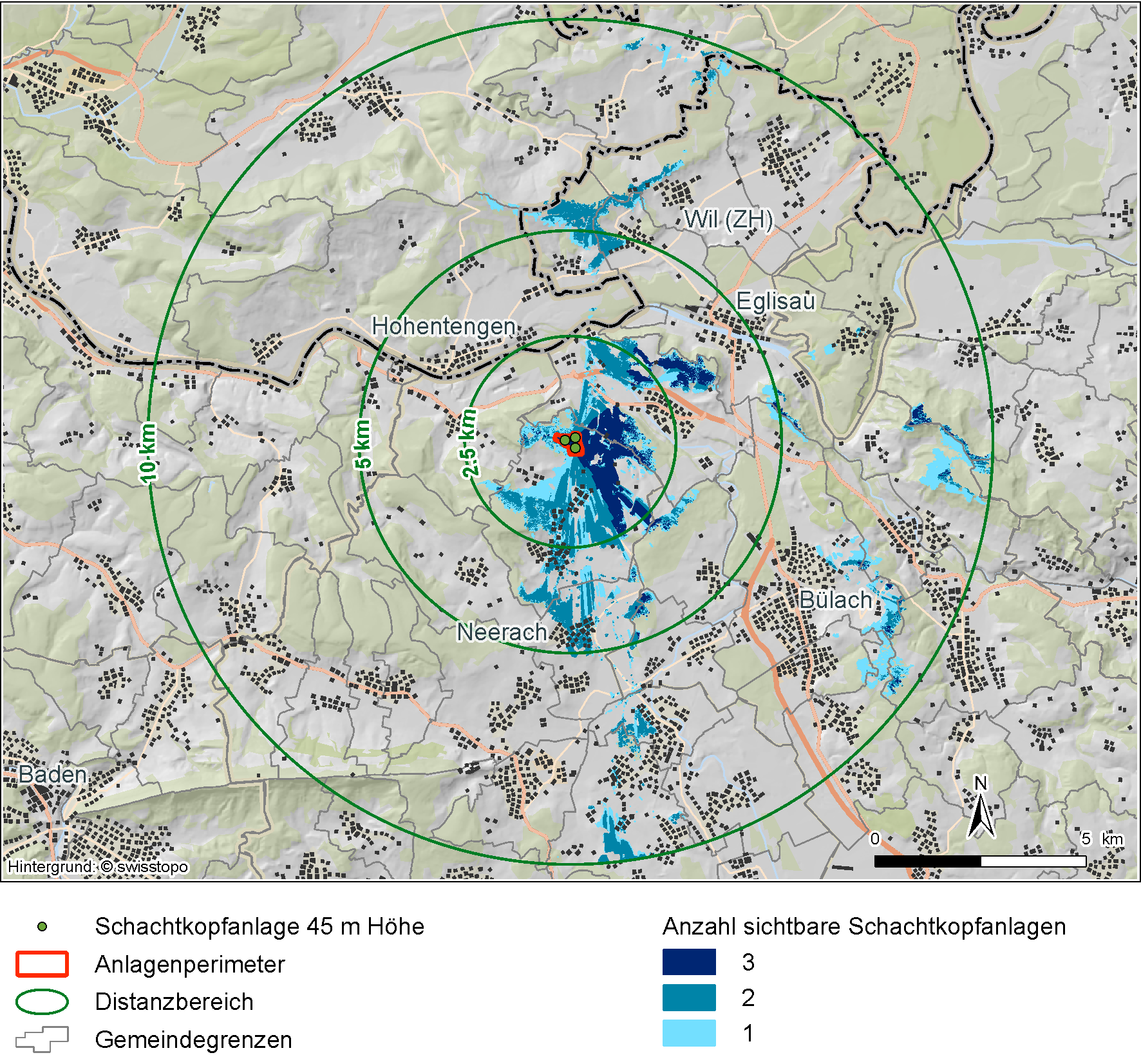
Fig. 5‑23:Theoretische Sichtbarkeit von drei exemplarischen innerhalb des Anlagenperimeters platzierten Schachtkopfanlagen mit 45 m Höhe im Nah-, Mittel- und Fernbereich
Die prognostizierten Sichtbarkeiten dürften mit der angewendeten Methode in allen Distanzbereichen tendenziell überschätzt werden und können daher als konservativ ermittelt angesehen werden. Im Mittel- und insbesondere im Fernbereich wird die prognostizierte Sichtbarkeit schon witterungsbedingt (Dunst, Nebel, Wolken) eher überschätzt. Eine allfällige Beleuchtung der OFA wird die Sichtbarkeit bei Dunkelheit für alle Bereiche tendenziell erhöhen. Für das Bauvorhaben werden geeignete Schutz- und Gestaltungsmassnahmen ausgearbeitet und die Auswirkungen auf die Umwelt (Landschaft, Erholung) werden im UVB 2. Stufe beurteilt.
Die Landschaft des bisher offenen Dorfbachtals / Windlacherfelds wird eine spürbare, langfristige Veränderung hin zu einer anthropogen- und siedlungsgeprägten Kulturlandlandschaft mit Industriebauten erfahren. Zur Reduzierung der Landschaftseingriffe kommen der Platzierung – welche aufgrund von Anforderungen an Sicherheit, Sicherung sowie einen zweckmässigen Betrieb erfolgt – und Ausgestaltung der Bauten und Anlagen sowie dem Eingliederungssaum eine hohe Bedeutung zu. Wirkungsvolle Gestaltungs- und Eingliederungsmassnahmen sind in den folgenden Planungs- und Projektierungsphasen vorzusehen. Diese Massnahmen sollen weitgehend im Rahmen der Bauphase (Phasen 1 und 3) umgesetzt werden. Bis zum Rückbau bleibt der Zustand mit den im Eingliederungssaum eingebetteten Bauten im Anlagenperimeter weitgehend unverändert.
Insgesamt werden die Auswirkungen unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, als tragbar beurteilt. Das Vorhaben kann aus Sicht «Landschaft und Ortsbild» umweltverträglich realisiert werden (keine direkte Beeinträchtigung von Schutzzielen ausgewiesener Schutzperimeter).
|
PH-HU2 Lan 01 |
Gestaltungskonzept Die Landschaftseingliederung und die Massnahmen zum Schutz des Landschafts- und Ortsbilds (inkl. Beleuchtung) sind zu detaillieren (inkl. Visualisierungen). Bauten und Anlagen sowie die zugehörige Infrastrukur werden bezüglich ihrer räumlichen und gestalterischen Einbindung in Landschaft und Ortsbild beschrieben, beurteilt und bewertet. |
|
PH-HU2 Lan 02 |
Landschaftschutz Die zum Schutz der Landschaft vorgesehenen Massnahmen werden dargelegt und allfällige gesetzlich erforderliche Ersatzmassnahmen definiert, unter Berücksichtigung der derzeit noch nicht bekannten Standorte der Schachtkopfanlagen und der übrigen Anlagen. |
|
PH HU2 Lan 03 |
Aufzeigen der Aufrechterhaltung der Langsamverkehrsverbindungen während der Bauphase Es wird aufgezeigt, wie Langsamverkehrsverbindungen während der Bauphase sichergestellt werden. |
|
PH HU2 Lan 04 |
Beleuchtungskonzept und Beurteilung Lichtimmissionen (Bau- und Betriebsphase) Für die Bau- und Betriebsphase wird ein Beleuchtungskonzept mit spezifischen Angaben für alle neuen Aussenbeleuchtungsanlagen erstellt. Im Konzept ist der Perimeter der Auswirkungen durch Lichtimmissionen auf die Umgebung und die nachtaktive Fauna nachvollziehbar darzulegen. Bei Bedarf werden geeignete Schutzmassnahmen ausgearbeitet. |
Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz vom 14. April 2010, Stand 1. Juni 2017, SR 451.13 (VIVS)
Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Denkmäler vom 10. August 1977, Stand 1. Juni 2017, SR 451.11 (VBLN)
Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, vom 9. September 1981, Stand 1. Mai 2024, SR 451.12 (VISOS)
GIS des Bundes: Bundesinventar der historischen Verkehrswege (IVS; swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN; swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung (KGS; swisstopo 2024)
GIS des Kantons Zürich: Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte (GIS-ZH 2024)
GIS des Kantons Zürich: Kantonale und kommunale Inventare der Kulturobjekte, (GIS-ZH 2024)
GIS des Kantons Zürich: Kantonales Inventar der Landschaftsschutzobjekte, Objekt 6005, Kulturerbelandschaft Ämperg (GIS-ZH 2024)
Die Voruntersuchung enthält keine Punkte im Pflichtenheft der UVP 1. Stufe zum Umweltbereich «Kulturdenkmäler und archäologische Stätten».
In den Stellungnahmen sind keine Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Östlich des Anlagenperimeters ist die Zweidlenstrasse als lokal bedeutender Weg (ZH 956; Kanton Zürich 1999c) mit historischem Verlauf im Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) aufgenommen. Von diesem Weg führt ein weiterer inventarisierter Abschnitt von Zweidlen-Dorf in Richtung Ämperg (ZH 955 und ZH 954, vgl. Fig. 5‑24 resp. Kanton Zürich 1999a und Kanton Zürich 1999b). Weiter ist der Weg von Weiach über Raat nach Windlach als Weg von regionaler Bedeutung mit historischem Verlauf verzeichnet. Er weist abschnittsweise viel Substanz auf. Als Zusatzinformation im Bundesinventar ist zudem ein historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung registriert (nicht im Inventar aufgenommen), welcher von Weiach quer durch die Ebene nach Zweidlen-Station verläuft (vgl. Fig. 5‑24). Infolge des Kiesabbaus und der Verlegung der Glattfelderstrasse besteht dieser Weg heute nur noch als Reststrecke bei der Liegenschaft «Im Ofen». Die ganze ehemalige Wegverbindung liegt jedoch abseits des Projektperimeters und wird vom Projekt daher nicht tangiert.
Im Bereich des Projektperimeters sind keine geschützten Kulturobjekte verzeichnet.
Nördlich von Zweidlen-Station, rund 2.2 km nördlich des Projektperimeters wurden neben dem Kraftwerk Eglisau-Glattfelden Spuren einer spätrömischen Rheinbefestigung ins Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung aufgenommen (Objekt Nr. 11673; swisstopo 2024).
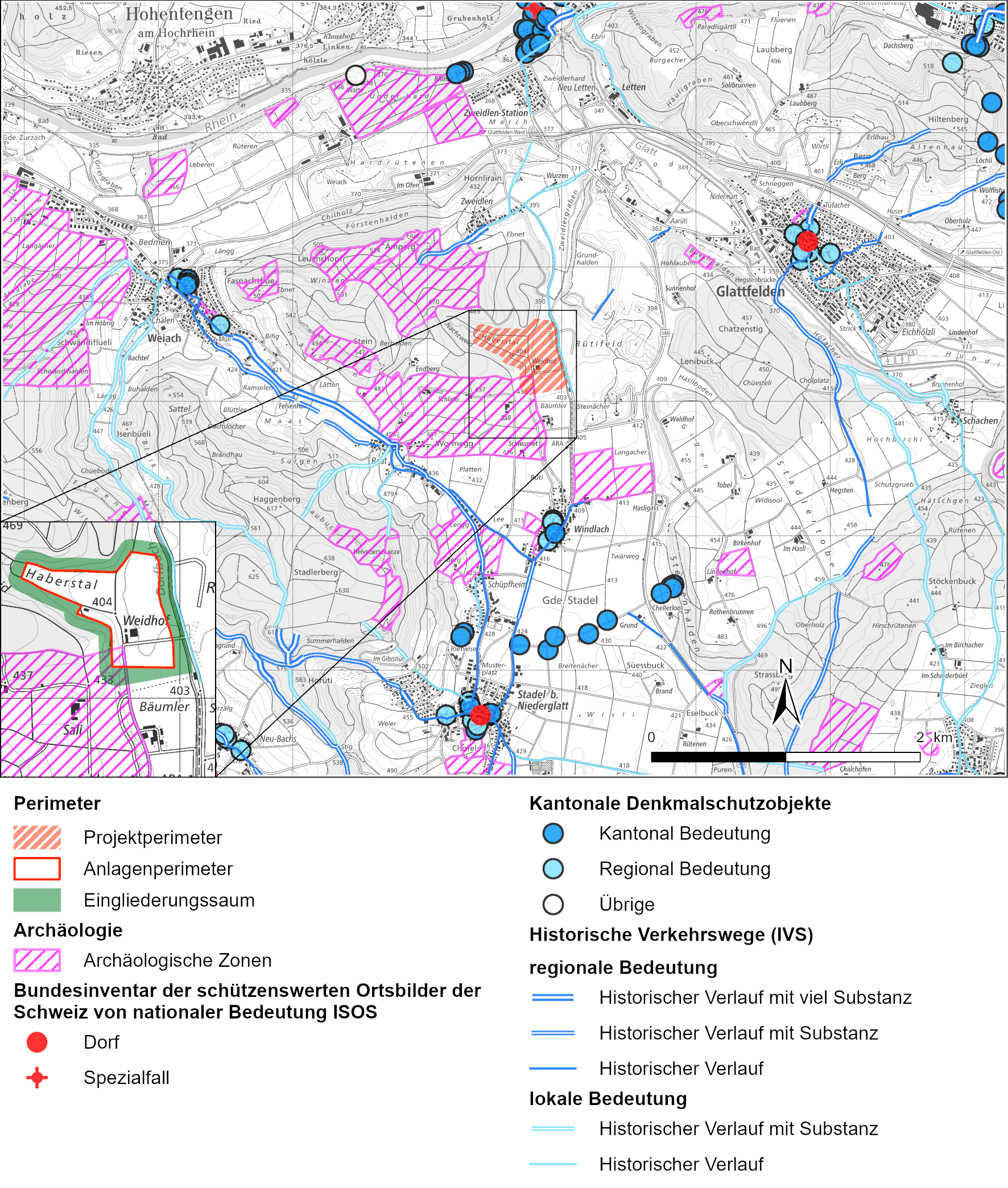
Fig. 5‑24:Karten der Archäologische Zonen und Denkmalschutzobjekte inkl. Inventar historischer Verkehrswege in der Schweiz (IVS, GIS-ZH 2024)
Südwestlich des Weidhofs beginnt die archäologische Zone «Stadel» (Zonen-Nr. 13.0, vgl. Fig. 5‑24). Beim Bau der Gasleitung (vgl. Fig. 5‑15), welche diese archäologische Zone quert, wurden innerhalb der archäologischen Zone Kulturschichten sowie Tonscherben aus der Bronzezeit angetroffen. Die nordöstliche Ecke der Zone überschneidet sich im Bereich der Schnäggenhalden sowohl mit dem Eingliederungssaum als auch mit dem Anlagenperimeter.
Auf das kantonale Landschaftsschutzobjekt «Kulturerbelandschaft Ämperg» wird in Kap. 5.17 eingegangen.
Das Vorhaben beeinträchtigt keine Denkmalschutzobjekte. Die vorhandenen historischen Verkehrswege von regionaler Bedeutung in Windlach und Zweidlen werden nicht verändert und nicht tangiert.
Insgesamt werden durch die Arbeiten im Anlagenperimeter sowie im Eingliederungssaum ca. 1.4 ha der archäologischen Zone «Stadel» (Zonen-Nr. 13.0) tangiert. Es kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass bei den Bodeneingriffen noch unerkannte archäologische Hinterlassenschaften angetroffen werden. Vor Beginn allfälliger Grabarbeiten in diesem Bereich sind der Kantonsarchäologie die Bodenarbeiten innerhalb der archäologischen Zone zu melden. Im Falle von Funden werden die Bauarbeiten dort unterbrochen, so dass die archäologischen Fundstücke oder Strukturen fachgerecht untersucht werden können.
In der Betriebsphase sind in den tangierten Bereichen keine baulichen Anpassungen vorgesehen. Entsprechend werden keine Kulturdenkmäler oder archäologischen Stätten tangiert.
Durch das Vorhaben werden keine Kulturdenkmäler tangiert. Auf das kantonale Landschaftsschutzobjekt «Kulturerbelandschaft Ämperg» wird in Kap. 5.17 eingegangen.
Die archäologische Zone «Stadel» mit Funden aus der Bronzezeit wird durch bauliche Bodeneingriffe vom Vorhaben tangiert. Bei der Erarbeitung des UVB 2. Stufe ist die Kantonsarchäologie hinzuzuziehen. Während der Bauphase sind der Kantonsarchäologie die Erd- und Grabarbeiten innerhalb der archäologischen Zone vor Beginn zu melden. Falls während den Erdbauarbeiten archäologische Funde auftreten, sind die entsprechenden Massnahmen nach deren Auffindung zu treffen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierte Massnahme umgesetzt wird, können die Anforderungen aus Sicht «Kulturdenkmäler / archäologische Stätten» eingehalten werden und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 Kul 01 |
Einbezug der Kantonsarchäologie Bei der Erarbeitung des UVB 2. Stufe wird die Kantonsarchäologie hinzugezogen. |
