
5. Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (NTB 24-14)
Für die Umweltbetrachtungen werden für die folgenden zwei Phasen mit den genannten Hauptaktivitäten (vgl. Kap. 4.3) näher betrachtet:
-
Bauphase: Materialtransporte und Bautätigkeiten
-
Betriebsphase: Transporte und Tätigkeiten in der Betriebsphase
Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die Einschätzung der Relevanz der einzelnen, in den folgenden Kapiteln behandelten Umweltbereiche gemäss UVP-Handbuch (BAFU 2009) für die Bau- und Betriebsphase.
Tab. 5‑1:Relevanzmatrix
|
Umweltbereiche |
Bauphase |
Betriebsphase |
|
Luftreinhaltung |
● |
○ |
|
Lärm |
● |
● |
|
Erschütterungen / Körperschall |
● |
○ |
|
Nichtionisierende Strahlung |
○ |
● |
|
Grundwasser |
● |
● |
|
Oberflächengewässer inkl. aquatische Ökosysteme |
○ |
○ |
|
Entwässerung |
● |
● |
|
Boden |
● |
○ |
|
Altlasten |
○ |
○ |
|
Abfälle, umweltgefährdende Stoffe |
● |
○ |
|
Umweltgefährdende Organismen |
● |
● |
|
Störfallvorsorge (nicht nuklear) / Katastrophenschutz |
● |
● |
|
Wald |
● |
○ |
|
Flora, Fauna, Lebensräume |
● |
● |
|
Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen) |
● |
● |
|
Kulturdenkmäler, archäologische Stätten |
● |
○ |
Legende ○ keine resp. irrelevante Auswirkungen
● relevante Auswirkungen vorhanden resp. nicht auszuschliessen
Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985, Stand 1. Januar 2024, SR 814.318.142.1 (LRV)
Luftreinhaltung auf Baustellen. Richtlinie über betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen von Baustellen (Baurichtlinie Luft), Umwelt-Vollzug Nr. 0901, Ergänzte Ausgabe, Februar 2016 (BAFU 2016b)
Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten. Vollzug Umwelt VU 5021, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL (Leuenberger & Spittel 2001)
Handbuch Emissionsfaktoren für stationäre Quellen. Aktualisierte Fassung 2020, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL 2000)
Handbuch der Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs, V4.2 (INFRAS 2022)
Luftschadstoff-Emissionen des Strassenverkehrs 1990-2060, Stand 2024, Umwelt Wissen Nr. 2405 (BAFU 2024b).
Luftbelastung: Modelle und Szenarien, Konzentrationen der Luftschadstoffe Stickstoffdioxid, Russ und Feinstaub PM10 und PM2.5 (BAFU 2024a).
Karten von Jahreswerten der Luftbelastung in der Schweiz – Datengrundlagen, Berechnungsverfahren und Resultate bis zum Jahr 2022 (Künzle 2023).
GIS des Kantons Aargau: Verkehrszählungen (AGIS 2024).
|
PH-HU1 Luf 01 |
Massnahmenstufe Bauphase Festlegung der Massnahmenstufe während der Bauphase. |
|
PH-HU1 Luf 02 |
Beurteilung Luftbelastung Betriebsphase Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Luftsituation in der Betriebsphase. |
|
PH-HU1 Luf 03 |
Massnahmenstufe Rückbauphase Festlegung der Massnahmenstufe während der Rückbauphase. |
Der Rückbau der BEVA (und damit PH-HU1 Luf 03) wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grundsätzliche Erkenntnisse für den Umweltbereich «Luft» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Luf 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Gemäss Luftbelastungskarten des BAFU (BAFU 2024a) liegen die NO2- und PM10-Immissionen im Projektperimeter aktuell unter den gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwerten für das Jahresmittel (LRV 1985). Die NO2-Belastung liegt unter 20 mg/m3 (Grenzwert 30 mg/m3), die PM10-Belastung unter 15 mg/m3 (Grenzwert 20 mg/m3). Aufgrund der vom Bund getätigten Anstrengungen zur Luftreinhaltung ist davon auszugehen, dass die Luftschadstoffemissionen gesamtschweizerisch weiter zurückgehen werden. Das BAFU rechnet zudem beim Strassenverkehr zwischen 2020 und 2055 mit einem Rückgang der Emissionen von NOX um ca. 93 % und von PM10 (Abgas) um ca. 86 % (BAFU 2024b).
Der DTV auf der Hauptstrasse Nr. K442 zwischen Villigen und Böttstein beträgt ca. 5'100 Fahrzeuge pro 24 Stunden (Verkehrszählung; AGIS 2024), entsprechend können die durch den Verkehr induzierten Luftbelastungen (NO2 und PM10) aus der Umgebung als «gering» eingestuft werden. Auf der Forschungsstrasse (Erschliessungsstrasse) ist die Verkehrsbelastung noch geringer (keine Zähldaten verfügbar; ausgehend von der Anzahl Parkplätze von rund 1'000 Stück auf dem gesamten PSI- und Zwilag-Areal gemäss PSI (2022), maximal 2'500 Fahrten pro Tag).
Bei den bestehenden Anlagen des PSI und der Zwilag im näheren Umfeld des Projektperimeters handelt es sich nicht um Industrieanlagen mit hohen Luftschadstoffemissionen (wie z.B. Kehrichtverbrennungs- und Verwertungsanlagen)6.
Emissionen durch Bautätigkeiten und Bautransporte entstehen während der rund 5 Jahre dauernden Bauphase (vgl. Kap. 4.3) im gesamten Projektperimeter und entlang der Transportrouten.
Emissionen Baumaschinen und Geräte
Die Bauarbeiten sind mit Schadstoffemissionen verbunden, welche in der näheren Umgebung der Baustelle zu Luftschadstoffbelastungen führen können. Im vorliegenden Vorhaben werden v.a. Tätigkeiten im Tief- und Hochbau (z.B. Rückbauarbeiten bestehender Bauten und Anlagen, Erstellen und Betreiben von Baustelleneinrichtungen sowie Installationsplätzen und -pisten, Erdbewegungs- und Aushubarbeiten etc.) erwartet, welche Luftschadstoff-Emissionen und Staub verursachen.
Aufgrund der Grösse (> 1 ha, vgl. Tab. 4‑1) und der Dauer (> 1 Jahr; vgl. Kap. 4.3) der Baustelle sowie der bewegten Kubatur (> 20'000 m3 fest; vgl. Kap. 4.6.3) gilt die Massnahmenstufe B gemäss Baurichtlinie Luft (BAFU 2016b). Generell sind Maschinen und Geräte vorzusehen, die den jeweils aktuellen Vorgaben der LRV (1985) genügen. Staubimmissionen auf die Umgebung können durch geeignete und bewährte Massnahmen verhindert werden.
Emissionen Bautransporte
Neben den Bautätigkeiten können die erforderlichen Bautransporte entlang der Transportrouten zu Luftschadstoffbelastungen führen. Die Mengen von an- und abzuführendem Material für den Bau der BEVA (inkl. Rückbau bestehende Zwilag-Gebäude) sind zum heutigen Zeitpunkt erst grob bekannt (vgl. Kap. 4.6). Transportrouten in der näheren Umgebung des Projektperimeters sind bereits grösstenteils vorhanden (vgl. Fig. 4‑6). Angaben zu den Transportfahrzeugen, -routen und -mengen werden im UVB 2. Stufe beschrieben. Gemäss Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten (Leuenberger & Spittel 2001) handelt es sich vorliegend um eine «grosse Baustelle» (Bauarealfläche > 5'000 m2, Aushubvolumen > 20'000 m3). Grosse Baustellen gemäss Definition der Vollzugshilfe verursachen relevante Bautransport-Emissionen. Weiter setzt die Vollzugshilfe für grosse Baustellen Maximal‐ und Zielwerte bezüglich der spezifischen NOX‐, PM10 und CO2‐Emissionen für Schüttguttransporte (Emissionen pro m3 transportiertem Schüttmaterial) fest. Die Abschätzung und Beurteilung der spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte sowie allenfalls die Festlegung von Massnahmen erfolgt für den UVB 2. Stufe.
Während der Betriebsphase ist hauptsächlich mit Transporten von und zum gTL zu rechnen (vgl. Kap. 4.7.3.3). Diese Schwerlasttransporte erfolgen über die Strasse (vgl. Kap. 4.7.3) und verursachen einen vernachlässigbaren Anstieg des Gesamtverkehrsaufkommens (<1 %) zwischen der Insel Beznau (ZWIBEZ), Würenlingen (BEVA) und Stadel (gTL).
Am Projektperimeter finden während der Betriebsphase im Durchschnitt ca. 5 – 10 LKW-Fahrten und 40 – 60 PW-Fahrten pro Tag statt (d.h. weniger als 2 % des bestehenden Verkehrs auf der Kantonsstrasse Nr. K442). Durch diese geringfügige Erhöhung des Verkehrsaufkommens wird sich die verkehrsbedingte Luftbelastung nicht spürbar erhöhen. Für die Betriebsphase wird zum aktuellen Projektstand davon ausgegangen, dass keine weiteren Luftschadstoff-Emissionsquellen vorhanden sein werden. Dies ist im Rahmen des UVB 2. Stufe zu bestätigen.
Die grössten Emissionen sind aufgrund der Bautätigkeiten und Bautransporte während der Bauphase zu erwarten. Gemäss Beurteilungskriterien der Baurichtlinie Luft (BAFU 2016b) gilt die Massnahmenstufe B. Unter Berücksichtigung der entsprechenden Massnahmen, können die Auswirkungen auf ein umweltverträgliches Mass begrenzt werden.
Durch den Betrieb der BEVA wird sich das Verkehrsaufkommen zur BEVA, auf dem Projektperimeter sowie zwischen der BEVA und dem gTL geringfügig resp. hinsichtlich Luftschadstoffbelastung in nicht relevantem Masse erhöhen.
Für die Betriebsphase wird zum aktuellen Projektstand davon ausgegangen, dass keine weiteren Luftschadstoff-Emissionsquellen vorhanden sein werden. Dies ist im Rahmen des UVB 2. Stufe zu bestätigen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Luftreinhaltung» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Luf 01 |
Transportkonzept Für die Bau- und Betriebsphase werden Angaben zu Transportfahrzeugen, -routen und -mengen gemacht. |
|
PH-HU2 Luf 02 |
Spezifische Emissionen Schüttguttransporte in der Bauphase Die spezifischen Emissionen der Schüttguttransporte werden abgeschätzt und beurteilt. |
|
PH-HU2 Luf 03 |
Massnahmen Baustelle und Bautransporte Die auf den Baustellen und bei den Bautransporten umzusetzenden Massnahmen werden dargestellt (inkl. Massnahmen zu Staubemissionen) |
|
PH-HU2 Luf 04 |
Beurteilung Luftbelastung in der Betriebsphase Die Auswirkungen der Emissionsquellen im Projektperimeter auf die Luftsituation in der Betriebsphase werden beurteilt (ohne Berechnungen). |
Lärmschutzverordnung vom 15. Dezember 1986, Stand 1. November 2023, SR 814.14 (LSV)
Baulärm-Richtlinie. Richtlinie über bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des Baulärms gemäss Art. 6 LRV, Umwelt-Vollzug Nr. 0606, Stand 2011 (BAFU 2006)
Anwendungshilfe zur Baulärm-Richtlinie (Cercle Bruit 2005)
GIS des Bundes: Strassenverkehrslärm, BAFU (swisstopo 2024)
GIS des Kantons Aargau: Bauzonenplan (AGIS 2024)
|
PH-HU1 Lär 01 |
Massnahmenstufe Baulärm Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Bauphase. |
|
PH-HU1 Lär 02 |
Massnahmenstufe Bautransporte Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Bauphase. |
|
PH-HU1 Lär 03 |
Beurteilung Strassenverkehrslärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des projektbedingten Verkehrs auf die Strassenlärmsituation in der Betriebsphase. |
|
PH-HU1 Lär 04 |
Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm Berechnung und Beurteilung der Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase. |
|
PH-HU1 Lär 05 |
Massnahmenstufe Baulärm Rückbau Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bauarbeiten während der Rückbauphase. |
|
PH-HU1 Lär 06 |
Massnahmenstufe Bautransporte Rückbau Festlegung der Massnahmenstufe gemäss der Baulärm-Richtlinie für die Bautransporte während der Rückbauphase. |
Der Rückbau der BEVA (und damit PH-HU1 Lär 05 und 06) wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Lärm» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Lär 03 und 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU wird folgendermassen eingetreten:
-
Die Anträge 14 und 15 des BAFU werden im UVB 2. Stufe abgehandelt. Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend angepasst.
Der Projektperimeter liegt in einer Distanz von ca. 1.3 – 1.5 km zum Siedlungsgebiet (Dorfkerne Böttstein, Villigen und Würenlingen), isoliert zwischen der Aare und grossen Waldflächen in einer Arbeitszone II sowie auf einem heutigen Waldareal (vgl. Fig. 4‑2).
Die Arbeitszone II ist der Lärmempfindlichkeitsstufe IV zugewiesen (vgl. Fig. 5‑1). Bei den bestehenden Nutzungen des PSI und der Zwilag handelt es sich um sog. «nicht lärmintensive Betriebe».
Die Lärm-Immissionsgrenzwerte für Strassenverkehrslärm werden gemäss Lärmbelastungskarte des Bundes im Projektperimeter eingehalten (swisstopo 2024).
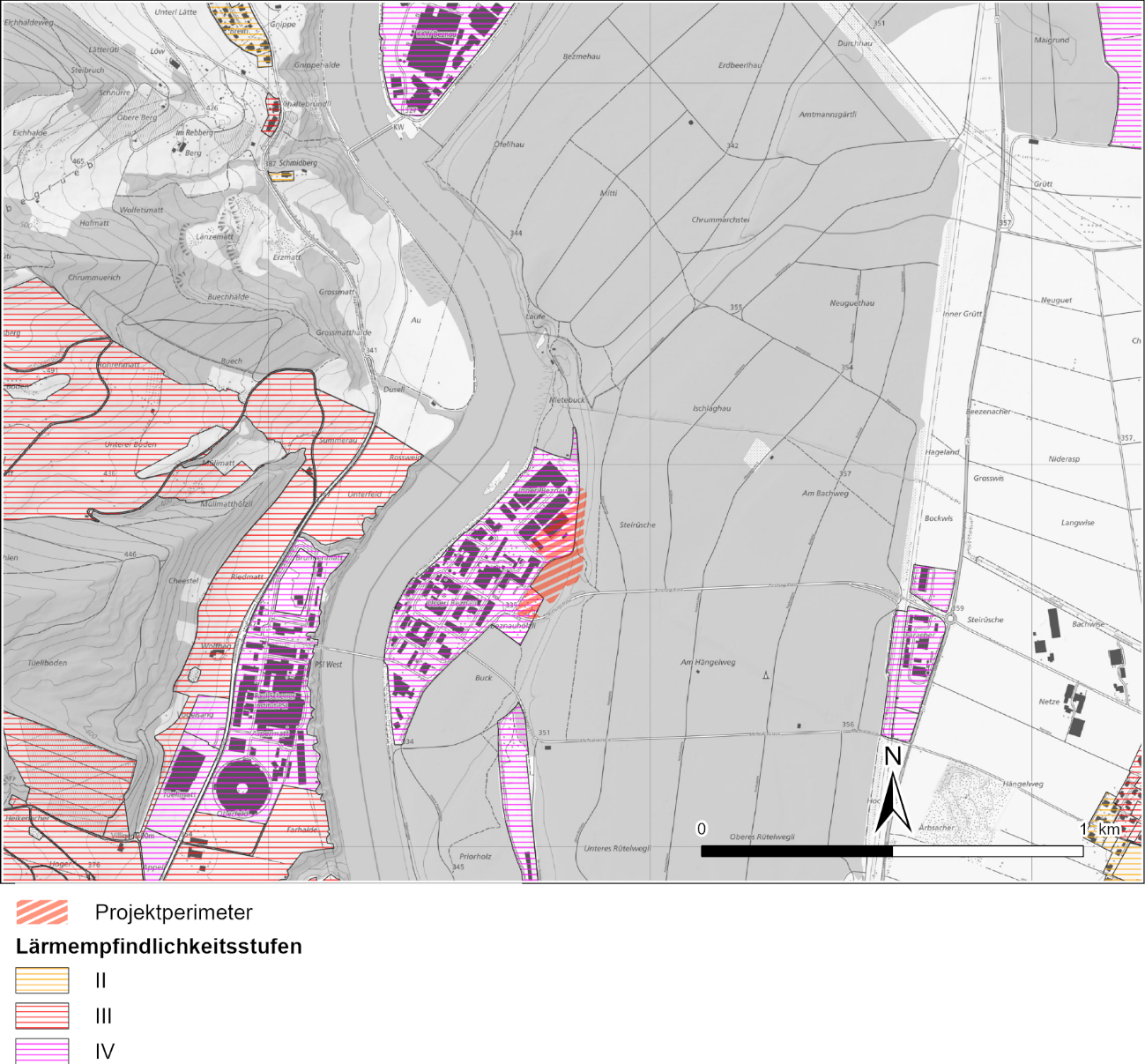
Fig. 5‑1:Lärmempfindlichkeitsstufen gemäss Richtplan (Kanton Aargau 2011)
Lärmemissionen durch Bauarbeiten sowie durch Bautransporte entstehen während der gesamten Bauphase, welche insgesamt rund 5 Jahre dauert (vgl. Kap. 4.3). Die Emissionen gehen vom gesamten Projektperimeter und den beschriebenen Transportrouten aus (vgl. Kap. 4.7.1).
Emissionen Baumaschinen und Geräte
Die mit den Bauarbeiten in Zusammenhang stehenden Lärmemissionen (Baumaschinen und Geräte, Materialumschlag, lärmintensive Tätigkeiten wie Abbruch) führen in der Umgebung zu zusätzlichen Lärmbelastungen. Die Beurteilung von Baulärm (Festlegen Massnahmenstufe) und die Ausarbeitung entsprechender Schutzmassnahmen werden gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie vorgenommen (BAFU 2006).
Grundsätzlich sind Massnahmen erforderlich, wenn:
-
sich Räume mit lärmempfindlicher Nutzung (hier v.a. Büroräume) in einem Abstand von ≤ 300 m zur Baustelle befinden resp. ≤ 600 m, falls Bauarbeiten in Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch (12 bis 13 Uhr und 19 bis 07 Uhr) stattfinden;
-
die «lärmige Bauphase» oder die «lärmintensiven Bauarbeiten» länger als 1 Woche dauern.
Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass die «lärmige Bauphase» mehr als 1 Jahr dauert (vgl. Kap. 4.3). Innerhalb von 300 m befinden sich das PSI Ost und die Zwilag mit lärmempfindlichen Nutzungen (Büroräumlichkeiten). Weitere lärmempfindliche Nutzungen innerhalb von 600 m befinden sich beim PSI West (z.B. Gästehaus). Für die Bauarbeiten gilt damit für die Zeit zwischen 07 bis 12 und 13 bis 19 Uhr die Massnahmenstufe A gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006). Für Bauarbeiten in den übrigen Zeiten sowie an Sonn- und Feiertagen werden die Massnahmen verschärft (Anwendung der nächsthöheren Massnahmenstufe). In der Bauphase wird von Arbeitszeiten gemäss Kap. 4.5.2 ausgegangen.
Bei den «lärmintensiven Bauarbeiten» (z.B. Abbruch, Fräsen, Rammarbeiten) wird angenommen, dass diese weniger als 1 Jahr dauern. Somit gelten die gleichen Massnahmenstufen wie oben.
Emissionen Bautransporte
Bautransporte (Materialtransporte) verursachen entlang der genutzten Transportrouten Lärmbelastungen (vgl. Fig. 4‑6).
Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Anzahl Bautransporte (LKW) während der rund 5 Jahre dauernden Bauzeit maximal 50 LKW-Fahrten pro Arbeitstag (Montag bis Samstag) resp. 300 LKW-Fahrten pro Woche Bauzeit beträgt (vgl. Kap. 4.7.3.1). Davon entfallen höchstens 10 % auf die Nachtperiode (22 – 06 Uhr), d.h. durchschnittlich maximal 30 LKW-Fahrten pro Woche Bauzeit. Unter der Voraussetzung, dass die Bautransporte über Hauptverkehrsstrassen erfolgt, gilt damit für die Bautransporte die Massnahmenstufe A6 gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006).
Schwellenwert Massnahmenstufe B: 940 Fahrten in der Tages- und 60 Fahrten pro Woche in der Nachtperiode ↩
Strassenverkehrslärm
In der Betriebsphase werden leere ELB/TB angeliefert, TLB vom ZWIBEZ über die Strasse zum Projektperimeter transportiert und ELBs in TBs zum gTL in Stadel transportiert (vgl. Kap. 4.7.3). Aus logistischen Gründen erfolgt der Transport über das Strassennetz. Die derzeit vorhandenen Transportrouten zwischen dem Projektperimeter und dem gTL führen teils durch Siedlungsgebiet (Nagra 2024c).
Grundsätzlich gilt, dass bei bestehenden Verkehrsanlagen der projektbedingte Verkehr keine zusätzlichen Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte zur Folge haben darf. Bei sanierungsbedürftigen Verkehrsanlagen (Immissionsgrenzwerte bereits überschritten) darf der Mehrverkehr keine wahrnehmbare Zunahme (Erhöhung um 1dB(A) oder mehr) verursachen.
Aufgrund der zu erwartenden Fahrten (vgl. Kap. 4.7.3) werden diese Anforderungen erfüllt.
Industrie- und Gewerbelärm
Die BEVA ist als neue ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 7 LSV zu betrachten. In der weiteren Projektplanung ist die Einhaltung der Planungswerte (abhängig von Betriebszeiten) nachzuweisen. Für den UVB 2. Stufe werden Lärmquellen innerhalb des Projektperimeters ermittelt und die Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms berechnet und beurteilt. Lärmemissionen werden wie vorgeschrieben begrenzt.
Lärmemissionen sind aufgrund der Bautätigkeiten und Bautransporte während der Bauphase zu erwarten (vgl. Kap. 4.3 und 4.5.1). Unter Berücksichtigung der Massnahmen gemäss Baulärm-Richtlinie (BAFU 2006) und des Einsatzes von emissionsarmen Baumaschinen, Bauverfahren und Transportfahrzeugen werden die Auswirkungen auf ein umweltverträgliches Mass begrenzt.
Durch den Betrieb der BEVA wird sich das Verkehrsaufkommen zum Projektperimeter, auf dem Areal der BEVA und zwischen der BEVA und dem gTL nur geringfügig resp. hinsichtlich Lärmbelastung in nicht relevantem Masse erhöhen (vgl. Kap. 5.2.5.2).
Der Betrieb der Anlage muss die Planungswerte gemäss LSV für Industrie- und Gewerbeanlagen einhalten. Der entsprechende Nachweis wird im Rahmen des UVB 2. Stufe erbracht.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Lärm» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Lär 01 |
Transporte (ohne Ausnahmetransporte) während Bau- und Betriebsphase Die Transportrouten werden unter Berücksichtigung von Siedlungsgebieten ausgewiesen und der zu erwartende Mehrverkehr dem vorhandenen Verkehr gegenübergestellt. |
|
PH-HU2 Lär 02 |
Massnahmen Baulärm (inkl. Bautransporte) Überprüfung und Festlegung der Massnahmenstufen sowie Aufzeigen der notwendigen Massnahmen gemäss Vorgaben der Baulärm-Richtlinie. |
|
PH-HU2 Lär 03 |
Beurteilung Industrie- und Gewerbelärm (Betriebsphase) Die Lärmquellen im Projektperimeter werden in einem Plan dargestellt und die jeweiligen Betriebszeiten angegeben. Die Auswirkungen des künftigen Industrie- und Gewerbelärms für die Betriebsphase werden berechnet und beurteilt sowie bei Bedarf geeignetete Lärmschutzmassnahmen festgelegt. |
Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden (DIN-Norm 4150, Teil 2; DIN 1999)
Erschütterungen – Erschütterungswirkungen auf Bauwerke VSS-40312 (VSS 2019b)
Erschütterungsimmissionen bei verschiedenen Bauaktivitäten, Juni 2013, NAB 13-19 (Ziegler 2013)
|
PH-HU1 Ers 01 |
Bauphase und Baumethoden Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Bauphase auftreten können. |
|
PH-HU1 Ers 02 |
Erschütterungen während der Betriebsphase Es ist zu verifizieren, dass während der Betriebsphase keine Erschütterungen auftreten. |
|
PH-HU1 Ers 03 |
Rückbauphase Beschreibung und Analyse der Erschütterungen, welche während der Rückbauphase auftreten können. |
Der Rückbau der BEVA (und damit PH-HU1 Ers 03) wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).
Aufgrund des aktuellen Projektstands können für den Umweltbereich «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» noch keine für eine abschliessende Bewertung ausreichenden Erkenntnisse gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Ers 01 und 02 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Auf dem angrenzenden Areal des PSI und der Zwilag befinden sich bestehende Bauten und Anlagen. Es sind keine relevanten Erschütterungen bekannt, welche von diesen Bauten und Anlagen ausgehen.
Mehr als 600 m südlich des Projektperimeters befindet sich heute die erschütterungsempfindliche SwissFEL-Anlage des PSI (vgl. Fig. 3‑2).
Gewöhnliche Bauaktivitäten im Anlagenperimeter wie Bohren, Baggerarbeiten, Betonumschlag verursachen gemäss Ziegler (2013) nur geringe Erschütterungen und ergeben ab einer Distanz von ca. 200 m keine über dem Hintergrundrauschen liegenden Erschütterungen. Die durch LKW-Verkehr verursachten Erschütterungen liegen gemäss Ziegler (2013) bei glattem Belag in einer Distanz von 150 m unterhalb des Hintergrundpegels. Walzenverdichter (Vibrationswalzen) hingegen könnten Erschütterungen ergeben, die in dieser Distanz über dem Hintergrundrauschen liegen.
Zum jetzigen Projektstand sind die Bauverfahren noch nicht festgelegt (vgl. Kap. 4.5.1). In der weiteren Projektplanung werden erschütterungsrelevante Arbeiten (z.B. Rammarbeiten, Abbrucharbeiten Beton und Belag z.B. mit Pressluftmeissel und Spitzhammer, Verdichtungen mit Walzenverdichtern (Vibrationswalzen), Setzen und Ziehen von Spundwänden etc.) identifiziert und allfällige Massnahmen in Abstimmung mit dem PSI und der Zwilag definiert.
Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass durch den Betrieb der BEVA (Güterumschlag, Transporte TLB/TB) keine relevanten Erschütterungen zu erwarten sind. Aufgrund der Distanz von deutlich über 600 m zum Anlagenperimeter sind auch für die erschütterungsempfindliche SwissFEL-Anlage keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Für den UVB 2. Stufe ist dies zu bestätigen.
Die Bereiche Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall sind gemäss heutigem Kenntnisstand nur während der Bauphase relevant.
Während des Betriebs sind im Bereich Erschütterungen und abgestrahlter Körperschall keine relevanten Auswirkungen zu erwarten.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Erschütterungen / abgestrahlter Körperschall» eingehalten und das Vorhaben bezüglich dieser Aspekte umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 Ers 01 |
Erschütterungen während der Bauphase Die Auswirkungen der gewählten Baumethoden werden abgeschätzt und allfällige Massnahmen in Abstimmung mit PSI und Zwilag definiert. |
|
PH-HU2 Ers 02 |
Erschütterungen während der Betriebsphase Es wird bestätigt, dass während der Betriebsphase keine relevanten Erschütterungen auftreten. |
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23. Dezember 1999, Stand 1. November 2023, SR 814.710 (NISV)
Nichtionisierende Strahlung. Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV, Vollzug Umwelt VU 5801 (BUWAL 2002a)
Standorte von Sendeanlagen in der Schweiz (BAKOM 2022)
Hochspannungsleitung Vollzugshilfe zur NISV, Vollzugs-, Berechnungs- und Messempfehlung. Entwurf zur Erprobung, Juni 2007, Umwelt-Vollzug (BAFU 2007)
Vorlage für die Beurteilung von Trafostationen (ESTI 2022)
|
PH-HU1 NIS 01 |
Eruieren von NIS-Quellen Es werden Aussagen zu den massgebenden vorhandenen NIS-Quellen gemacht. |
|
PH-HU1 NIS 02 |
Geplante NIS-relevante Anlagen während der Bauphase Aufzeigen der Details zu NIS-relevanten Anlagen des Projekts inkl. Erstellen aller Standortdatenblätter für NIS-Anlagen, welche zum Projekt gehören oder im Rahmen des Projekts erstellt werden. |
|
PH-HU1 NIS 03 |
Abschätzung Einhaltung von NIS-Grenzwerten während der Betriebsphase Es werden qualitative Aussagen zur Einhaltung der NIS-Grenzwerte gemacht. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «nichtionisierende Strahlung» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 NIS 02 und 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Bei den im Umkreis des Projektperimeters bestehenden Mobilfunkantennen (vgl. Fig. 5‑2) mit grosser bis mittlerer Sendeleistung handelt es sich um sogenannte «alte Anlagen», welche vor Inkrafttreten der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV 1999) erstellt wurden. Die Einhaltung der Grenzwerte bei den umliegenden Orten mit empfindlichen Nutzungen (OMEN) bzw. die Sanierung der Anlagen wird durch die jeweiligen Betreiber der Anlage sichergestellt. Beim Projektperimeter handelt es sich um bereits rechtsgültig eingezonte Bauzonen (Arbeitszone II) bzw. unmittelbar angrenzende Waldflächen. Aufgrund des Abstands des Anlagenperimeters zu den Mobilfunkantennen des PSI Ost resp. des PSI West von 100 m resp. 700 m und der dazwischenliegenden Gebäude, welche heute bereits OMEN aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass die massgebenden Anlagegrenzwerte im künftigen Anlagenperimeter auch ohne Sanierung der Anlagen eingehalten werden.
Westlich des Projektperimeters verlaufen mehrere Hochspannungsleitungen (Freileitungen) der Axpo und Swissgrid (vgl. Fig. 5‑2). Diese führen vom KKW Beznau zum PSI West und weiter in Richtung Süden entlang des Westufers der Aare. Nördlich des PSI West führt ein Abzweiger der Swissgrid-Leitung zum PSI Ost und wird dort als erdverlegte Kabelleitung weitergeführt. Beide Teile des PSI sind daher mit dem Leitungsstrang aus dem KKW Beznau verbunden. Aufgrund des Abstands von ca. 300 m zum Anlagenperimeter und der dazwischenliegenden Gebäude, welche heute bereits OMEN aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass die massgebenden Anlagegrenzwerte auch im künftigen Anlagenperimeter eingehalten werden.
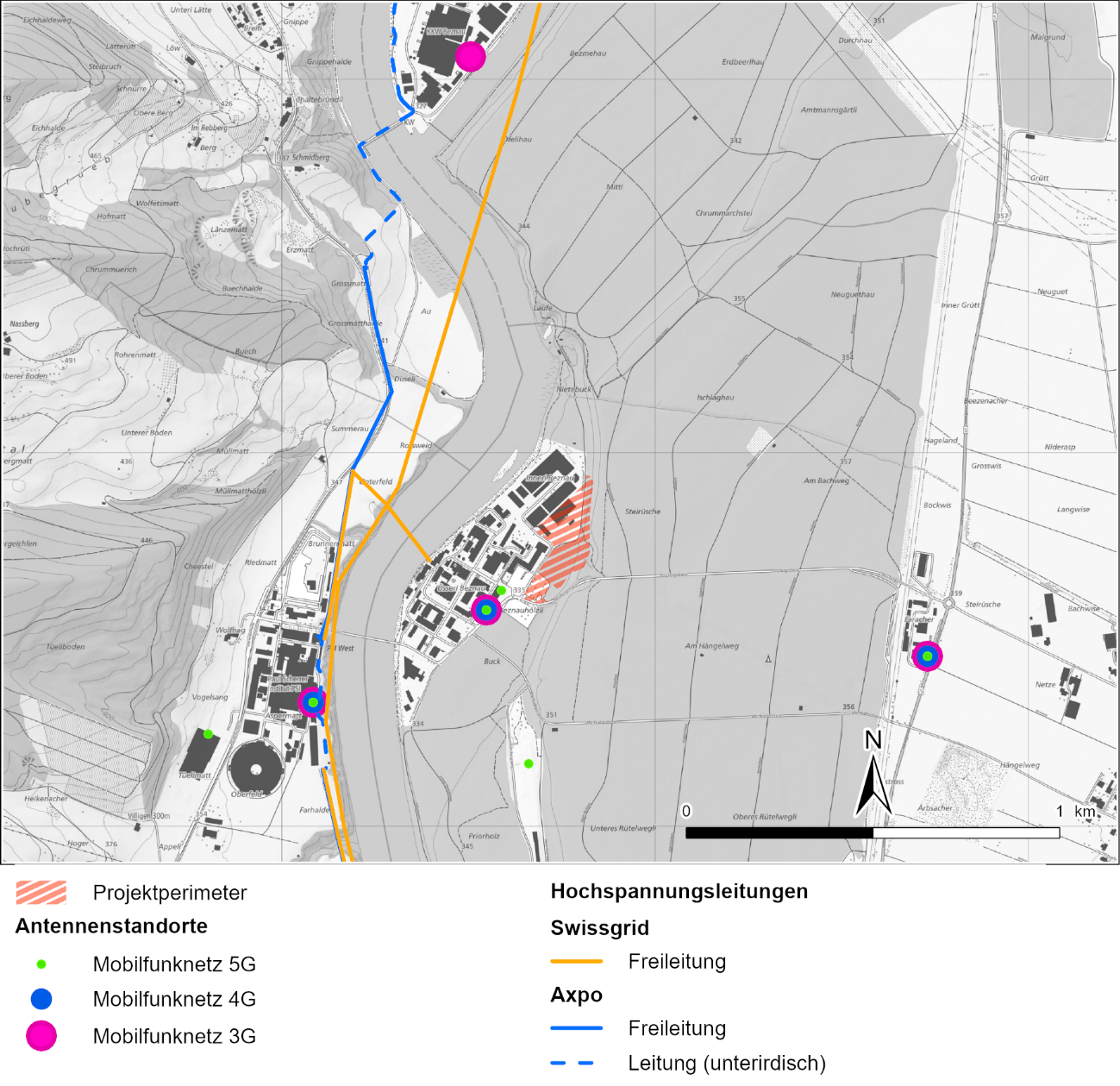
Fig. 5‑2:Antennenstandorte und Hochspannungsleitungen im Umkreis des geplanten Projektperimeters (swisstopo 2024)
Es wird davon ausgegangen, dass für den Bau selbst keine NIS-relevanten Anlagen erstellt werden (vgl. Kap. 4.8).
Allfällige NIS-relevante Anlagen (z. B. Transformatorenstationen) im Anlagenperimeter werden so geplant, dass OMEN abgeschirmt von NIS-relevanten Anlagen liegen und die massgebenden Anlagegrenzwerte an den OMEN eingehalten werden. Für den UVB 2. Stufe wird überprüft, ob resp. welche NIS-Schutzmassnahmen dazu nötig sind.
In der Bauphase ist der Umweltbereich NIS nicht relevant.
Für die Betriebsphase ist zu prüfen, ob die Mindestabstände von NIS-relevanten Quellen zu OMEN eingehalten werden oder allfällige NIS-Schutzmassnahmen umzusetzen sind.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «NIS» eingehalten und das Vorhaben bezüglich dieses Aspektes umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 NIS 01 |
Neue NIS-relevante Anlagen für die Betriebsphase Die neuen NIS-relevanten Anlagen des Projekts werden aufgezeigt und ggf. Standortdatenblätter für NIS-Anlagen erstellt. |
|
PH-HU2 NIS 02 |
Mindestabstände / Abschirmungsmassnahmen NIS-Quellen Die belastungsabhängigen Mindestabstände von NIS-Quellen zu OMEN werden überprüft und allfällige NIS-Schutzmassnahmen definiert. |
Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den Schutz der Gewässer, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)
Wegleitung Grundwasserschutz. Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL 2004)
Vulnerabilität der Grundwasservorkommen, Tafel 8.7, Hydrologischer Atlas der Schweiz, (HADES 2007)
Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe, 3. Überarbeitete Auflage 2018, Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018)
Wegleitung zur Umsetzung des Grundwasserschutzes bei Untertagebauten. Vollzug Umwelt VU 2503 (BUWAL 1998)
Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter – Gesamtpaket, Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA 2019)
Geologische Prognose mit bautechnischer Empfehlung für den Standort der Brennelementverpackungsanlage, Nagra Arbeitsbericht NAB 24-40 (Nagra 2024a)
GIS des Kantons Aargau: Grundwasserkarte, Gewässerschutzkarte (AGIS 2024)
|
PH-HU1 Grw 01 |
Analyse temporärer und permanenter Auswirkungen auf das Grundwasser während der Bau- und Rückbauphase Mögliche projektbedingte Auswirkungen werden aufgezeigt und beurteilt. |
Der Rückbau der BEVA wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).
Aufgrund des aktuellen Projektstands können erst grobe Erkenntnisse für den Umweltbereich «Grundwasser» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Grw 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgende ergänzenden Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU wird folgendermassen eingegangen:
-
Die Anträge 8 und 9 des BAFU werden berücksichtigt und das Pflichtenheft der UVB 2. Stufe entsprechend angepasst.
- Anträge 7 und 8 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden berücksichtigt, Antrag 7 ergänzt (siehe Kap. 2.3) und Antrag 8 ins Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe aufgenommen.
Der Projektperimeter liegt gemäss kantonalem Richtplan (V1.1; Kanton Aargau 2011) im Randbereich eines «vorrangigen Grundwassergebiets». Im Bereich der Zwilag weist der Grund wasserleiter eine Mächtigkeit von 7 – 12 m auf (vgl. Fig. 5‑3). In diversen älteren Bohrungen auf dem Areal wurden Pumpversuche durchgeführt. Diese ergaben Durchlässigkeitsbeiwerte von 1 × 10-3 bis 1 × 10-2 m/s, was einer hohen bis sehr hohen Durchlässigkeit entspricht (Nagra 2024a). Die Grundwasserstände im Projektperimeter sind aufgrund von langfristigen Grund wasser spiegelbeobachtungen in diversen Piezometerrohren in der Umgebung und bei in der Nähe liegenden Grundwasserfassungen bekannt.
Die für den Anlagenperimeter massgebenden Grundwasserspiegel werden wie folgt ange nom men:
| Mittelwasserstand MW: | ca. 323.9 – 324.4 m ü. M. |
| Hochwasserstand HW (1999): | ca. 325.3 – 325.7 m ü. M. |
| Extremhochwasserstand EHW (Häufigkeit 10-4 pro Jahr): | ca. 328.7 m ü. M. |
Bei einem mittleren Terrain des Anlagenperimeters von ca. Kote 335 m ü. M. gemäss der heutigen Topographie des Standorts (AGIS 2024) weist das Grundwasser bei MW einen mittleren Flurabstand von mindestens 10.5 m auf. Bei HW beträgt der mittlere Flurabstand rund 9 m, bei EHW immer noch rund 6 m (Nagra 2024a).
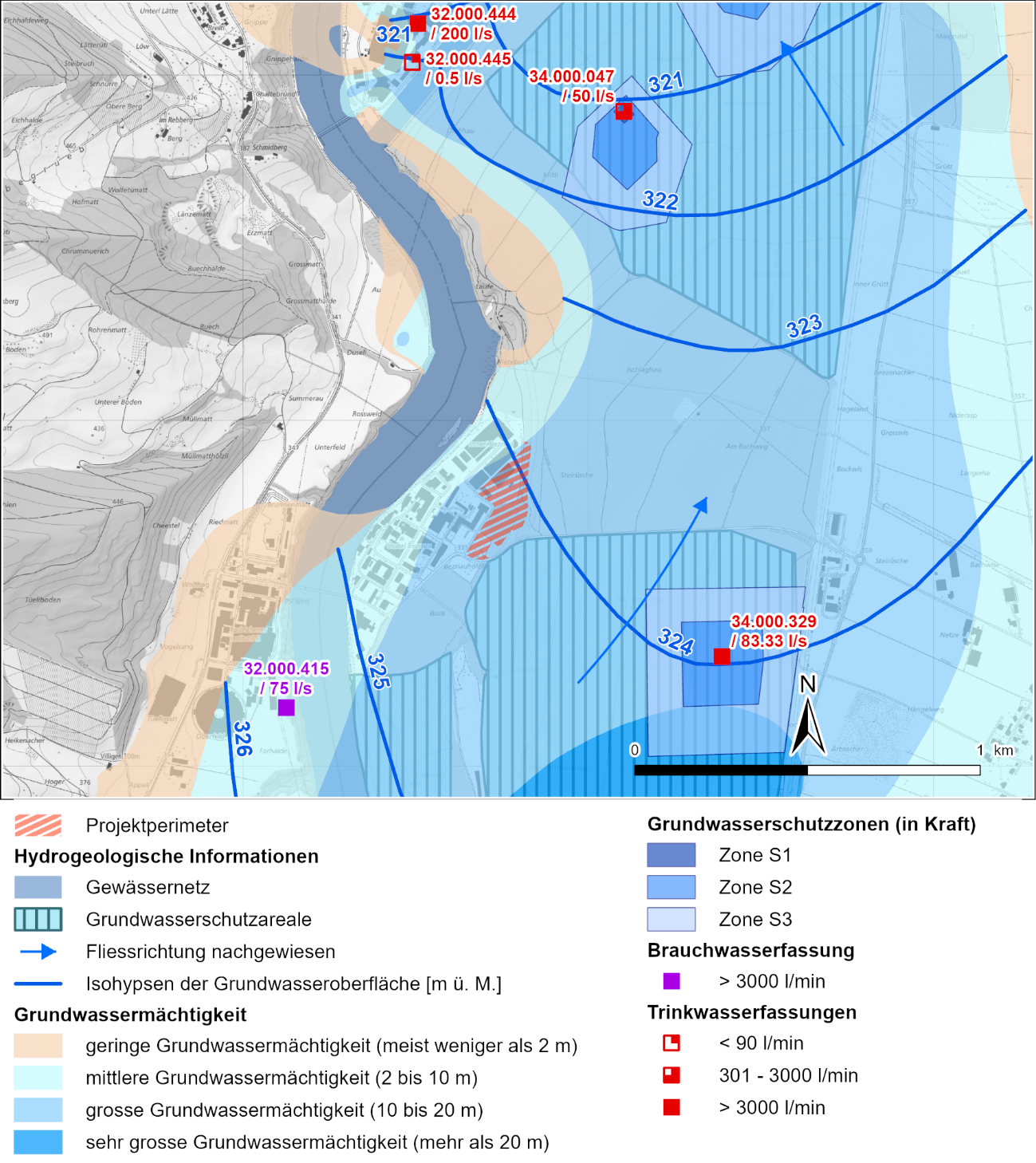
Fig. 5‑3:Grundwasserverhältnisse bei Mittelwasserstand rund um das Zwilag-Areal
(Auszug aus der Grundwasserkarte des Kantons Aargau; AGIS 2024)
Der Projektperimeter liegt vollständig innerhalb des Gewässerschutzbereichs Au (vgl. Fig. 5‑4). Rund 800 m südöstlich des Projektperimeters befindet sich die Grundwasserfassung «Am Hengelweg» (Bewilligungs-Nr. 34.000.329), welche zu Trinkwasserzwecken genutzt wird (Kon zessionswassermenge 5'000 l/min). Bezüglich der generellen Grundwasserfliessrichtung von Südwesten nach Nordosten (vgl. Fig. 5‑3) liegt die Fassung seitlich des Projektperimeters und zudem innerhalb des Grundwasserschutzareals «Unterwald (Würenlingen)» (vgl. Fig. 5‑4). Rund 1 km nördlich des Projektperimeters und somit im Abstrom liegen die Grundwasserfassungen «Unterwald» (Bewilligungs-Nr. 34.000.047), welche durch die Gemeinde Döttingen zur Trinkwassergewinnung genutzt werden (Konzessionswassermenge 3' 000 l/min) und sich innerhalb des Grundwasserschutzareals «Unterwald (Döttingen)» befinden. Bei den Fassungen auf der Beznau insel nördlich des Projektperimeters (Bewilligungs-Nr. 32.000.444 und 445) handelt es sich um Notfassungen.
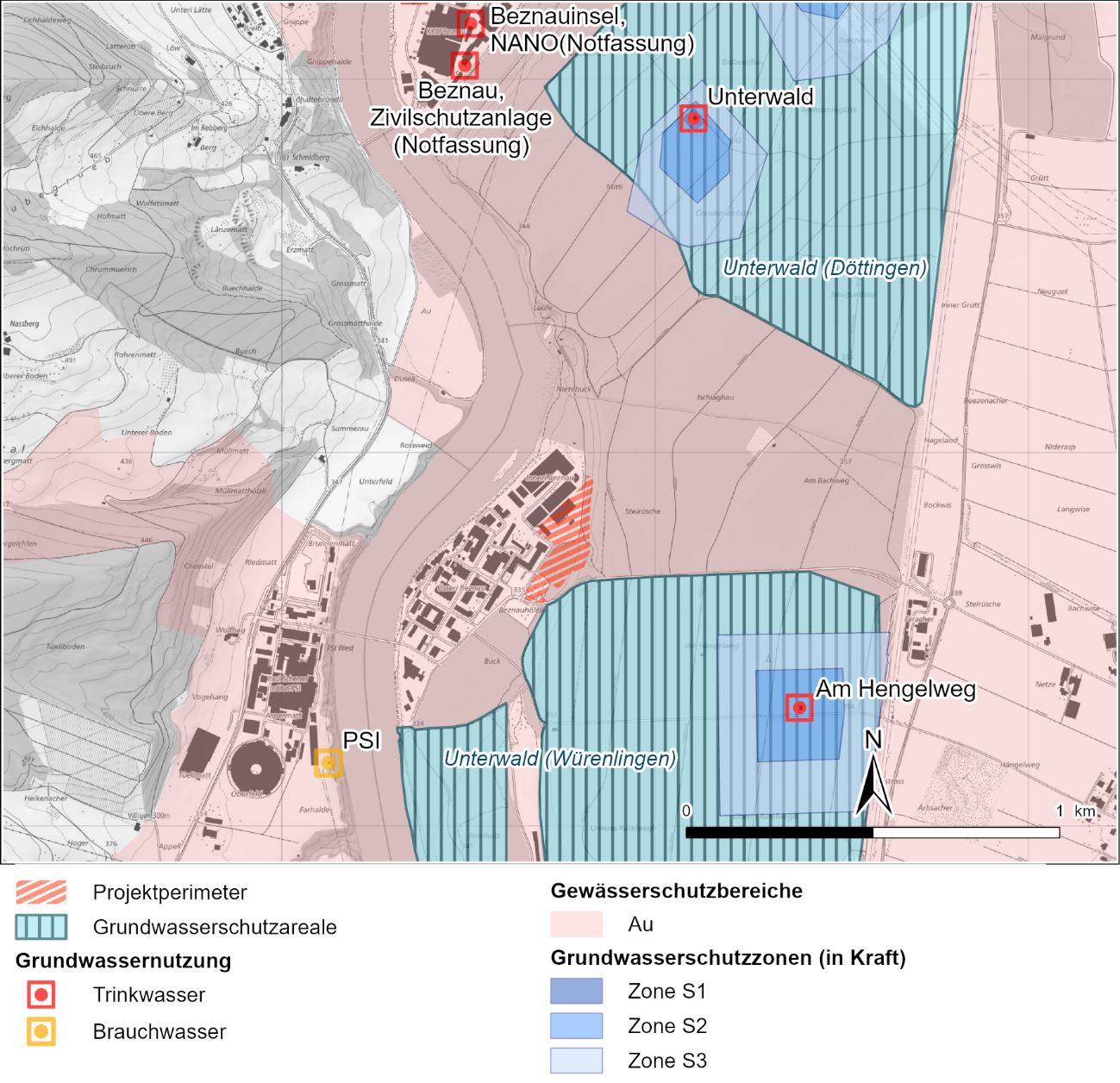
Fig. 5‑4:Auszug aus der Gewässerschutzkarte des Kantons Aargau im Bereich des Projekt perimeters (AGIS 2024)
Die nach heutigem Vorhaben vorgesehenen Fundationskoten der BEVA sowie der konventionellen Bauten liegen bei 326 m ü. M. (vgl. Kap. 4.2). Somit sind voraussichtlich keine permanenten Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel (ca. 323.9 – 324.4 m ü. M., vgl. Kap. 4.2.1) vorgesehen. Eine Absenkung der Fundationskoten bis auf MW-Stand ist jedoch heute nicht auszuschliessen. Die Fundationskote der BEVA wird in UVB 2. Stufe in Bezug auf den Einbau unter den MW überprüft.
Die Dimensionen der Bauten und Anlagen, die Baumethoden und Angaben zum Bauablauf sind noch nicht festgelegt. Daher werden Aussagen zu allfälligen temporären quantitativen Auswirkungen durch gegebenenfalls ins Grundwasser reichende temporäre Baugrubensicherungs- oder Wasserhaltungsmassnahmen und ggf. notwendigen Schutzmassnahmen für den UVB 2. Stufe gemacht und allfällige Ausnahmebewilligungen im Baubewilligungsverfahren beantragt (vgl. Kap. 2.3).
Für die Kühlung resp. Heizung der Gebäude im Anlagenperimeter (vgl. Kap. 4.2.1) könnte ggf. eine thermische Grundwassernutzung realisiert werden. Der Projektperimeter liegt gemäss «Eignungskarte Erdwärmenutzung» (AGIS 2024) in einem dafür geeigneten Gebiet. Die Art der Heizung/Kühlung sowie die weiteren dafür ggf. notwendigen Abklärungen (im Fall Grundwassernutzung u.a. bzgl. Wärmeeintrag resp. -entzug) werden im UVB 2. Stufe dargelegt. Weiter würden im Fall einer Grundwassernutzung die für eine solche Nutzung nötigen Nachweise und Unterlagen eingereicht (Nachweise und Unterlagen für eine Bewilligung zur thermischen Grundwassernutzung, Bohrbewilligung und Antrag für eine kantonale Konzession).
Falls für den Betrieb eine Tankanlage mit wassergefährdenden Flüssigkeiten (z.B. Diesel) betrieben werden muss (z.B. für eine Notstromanlage), sind für den UVB 2. Stufe die entsprechenden Schutzmassnahmen für den Gewässerschutzbereich Au vorzusehen und in entsprechenden Dispositiven festzuhalten.
Zu allfälligen temporären quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser in der Bauphase können noch keine Aussagen gemacht werden. Diese Abklärungen erfolgen im UVB 2. Stufe. Ggf. notwendige Grundwasserschutzmassnahmen werden ebenfalls für den UVB 2. Stufe definiert.
In der Betriebsphase sind nach heutigen Projektstand keine relevanten Einflüsse auf den Umweltbereich Grundwasser zu erwarten, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu überprüfen. Allenfalls sind entsprechende Schutzmassnahmen vorzusehen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Grundwasser» eingehalten und das Vorhaben bezüglich dieses Aspektes umweltverträglich realisiert werden.
|
PH-HU2 Grw 01 |
Temporäre Grundwasserabsenkung während der Bauphase Allfällig temporäre Grundwasserabsenkungen und Wasserhaltungsmassnahmen während der Bauphase werden abgeklärt und ggf. Ausnahmebewilligungen dafür beantragt. |
|
PH-HU2 Grw 02 |
Durchflussnachweis Für allfällige Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel wird der Nachweis erbracht, dass die Durchflusskapazität des Grundwassers gegenüber dem Ausgangszustand um höchstens 10 % vermindert wird. Bei Bedarf sind Kompensationsmassnahmen vorzusehen. Die Interessen für einen Einbau ins Grundwasser werden aufgezeigt. |
|
PH-HU2 Grw 03 |
Thermische Grundwassernutzung Sollte Grundwasser für die Kühlung resp. Heizung der Gebäude genutzt werden, sind die nötigen Abklärungen (u.a. bzgl. Wärmeeintrag resp. -entzug) vorzunehmen und die dafür nötigen Nachweise und Unterlagen einzureichen (für Bewilligung thermische Grundwassernutzung, Bohrbewilligung und Antrag kantonale Konzession). |
|
PH-HU2 Grw 04 |
Grundwasserschutz vor wassergefährdenden Stoffen (Betriebsphase) Für allfällige Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen werden Grundwasserschutzmassnahmen geprüft. |
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (Gewässerschutzgesetz, GSchG)
Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998, Stand 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)
Bundesgesetz über den Wasserbau vom 21. Juni 1991, Stand 1. Januar 2022, SR 721.100 (Wasserbaugesetz, WAG)
Verordnung über den Wasserbau vom 2. November 1994, Stand 1. Januar 2016, SR 721.100.1 (Wasserbauverordnung, WBV)
Bundesgesetz über die Fischerei vom 21. Juni 1991, Stand 1. Juli 2023, SR 923.0 (BGF)
Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei vom 24. November 1993, Stand 1. Januar 2021, SR 923.01 (VBGF)
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen des Kantons Aargau vom 19. Januar 1993, Stand 1. Juli 2024, SAR 713.100 (Baugesetz, BauG)
GIS des Kantons Aargau: Ökomorphologie Fliessgewässer (AGIS 2024)
Es ist kein Pflichtenheft aus der Voruntersuchung vorhanden, da der Umweltbereich «Oberflächengewässer inkl. aquatische Lebensräume» in der Voruntersuchung als nicht relevant eingestuft wurde.
In den Stellungnahmen sind keine Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Der Projektperimeter liegt am orographisch rechten Aareufer. Rund 200 m nördlich des Projektperimeters fliesst der Dorfbach (Gewässer Nr. 2.00.110) von Osten her in die Aare. Die Aare wird in diesem Abschnitt ökomorphologisch als «wenig beeinträchtigt», der Dorfbach als «naturnah» eingestuft (vgl. Fig. 5‑5).
Gemäss § 127 Abs. 1 BauG beträgt die Breite des Uferstreifens der Aare beidseits 15 m und die Breite des Gewässerraums gemäss Art. 41a GSchV beim Würenlinger Dorfbach 11 m. In der Gewässerraumkarte sind keine Abweichungen von diesen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt.
Nördlich des Zwilag-Areals befindet sich ein kleineres Stillgewässer (Weiher), welches künstlich angelegt wurde und als Versickerungsanlage für das Dachwasser der heutigen Zwilag-Gebäude dient (vgl. Fig. 4‑1).
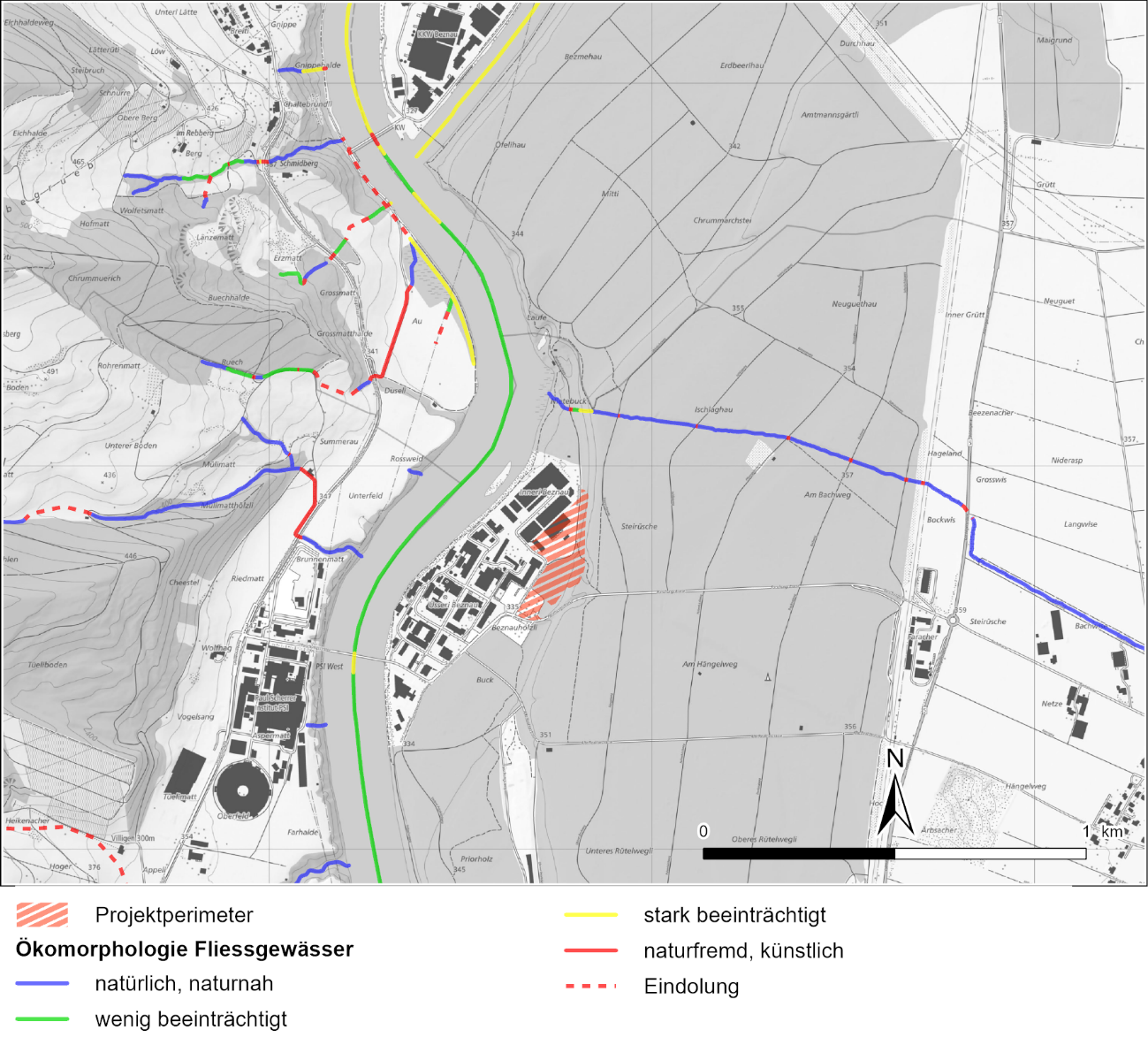
Fig. 5‑5:Ökomorphologischer Zustand der Fliessgewässer rund um den Projektperimeter (AGIS 2024)
Die Gewässerräume der Fliessgewässer nahe des Projektperimeters (Aare und Dorfbach) werden weder in der Bau- noch in der Betriebsphase tangiert.
Der Umweltbereich Oberflächengewässer ist daher nicht relevant.
Es sind keine Auswirkungen auf die Oberflächengewässer zu erwarten. Der Umweltbereich ist daher nicht relevant.
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, 24. Januar 1991, Stand 1. Februar 2023, SR 814.20 (GSchG)
Gewässerschutzverordnung, 28. Oktober 1998, Stand am 1. Februar 2023, SR 814.201 (GSchV)
Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter – Gesamtpaket. Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA 2019)
Wegleitung Grundwasserschutz, Vollzug Umwelt VU 2508 (BUWAL 2004)
Entwässerung von Baustellen. SIA 431:2022, Schweizer Norm SN 509 431 (SIA 2022)
|
PH-HU1 Ent 01 |
Prüfung Entwässerungskonzept (Betriebsphase) Das vorgesehene Entwässerungskonzept für die Betriebsphase wird dargestellt und hinsichtlich Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Vorgaben geprüft. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine ausreichenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Entwässerung» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Ent 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft für die 2. Stufe übertragen.
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Der Teil des Projektperimeters auf dem heutigen Zwilag-Areal und dem PSI-Parkplatz ist heute versiegelt und entwässert (vgl. Fig. 5‑6). Der Teil im Wald ist nicht entwässert.
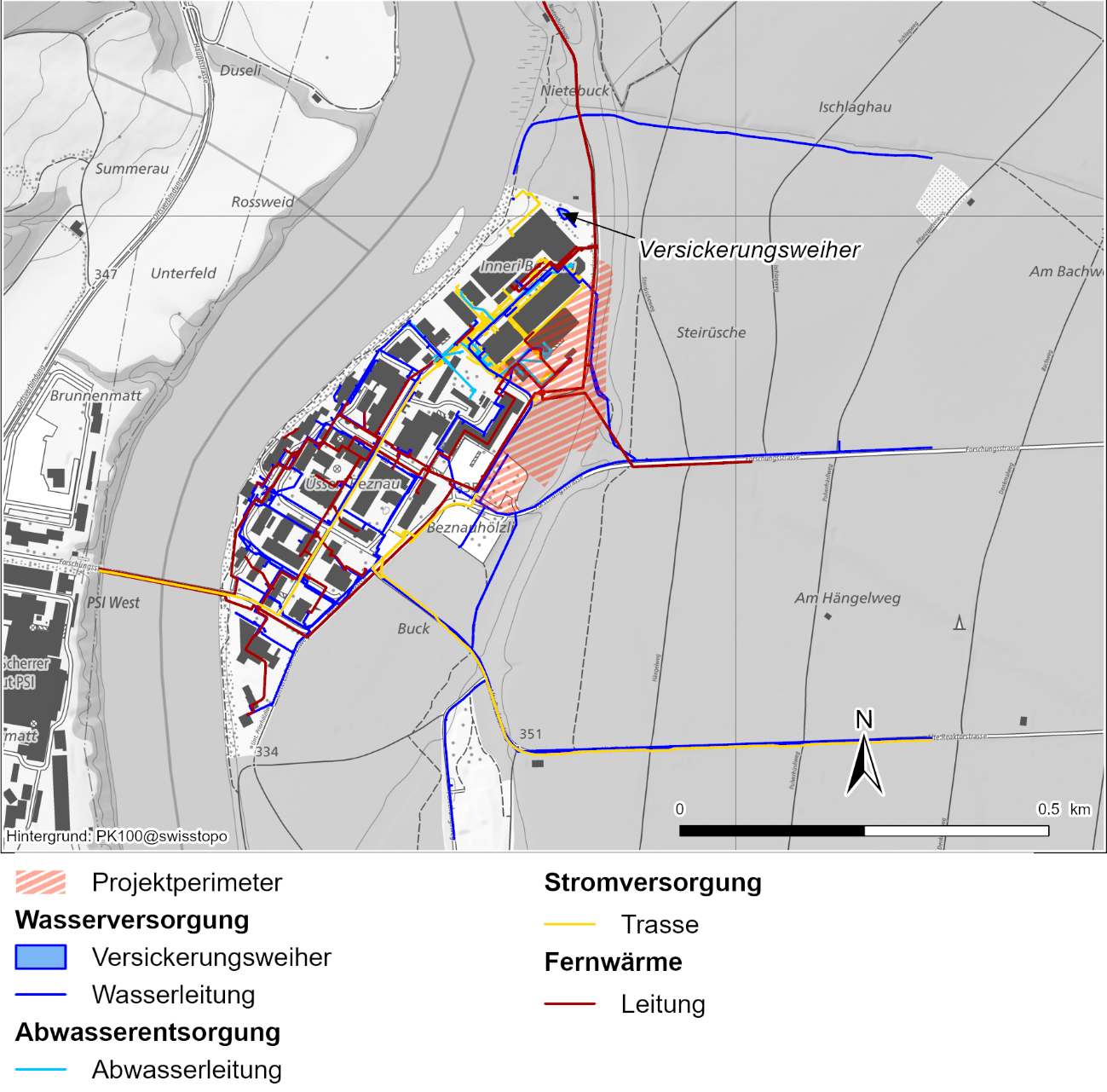
Fig. 5‑6:Bestehende Werkleitungen in der näheren Umgebung des Projektperimeters
Das Meteorwasser von arealinternen Verkehrs- und Parkierungsflächen der Zwilag wird über mehrere begrünte Versickerungsmulden, das Dachwasser in einem Versickerungsweiher nördlich der bestehenden Zwilag-Gebäude versickert (vgl. Fig. 5‑6). Das Schmutzwasser der Zwilag wird über die bestehende Kanalisation abgeleitet. Prozesswässer der Zwilag werden in einem geschlossenen System gehandhabt und gelangen nicht in die Umwelt. Der PSI-Parkplatz ist an die Kanalisation (Trennsystem) angeschlossen (vgl. Fig. 5‑6).
In der Bauphase werden grundsätzlich verschiedene typische Baustellenabwässer anfallen (z.B. Meteorwasser aus der Baugrube, Abwasser von Zementbindung, allenfalls Grundwasser bei temporären Absenkungen / Wasserhaltungsmassnahmen etc.). Die bei der Baustellenabwasserbehandlung und -entsorgung zu berücksichtigenden Vorgaben und Massnahmen gemäss SIA (2022) werden im UVB 2. Stufe aufgezeigt. Vor Baubeginn wird ein Baustellenentwässerungskonzept nach SIA 431 (SIA 2022) erstellt und ggf. eine Ausnahmebewilligung bzgl. Einleitung in ein Oberflächengewässer (vgl. Kap. 2.3) beantragt.
Gemäss heutigem Projektstand wird das anfallende Schmutzabwasser der vorhandenen Infrastruktur (Kanalisation) zugeführt und in die Abwasserreinigungsanlage des PSI abgeleitet, sofern die Kapazität dafür ausreicht (Nachweis im Rahmen der weiteren Projektplanung erforderlich). Das Meteorwasser (Dach- resp. Strassenabwasser) soll – abhängig von der Belastungsklasse – aufgrund der günstigen Versickerungsverhältnisse im Projektperimeter (gut durchlässiger Schotter, tief liegender Grundwasserspiegel; vgl. Kap. 5.6 resp. Nagra 2024a) entsprechend der künftigen Vorgaben versickert werden. Für den UVB 2. Stufe wird ein Entwässerungskonzept ausgearbeitet, inkl. Abklärung der Belastungsklasse, der Dimensionierung sowie der Ausgestaltung der Anlage für die Meteorwasserversickerung.
Die Baustellenentwässerung für die Bauphase wird im Rahmen des UVB 2. Stufe behandelt.
Für die Betriebsphase ist im UVB 2. Stufe ein Entwässerungskonzept inkl. Abklärung der Versickerungsmöglichkeiten für Meteorwasser auszuarbeiten.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Entwässerung» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Ent 01 |
Baustellenentwässerungskonzept Für die Baustellenentwässerung wird ein Baustellenentwässerungskonzept nach geltenden Vorgaben ausgearbeitet. |
|
PH-HU2 Ent 02 |
Erstellen Entwässerungskonzept für die Betriebsphase Für die Betriebsphase wird ein Entwässerungskonzept nach gewässerschutzrechtlichen Vorgaben (inkl. Prüfung von Versickerungsmöglichkeiten für Meteorwasser) erstellt. |
Verordnung über die Belastung des Bodens vom 01. Juli 1998, Stand 12. April 2016, SR 814.12 (VBBo)
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015, Stand 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005, Stand 1. Januar 2020, SR 814.610 (VeVA)
Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung, Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen. Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2021a)
Boden und Bauen. Stand der Technik und Praktiken. Umwelt-Wissen Nr. 1508 (BAFU 2015)
Erdbau, Boden. Bodenschutz und Bauen, VSS-40581 (VSS 2021)
Klassifikation der Böden der Schweiz – Bodenprofiluntersuchung, Klassifikationssystem, Definitionen der Begriffe, Anwendungsbeispiele, Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, 3. Auflage (Brunner et al. 2010)
Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen, Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen, Ein Modul der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim Bauen». Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2022)
Physikalischer Bodenschutz im Wald, Waldbewirtschaftung im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Erhaltung der physikalischen Bodeneigenschaften (BAFU 2016c)
GIS des Bundes: Bodeneignungskarte der Schweiz (swisstopo 2024)
GIS des Kantons Aargau: Bodenkarte 1:25'000 und Prüfperimeter Bodenaushub (AGIS 2024)
|
PH-HU1 Bod 01 |
Erhebung und Darstellung der physikalischen Bodeneigenschaften Ergänzend zu bestehenden Bodenkarten sollen die physikalischen Bodeneigenschaften und Mächtigkeiten aufgenommen werden (inkl. Waldboden). Im Bereich des Zwilag-Areals soll eine Bodenfeststellung der kleinen Grünflächen (Rabatten, begrünte Verkehrsinseln) erfolgen. |
|
PH-HU1 Bod 02 |
Festlegung der Bodenverwertungsklassen Auf Basis der Bodeneigenschaften sowie Erhebungen zur chemischen (inkl. Fremdstoffe) und biologischen Belastung sind die Bodenverwertungsklassen für die beanspruchten Bodenflächen aufzuzeigen. |
|
PH-HU1 Bod 03 |
Auswirkungen auf den Boden während des Baus Auswirkungen (quantitativ, physikalisch) auf den Boden sowie spezifische Massnahmen für den Bodenschutz während des Baus werden aufgezeigt. |
|
PH-HU1 Bod 04 |
Flächenbeanspruchung und Bodenbilanz Abschätzung der temporär (nur Bauphase, wiederherstellbar) und definitiv (Bebauung oder Umnutzung) beanspruchten Bodenflächen. Abschätzung der anfallenden Kubaturen an Bodenmaterial (inkl. Einteilung Bodenverwertungsklassen) sowie der Mengen, welche projektintern wiederverwendet werden können. Aufzeigen der externen Verwertung resp. Entsorgung für überschüssiges Bodenmaterial. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Boden» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Bod 02 bis 04 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 11 BAFU: Der Antrag wird berücksichtigt und das Pflichtenheft der UVB 2. Stufe entsprechend angepasst. Im UVB 2. Stufe wird ein Entwurf zum Bodenschutzkonzept erstellt.
- Antrag 9 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird berücksichtigt und das Pflichtenheft der UVB 2. Stufe entsprechend angepasst.
Gemäss Prüfperimeter Bodenaushub (AGIS 2024) ist innerhalb des Projektperimeters nicht mit chemischen Bodenbelastungen zu rechnen. Um die Bodenbeschaffenheit und Verwertbarkeit des Bodenmaterials der betroffenen Bodenflächen zu beurteilen, wurden im Oktober 2023 im Bereich des Projektperimeters Handsondierungen und Bodenaufnahmen mittels Flügelbohrer ausgeführt (vgl. Beilage A1).
Der Projektperimeter tangiert überbautes Gebiet innerhalb der Bauzone (Arbeitszone II, Zwilag-Areal) sowie angrenzende Waldfläche, jedoch keine landwirtschaftlich genutzten Böden (vgl. Kap. 3.2). Der Grossteil der Flächen im Projektperimeter, mit Ausnahme der vorhandenen Versickerungsmulden und der Parkplatzrabatten innerhalb des heutigen Zwilag-Areals, sind gemäss kantonaler Bodenkarte (AGIS 2024) als mässig tiefgründige, normal durchlässige Parabraunerden kartiert.
Die detaillierten bodenkundlichen Aufnahmen haben gezeigt, dass in den Waldflächen entlang des Nietenbuckwegs und im Abschnitt Wald Nord Braunerde der vorherrschende Bodentyp ist (vgl. Fig. 5‑7). Im Abschnitt Wald Süd wurde Parabraunerde als Bodentyp klassifiziert. Der Boden der Grünrabatten auf dem Zwilag-Areal und -Parkplatz sind als Regosole anzusehen. Die Protokolle der ausgeführten Handsondagen sind in der Beilage A1 ersichtlich. In Tab. 5‑2 werden die angetroffenen Bodenverhältnisse kurz beschrieben.

Fig. 5‑7:Bodentyp gemäss Bodenaufnahmen 2023 (vgl. Beilage A1)
Tab. 5‑2:Bodenbeschrieb
|
Teilfläche |
Sondierstandorte nach Beilage A1 |
Bodentyp |
Bodenbeschrieb |
Wasser-haushalts-gruppe |
Oberboden |
Unterboden |
|
Wald entlang Nietenbuckweg |
HS_Z_0, HS_Z_1 |
Braunerde |
Ziemlich flachgründig bis flachgründig, mullhumos, normal durchlässig |
c und e |
25 – 30 cm mächtig, schluffiger Sand, locker gelagert, krümelig |
10 – 15 cm mächtig, schluffiger Sand, locker gelagert, krümelig bis Einzelkorngefüge |
|
Wald Nord |
HS_Z_2, HS_Z_5 HS_Z_6, HS_Z_7 HS_Z_9 |
Braunerde |
Überwiegend ziemlich flachgründig, mullhumos, normal durchlässig |
d |
meist 25 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |
10 – 25 cm mächtig, meist lehmiger Sand, locker gelagert, meist krümelig |
|
Wald Süd |
HS_Z_8 |
Para- braunerde |
Tiefgründig, mullhumos, normal durchlässig |
b |
10 cm mächtig, lehmiger Sand, locker gelagert, krümelig |
85 cm mächtig, lehmreicher Schluff bis lehmiger Schluff, locker gelagert, krümelig bis Einzelkorngefüge |
|
Grünrabatten Parkplätze (Bauzone) |
HS_Z_3 HS_Z_10 |
Regosol |
Ziemlich flachgründig, anthropogen beeinflusst, normal durchlässig |
d |
30 – 40 cm mächtig, lehmiger Schluff bis lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig, teilweise Ziegelbruchstücke vorhanden (<1 Gew.-%) |
Kein Unterboden vorhanden |
|
Sickermulde (Bauzone) |
HS_Z_4 |
Regosol |
Flachgründig, anthropogen, normal durchlässig |
e |
25 cm mächtig, lehmreicher Sand, locker gelagert, krümelig |
Kein Unterboden vorhanden |
Die Bodenklassierung im Wald stimmt nur um den Sondierstandort HS_Z_8 mit der kantonalen Bodenkarte überein (senkrecht durchwaschene, normal durchlässige und tiefgründige Parabraunerde, vgl. Tab. 5‑2). Bei den übrigen tangierten Waldbodenflächen handelt es sich um ziemlich flachgründige bis flachgründige Braunerden.
Verdichtungsempfindlichkeit
Die durch das Vorhaben tangierten Waldböden sind aufgrund der nach Tab. 5‑2 genannten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen schwach bis normal empfindlich.
Bodenverwertung
Der Skelettgehalt liegt im Oberboden nie über 20 % und im Unterboden nie über 40 %. Der Tongehalt der mineralischen Feinerde erreicht weder im Ober- noch im Unterboden die Grenze von 40 %. Einzelkorngefüge wurden nur vereinzelt in tiefliegenden Unterbodenhorizonten (und zusammen mit krümeligem Gefüge) festgestellt. Da beim Abtrag im Anlagenperimeter der gesamte Unterboden abgetragen wird, fällt dort aufgrund der Mischung von krümeligem Gefüge und dem tiefliegenden Horizont mit Einzelkorngefüge das Gefüge nicht ins Gewicht.
Im Prüfperimeter Bodenaushub des Kantons Aargau (AGIS 2024) sind im Projektperimeter keine Bereiche mit Verdacht auf chemische Bodenbelastungen aufgeführt. Eine Schadstoffbeprobung des Bodens im Bereich des Walds zur Überprüfung dieser Annahme und zur definitiven Festlegung des Verwertungswegs wird für UVB 2. Stufe durchgeführt.
Bei den Handsondagen wurden vereinzelt Ziegelbruchstücke und Siedlungsabfälle festgestellt. Der Anteil an Fremdstoffen war überall < 1 Gew.-%.
Gemäss der Neophytenaufnahmen (vgl. Kap. 5.12) wachsen auf den tangierten Waldböden teilweise Neophyten. Zur Kontrolle der Bestände werden die Neophyten für UVB 2. Stufe und vor dem effektiven Bodenabtrag in Hinblick auf die Verwertung erneut erhoben.
Die physikalischen Bodeneigenschaften und der Fremdstoffgehalt schränken die Verwertbarkeit des Waldbodens nicht ein. Bereiche mit Neophyten sind als «eingeschränkt verwertbar» einzustufen. Das Bodenmaterial kann vor Ort oder an Orten, wo nachweislich eine Bekämpfung der Neophyten stattfindet, verwertet werden. Die abschliessende Beurteilung der Verwertbarkeit des Waldbodens erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe.
Die Angaben aus der kantonalen Bodenkarte (AGIS 2024) konnten im Bereich des heutigen Zwilag-Areals nicht bestätigt werden. Bei den Böden handelt es sich im Bereich der Versickerungsmulden und der Parkplatzrabatten um anthropogen beeinflusste Regosole. Die Böden sind flachgründig bis ziemlich flachgründig.
Verdichtungsempfindlichkeit
Die durch den Anlagenperimeter tangierten Böden sind aufgrund der nach Tab. 5‑2 genannten Eigenschaften gegenüber Verdichtungen schwach empfindlich.
Bodenverwertung
Der Skelettgehalt liegt im Oberboden nie über 20 % und im Unterboden nie über 40 %. Der Tongehalt der mineralischen Feinerde erreicht weder im Ober- noch im Unterboden die Grenze von 40 % und es wurde kein Einzelkorngefüge festgestellt.
Im Prüfperimeter Bodenaushub des Kantons Aargau (AGIS 2024) sind im Anlagenperimeter keine Bereiche mit Verdacht auf Belastungen aufgeführt. Trotzdem ist nicht auszuschliessen, dass im Bereich des Zwilag-Areals bei den Rabatten der Parkplätze sowie der strassennahen Flächen Bodenbelastungen z. B. durch Abrieb von Pneus/Bremsen oder Hilfsstoffe aus dem Winterunterhalt vorkommen. Eine Schadstoffbeprobung des Bodens im Bereich der Rabatten und der Versickerungsmulden zur Überprüfung dieser Annahmen und zur Definition des Verwertungswegs wird für UVB der 2. Stufe durchgeführt.
Bei den Handsondagen wurden vereinzelt Ziegelbruchstücke und Siedlungsabfälle festgestellt. Der Anteil an Fremdstoffen war überall <1 Gew.-%.
Gemäss der Neophytenaufnahmen (vgl. Kap. 5.12) wachsen in den Rabatten und in einer Versickerungsmulde verschiedene Neophyten. Zur Kontrolle der Bestände werden die Neophyten für UVB 2. Stufe und vor dem effektiven Bodenabtrag erneut erhoben.
Die physikalischen Bodeneigenschaften und der Fremdstoffgehalt schränken die Verwertbarkeit des Bodens nicht ein. Bereiche mit Neophyten, sind als «eingeschränkt verwertbar» einzustufen. Das Bodenmaterial kann vor Ort oder an Orten, wo nachweislich eine Bekämpfung der Neophyten stattfindet, verwertet werden. Die abschliessende Beurteilung der Verwertbarkeit des Bodens erfolgt im UVB 2. Stufe.
Flächenbeanspruchung
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der betroffenen Bodenflächen getrennt nach Eingliederungssaum, Anlagenperimeter sowie temporäre Installationsfläche (vgl. Tab. 5‑3).
Tab. 5‑3:In den einzelnen Teilperimetern betroffene Bodenflächen gemäss Bodenuntersuchungen (Beilage B1)
Die Spalte «Total» enthält die Fläche des Projektperimeters. Der Flächenanteil wurde entsprechend der Gesamtfläche nach Tab. 4‑1 berechnet.
|
Bereich |
Eingliederungs-saum [ha] |
Anlagenperimeter [ha] |
Temporäre Installationsfläche [ha] |
Total [ha] |
|
Bodenfläche Bauzone |
- |
0.21 |
0.08 |
0.29 |
|
Bodenfläche Wald |
0.51 |
0.86 |
– |
1.37 |
|
Total |
0.51 |
1.07 |
0.08 |
1.66 |
|
Flächenanteil der Gesamtfläche [%] |
100 |
52 |
22 |
57 |
Bodenabtrag / -umlagerung
Zu Beginn der Bauphase sind im künftig zu rodenden Bereich des Anlagenperimeters Waldbodenabtragsarbeiten vorgesehen (rund 0.9 ha, vgl. Tab. 5‑3). Die heutigen Rabatten und Versickerungsmulden im Anlagenperimeter und auf der temporären Installationsfläche werden ebenfalls abgetragen (rund 0.3 ha). Im Eingliederungssaum finden keine Bodenumlagerungen statt.
Beim Abtragen resp. Umlagern von Boden werden die Grundsätze nach BAFU 2022 beachtet.
In der folgenden Tabelle sind die Bodenkubaturen der von Bodenabtrag betroffenen Teilperimeter zusammengefasst (vgl. Tab. 5‑4).
Tab. 5‑4:Abgeschätzte anfallende Bodenkubaturen im Anlagenperimeter sowie auf der temporären Installationsfläche
|
Bereich |
Anlagenperimeter [m3 fest] |
Temporäre Installationsfläche [m3 fest] |
Anfall total [m3 fest] |
|
Oberboden Rabatten / Versickerungsmulden |
550 |
250 |
800 |
|
Unterboden Rabatten / Versickerungsmulden |
- |
- |
- |
|
Oberboden Waldboden |
2'250 |
- |
2'250 |
|
Unterboden Wald |
2'400 |
- |
2'400 |
|
Total |
5'200 |
250 |
5'450 |
Bodenumlagerung
Die Umlagerungsarbeiten werden nach den Kriterien der BAFU-Vollzugshilfe «Bodenschutzmassnahmen auf Baustellen» (BAFU 2022) durchgeführt. Für den UVB 2. Stufe ist ein Entwurf eines Bodenschutzkonzepts für die Bauphase auszuarbeiten. Dafür ist eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson zu beauftragen.
Bodenzwischenlager
Es wird eine Direktumlagerung und Verwertung des anfallenden, überschüssigen Bodenmaterials ausserhalb des Projektperimeters angestrebt. Ist eine Direktumlagerung oder direkte Wiederverwertung ausserhalb des Projektperimeters nicht möglich, ist das Bodenmaterial bis zu seiner entsprechenden Wiederverwertung kurzzeitig fachgerecht zwischenzulagern.
Wiederverwertung
Im Anlagenperimeter besteht keine Verwertungs- oder längerfristige Zwischenlagermöglichkeit. Die externe Verwertung wird in der künftigen Projektierung berücksichtigt.
Während der Betriebsphase wird kein Boden beansprucht oder umgelagert.
Bodenarbeiten finden während der Bauphase statt, da im südöstlichen Bereich des Anlagenperimeters der heutige Waldboden entfernt wird. Im Eingliederungssaum sind aufgrund der Freihaltung Waldarbeiten vorgesehen, welche den Waldboden betreffen, jedoch nicht zu Waldbodenverschiebung führen werden. Ebenfalls werden im Bereich der vorhandenen Versickerungsmulden sowie im Bereich der Rabatten auf dem derzeitigen Zwilag-Gelände und dem PSI-Parkplatz der Boden abgetragen. Je nach chemischer und biologischer Bodenbelastung ist die Verwertbarkeit des anfallenden Bodenmaterials, der entsprechende Verwertungsort sowie ein Entwurf für ein Bodenschutzkonzept für den UVB 2. Stufe zu definieren. Dafür ist eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson zu beauftragen.
In der Betriebsphase wird kein Boden zusätzlich tangiert.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Boden» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Bod 01 |
Flächenbeanspruchung und Bodenbilanz (Bauphase) Die vom Projekt temporär und permanent tangierten Flächen werden erhoben. Daraus werden die anfallenden Bodenkubaturen abgeschätzt, die projektintern verwendet werden können. Die externe Verwertung für überschüssiges Bodenmaterial wird dargelegt. Für die Erarbeitung eines Bodenprojekts wird eine akkreditierte bodenkundliche Baubegleitung oder eine anerkannte ausgewiesene Fachperson beauftragt. |
|
PH-HU2 Bod 02 |
Ermittlung der chemischen und biologischen Bodenbelastung (Bauphase) Die tangierten Flächen werden beprobt und analysiert. Die Ergebnisse der Bestandsprüfung der Neophyten fliessen in die Bewertung ein (vgl. PH-HU2 UgO 01). |
|
PH-HU2 Bod 03 |
Festlegung der Bodenverwertungsklassen (Bauphase) Die Bodenverwertungsklassen für die beanspruchten Bodenflächen werden auf Basis der bereits ermittelten Bodeneigenschaften sowie der chemischen und biologischen Belastung festgelegt. |
|
PH-HU2 Bod 04 |
Auswirkungen auf den Boden während des Baus inkl. Entwurf Bodenschutzkonzept Eine Beurteilung der Auswirkungen (quantitativ, physikalisch) auf den Boden während des Baus wird vorgenommen und es werden spezifische Bodenschutzmassnahmen (Entwurf Bodenschutzkonzept) aufgezeigt. |
Verordnung über die Sanierung belasteter Standorte vom 26. August 1998, Stand am 1. Juli 2024, SR 814.680 (Altlastenverordnung, AltlV)
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)
Bauvorhaben und belastete Standorte. Ein Modul der Vollzugshilfe «Allgemeine Altlastenbearbeitung», Umwelt-Vollzug Nr. 1616 (BAFU 2016a)
GIS des Bundes: Karten Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze, des öffentlichen Verkehrs sowie des Militärs (swisstopo 2024)
GIS des Kantons Aargau: Kataster der belasteten Standorte (AGIS 2024)
Es ist kein Pflichtenheft aus der Voruntersuchung vorhanden, da der Umweltbereich «Altlasten» als nicht relevant eingestuft wurde.
In den Stellungnahmen sind keine Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Das an den Projektperimeter angrenzende Gelände des PSI Ost ist im Kataster der belasteten Standorte (KbS) des Kantons Aargau als «belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig» klassiert (KbS-Nr. AA4047-0275-1). Der Projektperimeter tangiert den belasteten Standort nicht (vgl. Fig. 5‑8). Die Gebäude, welche für die Projektrealisierung rückgebaut werden, wurden allesamt nach 1990 erstellt und weisen keine altlastenrelevanten Prozesse oder Bauschadstoffe auf (vgl. Kap. 4.6.1).
Die KbS im Bereich der zivilen Flugplätze, des öffentlichen Verkehrs sowie des Militärs enthalten in der näheren Umgebung keine Einträge (swisstopo 2024).
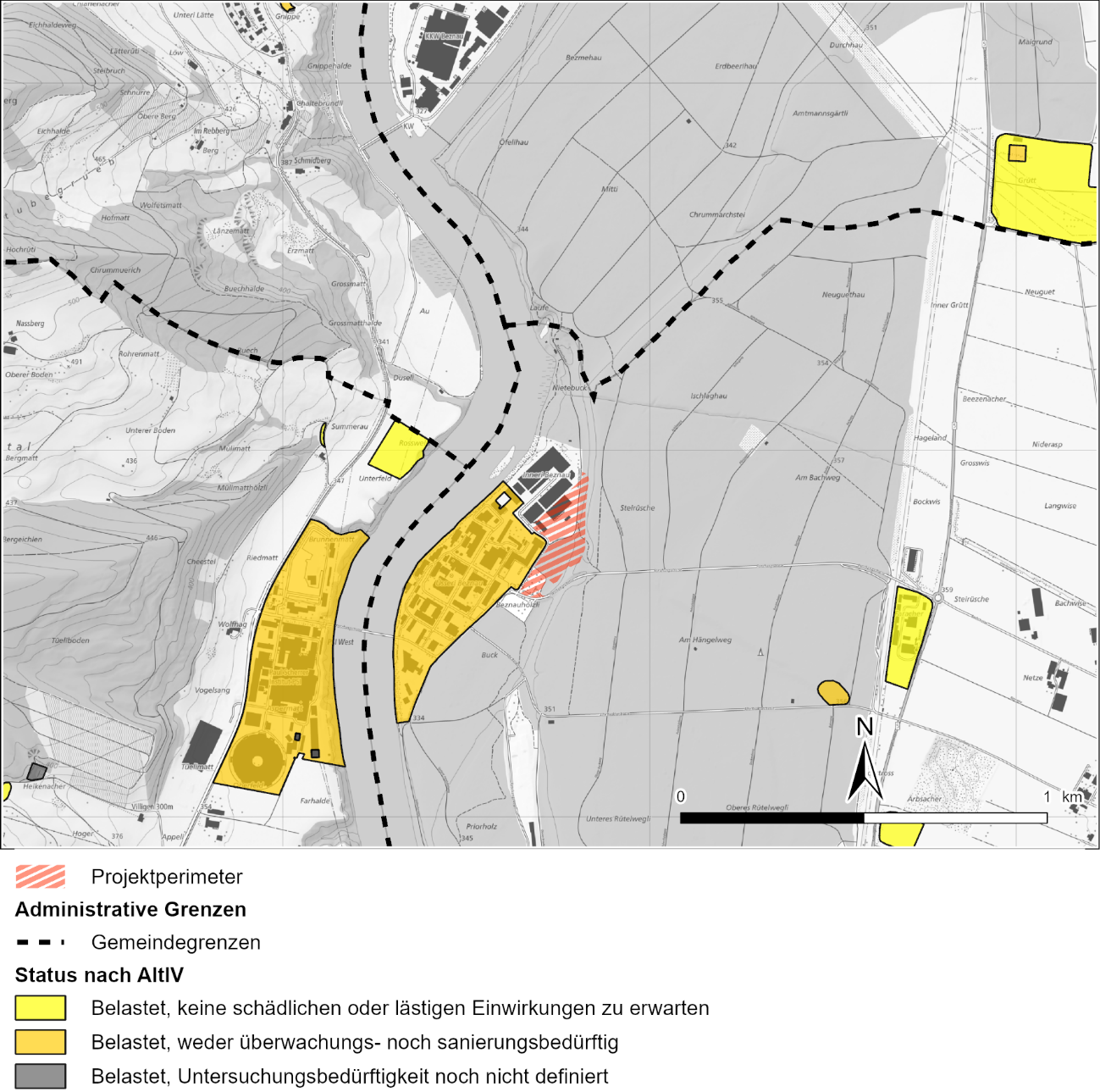
Fig. 5‑8:KbS-Auszug Kanton Aargau (AGIS 2024)
Das Vorhaben tangiert keine belasteten Standorte. Wird während der Bauphase unerwartet chemisch oder mit Fremdstoffen belastetes Aushubmaterial angetroffen (z.B. in Hinterfüllungen von Gebäuden oder im Bereich von bestehenden Strassen), wird das betroffene Material separat zwischengelagert, durch eine Altlastenfachperson begutachtet und bei Bedarf beprobt, um den Entsorgungsweg zu definieren.
Das Vorhaben tangiert keinen belasteten Standort. Der Umweltbereich «Altlasten» ist somit nicht relevant.
Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 04. Dezember 2015, Stand 1. Januar 2024, SR 814.600 (Abfallverordnung, VVEA)
Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005, Stand 1. Januar 2020, SR 814.610 (VeVA)
Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008, Stand 1. September 2024, SR 814.911 (Freisetzungsverordnung, FrSV)
Verordnung über Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998, Stand 12. April 2016, SR 814.12 (VBBo)
Bauabfälle; Ein Modul der Vollzugshilfe zur Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung (Abfallverordnung, VVEA). Umwelt-Vollzug Nr. 1826 (BAFU 2020a)
SIA 430 (SN 509 430), Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, Umbau- und Abbrucharbeiten (SIA 1993)
VSS-Norm «Asphaltmischgut, Mischgutanforderungen – Teil 8: Ausbauasphalt», SN EN 13108-8 (VSS 2019a)
Recyclingbaustoffe. Grundnorm, SN 670 071 (VSS 2022)
Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung. Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz beim Bauen, Umwelt-Vollzug Nr. 2112 (BAFU 2021a)
Wegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten, Umwelt-Vollzug Nr. 3009 (Schenk 2003)
Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub), Vollzug Umwelt VU 4812 (BUWAL 2001)
|
PH-HU1 Abf 01 |
Aufführen anfallender Abfallmengen inkl. Verwertung und Entsorgung Grobe Schätzung der projektbedingt anfallenden Abfall-Kubaturen (Aushub, Strassenaufbruch, Ausbauasphalt, Boden, Betonabbruch etc.) und der (projektintern oder -extern) wiederverwertbaren resp. zu entsorgenden Materialmengen. |
Der Rückbau der BEVA wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Abfälle, umweltgefährdende Stoffe» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 Abf 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Begründung: Art. 19 VVEA
Berücksichtigung der Anträge
Der Antrag 10 des BAFU (Vollständigkeitsprüfung) wird im Bericht berücksichtigt.
Im Anlagenperimeter befinden sich Bauten und Anlagen, die für die Realisierung des Vorhabens rückgebaut werden müssen. Bei den Bauten handelt sich um die Halle I (Stahlgerüsthalle mit Blechverkleidung) sowie die Gebäude B (Standard-Baucontainer) und C (Massivbau mit Stahlbetonfundamenten; vgl. Kap. 4.3). Die Erstellung der Bauten und Anlagen auf dem Zwilag-Areal erfolgte zwischen 1996 und 2003 (Zwilag 2022). Aufgrund des Baubeginns nach 1990 kann davon ausgegangen werden, dass keine Gebäudeschadstoffe wie Asbest, PAK und PCB / CP vorhanden sind (vgl. Kap. 4.6.1). Bei allfälligen Isolierungen in der Blechverkleidung der Halle I sowie von Rohrleitungen im Gebäude C können eventuell schadstoffhaltige FCKW- oder HBCD-Dämmungen vorhanden sein.
Der aktuelle Betrieb der Zwilag und die dazugehörigen (nuklearen) Materialflüsse sind nicht Bestandteil dieses Berichts.
Zu Beginn der Bauphase wird der heute von der Zwilag genutzte Teil des Anlagenperimeters baufrei gemacht (vgl. Kap. 4.3). Beim Rückbau der Halle I, der Gebäude B und C sowie der umgebenden Anlagen fallen Abbruch- und Rückbaumaterialen an (ausschliesslich konventionelle Abfälle; vor allem max. ca. 1'000 t Stahl, Blech, Isolierungen und Innenausbau sowie ca. 1'300 m3 (fest) resp. 2'500 t Betonabbruch, vgl. Kap. 4.6). Vor dem Rückbau der Halle I und des Gebäudes C ist abzuklären, ob Bauschadstoffe vorhanden sind, welche eine spezifische Behandlung und Entsorgung bedingen. Entsprechend der Erkenntnisse werden Massnahmen ausgearbeitet.
Weiter ist während der Bauphase aufgrund der Rodung mit biogenen Abfällen (Holz, Grüngut, vgl. Tab. 4‑3) zu rechnen. Ausserdem fallen geschätzt ca. 100'000 – 150'000 m3 (fest) Aushubmaterial und ca. 5'000 – 10'000 m3 (fest) Boden (vgl. Kap. 4.6 und 5.9) an. Ausserdem werden Abfälle in Form von Belagsaufbruch und Ausbauasphalt (ca. 800 m3 (fest), vgl. Kap. 4.6) anfallen.
Das verbleibende Aushubmaterial muss abtransportiert und entsprechend den nach Art. 19 Abs. 1 VVEA genannten Möglichkeiten möglichst vollständig verwertet werden. Dafür wird, abhängig von der Materialqualität und den künftigen Verwertungsmöglichkeiten, für die Bauphase eine Lösung gefunden werden. Eine Ablagerung auf einer Deponie ist zu vermeiden. Falls dies nicht möglich ist, ist das Material so zwischenzulagern, dass es allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden könnte, ohne dass es mit anderem Material vermischt bzw. verunreinigt wird.
Die grundsätzlichen Entsorgungs- resp. Verwertungswege der wichtigsten Materialkategorien sind aus der nachfolgenden Tab. 5‑5 ersichtlich.
Tab. 5‑5:Abfallarten und Entsorgungs-/Verwertungswege nach VVEA (2015)
|
Materialkategorie |
LVA-Code |
||
|
Boden |
unbelastet |
17 05 04 |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ A |
|
schwach belastet |
17 05 93 |
vor Ort verwerten oder auf ähnlich belastete Böden auftragen, sonst Deponie Typ B |
|
|
wenig belastet |
17 05 96 ak |
Deponie Typ B |
|
|
Aushubmaterial |
unverschmutzt |
17 05 06 |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ A |
|
schwach verschmutzt |
17 05 94 |
möglichst vollständig zu verwerten, sonst Deponie Typ B |
|
|
wenig verschmutzt |
17 05 97 ak |
Deponie Typ B |
|
|
Ausbauasphalt |
PAK < 250 mg/kg |
17 03 02 |
Belagsrecycling/Verwertung |
|
PAK > 250 mg/kg und < 1'000 mg/kg |
17 03 01 ak |
Thermische Entsorgung |
|
|
Betonabbruch |
unverschmutzt / schwach verschmutzt |
17 01 01 |
Betonrecycling / Verwertung als Rohstoff für die Herstellung von Baustoffen |
|
Eisen und Stahl |
17 04 15 |
Metallrecycling / Schmelzwerk |
|
Die Abfälle werden gemäss BAFU (2020a) möglichst sortenrein getrennt, um die umweltverträgliche Verwertung / Entsorgung der Abfälle und Rückbaumaterialien sowie die Qualität der Recyclingbaustoffe zu gewährleisten. Die Verwertungs- / Entsorgungswege werden auf Basis der Schadstoffbelastungen bestimmt. Wo nötig werden dazu entsprechende Untersuchungen durchgeführt (z.B. Ausbauasphalt).
Ein detailliertes Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept wird für den UVB 2. Stufe ausgearbeitet, in welchem die Arten, Mengen und Qualitäten des anfallenden Materials aufgezeigt werden.
Wird während der Bauarbeiten (Bauphase) unerwartet chemisch oder mit Fremdstoffen belastetes Aushubmaterial angetroffen (z.B. in Hinterfüllungen von Gebäuden oder im Bereich von bestehenden Strassen), wird das betroffene Material separat zwischengelagert, durch eine Altlastenfachperson begutachtet und bei Bedarf beprobt, um den Entsorgungsweg zu definieren.
Während der Betriebsphase ist hauptsächlich mit Verpackungsmaterialien und Mischabfall zu rechnen (vgl. Kap. 4.6.2). Betriebsabfall wird fach- und vorschriftsgerecht verwertet resp. Entsorgt. Siedlungsabfall wird einer Kehrichtverbrennungs- resp. -verwertungsanlage zugeführt. Für die Betriebsphase braucht es daher kein spezifisches Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept.
Umschlag und Behandlung radioaktiver Abfälle fallen unter das StSG (1991) und werden im Transportkonzept (Nagra 2024c) resp. im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) behandelt.
Während der Bauphase fallen diverse Abfälle an, insbesondere Aushub und Boden, Betonabbruch, Stahl sowie Ausbauasphalt, welche gemäss den geltenden Vorschriften resp. entsprechend der Möglichkeiten nach Art. 19 Abs. 1 VVEA zu verwerten resp. entsorgen sind. Eine Ablagerung auf einer Deponie ist zu vermeiden.
Ein detailliertes Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzept für die Bauphase wird für den UVB 2. Stufe ausgearbeitet.
Während der Betriebsphase ist mit wesentlich geringeren Abfallmengen, v.a. bestehend aus Verpackungsmaterialien und Mischabfall, zu rechnen. Es werden die vorschriftsgemässe Verwertungs- resp. Entsorgungswege genutzt.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Abfall und umweltgefährdende Stoffe» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Abf 01 |
Verifizieren Bauschadstoffe (Bauphase) Verifizieren, dass die rückzubauenden Bauten und Anlagen keine Bauschadstoffe enthalten. Andernfalls erfolgt eine Schadstofferhebung und es wird ein fachgerechtes Entsorgungskonzept erstellt. |
|
PH-HU2 Abf 02 |
Erstellung Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept (Bauphase) Aufzeigen der beim Bau anfallenden Abfälle (Art, Menge und Qualität) sowie Bestimmung der Wiederverwertungs- resp. Entsorgungswege. |
Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008, Stand 1. September 2024, SR 814.911 (Freisetzungsverordnung, FrSV)
Liste der invasiven und potenziell invasiven Neophyten der Schweiz. Stand 2021 (Info Flora 2021)
Neophyten. Listen & Infoblätter (Info Flora 2024)
Umgang mit abgetragenem Boden, der mit invasiven gebietsfremden Pflanzen nach Anhang 2 FrSV belastet ist. Empfehlung AGIN für den Vollzug von Art 15. Abs. 3 FrSV. Version 2.0 (Cercle Exotique 2016)
Neobiota-Strategie: Ziele und Handlungsbedarf zweite Projektphase, Departement Gesundheit und Soziales, Amt für Verbraucherschutz (Chemiesicherheit Kanton AG 2014)
GIS des Kantons Aargau: Ambrosia Fundorte ab 2020, erstellt am 31. Dezember 2020 (AGIS 2024)
|
PH-HU1 UgO 01 |
Erhebung der Neophyten-Vorkommen Abklären der vor Ort vorhandenen Standorte mit Vorkommen von invasiven Neophyten mittels Feldaufnahmen vor Baubeginn. |
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Berücksichtigung der Anträge
Auf den Antrag des BAFU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 5 BAFU: Im UVB 1. Stufe wurde eine Ersterhebung der Neophyten-Vorkommen im Projektperimeter durchgeführt. Eine weitere Aufnahme erfolgt vor Baubeginn. Die Definition von Schutzmassnahmen und die Auswahl der Pflanzenarten, welche für die Arealbegrünung verwendet werden, wird im UVB 2. Stufe vorgenommen. Das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wird entsprechend ergänzt.
Im Kanton Aargau ist kein flächendeckender Kataster mit der Verbreitung von Neobiota vorhanden (AGIS 2024). Die öffentlich verfügbaren Geodatensätze «Neobiota Beobachtung» und «Neobiota Bekämpfung» sowie die Daten aus Info Flora (2024) weisen für den Projektperimeter keine Angaben auf. Im Rahmen der Feldaufnahmen zwischen März und September 2023 wurden jedoch Neophytenbestände festgestellt.
Während der Feldaufnahmen vor Ort wurden entlang des Nietenbuckwegs am Waldrand, in den Rabattenflächen entlang der Zwilag-Gebäude und bei den Parkplätzen vereinzelte Bestände des Einjährigen Berufkrauts und des Schmetterlingsstrauches festgestellt. Im Wald östlich der Zwilag-Gebäude sind zudem vereinzelt Robinien vorhanden (vgl. Beilage A.5).
In Tab. 5‑6 sind alle in und um den Projektperimeter angetroffenen invasiven Neophyten, ihre Verbreitungswege sowie deren Status zusammengefasst.
Tab. 5‑6:Artenliste der angetroffenen Neophyten in der Umgebung des Projektperimeters
|
Artenname |
Verbreitungswege |
Vorkommen im Projektperimeter | |
|---|---|---|---|
|
Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus) |
Samen |
Invasiv |
Anlagenperimter, Eingliederungssaum und Installationsfläche |
|
Robinie (Robinia peudoacacia) |
Flugsamen, Stockausschläge und Wurzelbrut/-schösslinge (bis zu 15 m vertikale Ausbreitung). |
Invasiv |
Eingliederungssaum |
|
Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii) |
primär Flugsamen, Wurzelausläufer |
Invasiv |
Anlagenperimeter und Installationsfläche |
Da zwischen dem Ist- und dem Ausgangszustand rund 30 Jahre liegen, werden die Neophytenvorkommen für UVB 2. Stufe kontrolliert und ggf. aktualisiert.
Die angetroffenen Bestände von invasiven Neophyten tangieren den Anlagenperimeter und den Eingliederungssaum.
Zu Beginn der Bauphase werden im Anlagenperimeter und bei der temporären Installationsfläche Grünrabatten entfernt und der Boden abgetragen. Zudem wird für den Anlagenperimeter eine Fläche von rund 0.9 ha Wald gerodet und Waldboden abgetragen. Die entsprechenden Flächen gelten aufgrund der vorgefundenen invasiven Neophyten als biologisch belastet. Sowohl der Boden der Rabatten als auch der Waldboden müssen entsprechend der biologischen Bodenqualität entsorgt resp. verwertet werden (vgl. Kap. 5.9). Vor dem Bodenabtrag sind zudem entsprechende (artspezifische) Massnahmen zum Umgang mit dem Pflanzenmaterial notwendig. Die Bekämpfungsmassnahmen sowie die Entsorgung des Pflanzenmaterials der vorgefundenen invasiven Neophyten im Anlagenperimeter werden gemäss den Empfehlungen der Info Flora (2024) resp. den in rund 30 Jahren geltenden Empfehlungen ausgeführt. Für die Wiederverwertung des Bodenmaterials werden die gesetzlichen Grundlagen entsprechend Art. 7 Abs. 2 VBBo und Art. 6 FrSV berücksichtigt.
Im Eingliederungssaum wird bei der Schaffung eines Freihaltestreifens (vgl. Kap. 4.1.2) Pflanzenmaterial anfallen wird, welches z.T. mit invasiven Neophyten belastet ist und fachgerecht behandelt resp. entsorgt werden muss.
Zu Beginn der Bauphase ist das Risiko für eine Verschleppung oder Ansiedelung von invasiven Neophyten auf den brachliegenden Flächen im Bereich der temporären Installationsfläche (im Falle von kurzzeitigen Bodendepots infolge Umlagerungsarbeiten) oder des Eingliederungssaums hoch. Grünrabatten auf der temporären Installationsfläche werden daher baldmöglichst befestigt bzw. vollständig entfernt, sodass während des Baus keine invasiven Neophyten aufkommen können. Der Eingliederungssaum wird unmittelbar nach der Auslichtung begrünt (vgl. Kap. 5.14.5) und während der Bauphase durch die Umweltbaubegleitung (UBB) überwacht, um einen Neophytenbefall dieser lichten Fläche zu verhindern oder unmittelbar bekämpfen zu können. Die Bekämpfungsart und -methoden werden mit der UBB abgestimmt. Vor Baubeginn erfolgt eine Aktualisierung der Neophytenerhebung, sodass die für die Bauphase aktuellen Bestände bekannt sind und gezielte Bekämpfungsmassnahmen ergriffen werden können.
Während des Betriebs wird das Aufkommen von invasiven Neophyten durch regelmässige Kontrollen und bei Bedarf durch entsprechende Bekämpfung verhindert, mit besonderem Augenmerk auf den Eingliederungssaum.
Das Vorgehen zum Monitoring und zur Bekämpfung der invasiven Neophyten in der Betriebsphase wird für den UVB 2. Stufe festgelegt.
Im Projektperimeter befinden sich heute in der Schweiz häufig vorkommende invasive Neophyten, welche durch das Vorhaben tangiert werden. Unter Einhaltung der oben genannten Vorgaben, mit regelmässigen Kontrollen sowie bei Bedarf durch Bekämpfung kann eine Verbreitung von invasiven Neophyten im Projektperimeter während der Bauphase wirksam verhindert werden. Im UVB 2. Stufe werden für die Bauphase weitere Massnahmen und Entsorgungswege definiert.
Während des Betriebs liegt der Fokus vor allem auf der Kontrolle von neu erstellten Grünflächen in den ersten fünf Jahren nach der Erstellung, mit besonderem Augenmerk auf den Eingliederungssaum.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «umweltgefährdende Organismen» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 UgO 01 |
Kontrollieren und ggf. Aktualisieren der Neophytenbestände Die Neophytenbestände werden kontrolliert und ggf. aktualisiert. |
|
PH-HU2 UgO 02 |
Verhinderung der Neophyten-Verbreitung in der Bauphase Es werden Massnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung ausgearbeitet. Entsorgungswege werden definiert. |
|
PH-HU2 UgO 03 |
Umgang mit invasiven Neophyten in der Betriebsphase Massnahmen zu Monitoring, Bekämpfung und Unterhalt von neu erstellten Flächen werden ausgearbeitet. |
Im vorliegenden Kapitel werden lediglich nicht-nukleare Störfälle gemäss Art. 1 resp. Anhang 1.1 StFV beurteilt. Angaben zur generischen Sicherheitsbetrachtung sind im Sicherheitsbericht zu finden (Nagra 2025c).
Verordnung über den Schutz vor Störfällen vom 27. Februar 1991, Stand 1. Juli 2024, SR 814.012 (Störfallverordnung, StFV)
Verordnung über die Beförderung von gefährlichen Gütern auf der Strasse vom 29. November 2002, Stand 1. Januar 2023, SR 741.621 (SDR)
Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse vom 20. Juli 1972, Stand 1. Januar 2023, SR 0.741.621 (ADR)
Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen vom 18. Oktober 2005, Stand 1. Januar 2018, SR 814.610.1 (UVEK 2005)
Verordnung über explosionsgefährliche Stoffe vom 27. November 2000, Stand am 1. Januar 2024, SR 941.411 (Sprengstoffverordnung, SprstV)
Richtlinie Sicherheitsmassnahmen gemäss Störfallverordnung bei Nationalstrassen. V2.10 (ASTRA 2008)
Mengenschwellen gemäss Störfallverordnung (StFV), Ein Modul des Handbuchs zur Störfallverordnung. Umwelt-Vollzug Nr. 0611 (BAFU 2024c)
Kurzbericht nach Störfallverordnung. Bericht der Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG z.Hd. AVS Chemiesicherheit des Kantons Aargau vom 19.11.2018 (Zwilag 2018)
Handbuch I zur Störfallverordnung (StFV). Allgemeiner Teil. Umwelt-Vollzug Nr. 1807 (BAFU 2018b)
Beurteilungskriterien zur Störfallverordnung (StFV). Ein Modul des Handbuchs zur Störfallverordnung (StFV), Umwelt-Vollzug Nr. 1807 (BAFU 2018a)
Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe, 3. überarbeitete Auflage 2018, Umweltfach-stellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018)
GIS des Kantons Aargau: Chemierisikokataster (AGIS 2024)
|
PH-HU1 StF 01 |
Beurteilung Störfallsituation Beschreibung und Beurteilung der Projektbestandteile bezüglich Einordung in die Störfallverordnung |
|
PH-HU1 StF 02 |
Beurteilung Konsultationsbereiche Beschreibung und Beurteilung der tangierten Konsultationsbereiche und Vorgaben für die Koordination mit der Raumplanung |
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Berücksichtigung der Anträge
Auf den Antrag des BAFU wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 10 BAFU: Die Beurteilung bezüglich Überschreitung von Mengenschwellen erfolgt im UVB 2. Stufe.
Für den Nachweis der Standorteignung werden im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) unter anderem die sog. «Einwirkungen von Aussen» auf den Projektperimeter analysiert und bewertet. Darunter zählen u.a. Betriebe und Anlagen, die der Störfallverordnung (StFV 1991) unterliegen, wie das Zwilag und das PSI (beide ohne Konsultationsbereich) sowie die östlich des Projektperimeters verlaufende Erdgashochdruckleitung (Gasleitung mit Druck ≤ 67.5 Bar und Durchmesser ≤ 24 Zoll), deren 300 m breiter Konsultationsbereichs den Projektperimeter nicht tangiert und daher nicht relevant ist (vgl. Fig. 5‑9). Ebenfalls nicht relevant ist die im Osten verlaufende Kantonsstrasse Nr. K113 (vgl. Fig. 4‑6), welche als Ausnahmetransportroute klassiert ist, jedoch nicht tangiert wird. Die bestehende Fernwärmeleitung der REFUNA AG, welche den Projektperimeter und das Zwilag-Areal quert, weist keinen Konsultationsbereich auf und ist daher nicht störfallrelevant. Künftig wird zudem eine 5 bar Erdgasleitung der REFUNA AG den Projektperimeter randlich tangieren (REFUNA AG; Ausführungsprojekt). Sie ist ebenfalls nicht störfallrelevant. Im Sicherheitsbericht (Nagra 2025c) wir aufgezeigt, dass von diesen Betrieben bzw. Anlagen keine Gefahr für den Projektperimter bzw. die BEVA ausgeht.
Für die Zwilag wurde im November 2018 ein Kurzbericht gemäss StFV erstellt (Zwilag 2018). Es werden hauptsächlich Säuren und Laugen, aber auch grössere Mengen von verschiedenen Gasen sowie Diesel gelagert. Im Kurzbericht wurde ein Szenario mit kleiner bis mittlerer Schädigung für Personen auf dem Zwilag-Areal im Falle eines Ammoniakaustrittes festgestellt. Mit den vorhandenen Sicherheitsmassnahmen sind keine Auswirkungen ausserhalb des Zwilag-Areals zu erwarten.
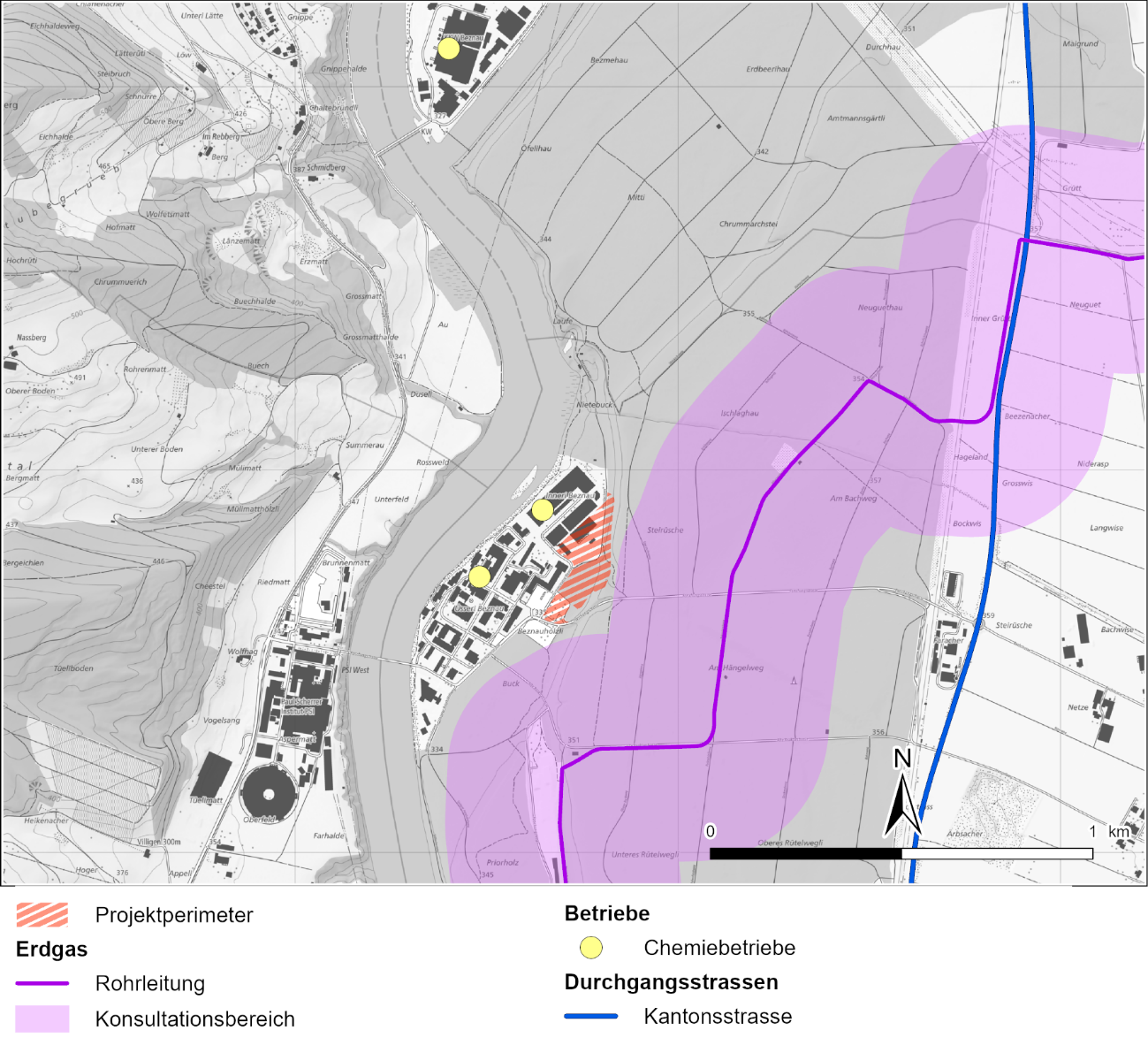
Fig. 5‑9:Auszug Risikokataster Kanton AG (AGIS 2024)
Die Mengenschwellen von StFV-relevanten Gefahrenstoffen werden bei Baustellen der vorliegenden Grössenordnung üblicherweise nicht überschritten. Meist werden nur Kleinmengen von Gefahrenstoffen (z.B. Diesel, Bauhilfsstoffe) verwendet und/oder umgeschlagen. Der Bereich Störfallvorsorge ist daher in der Bauphase vermutlich nicht relevant. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu verifizieren und bei Bedarf wird ein Kurzbericht nach StFV erstellt.
Die Richtlinien zur Lagerung und zum Umschlag gefährlicher Stoffe sind dabei einzuhalten (Umweltfachstellen der Kantone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und ZH sowie der Gebäudeversicherung Kanton Zürich 2018). Gefahrenstoffe sind entsprechend der Vorgaben ihrer Lagerklasse räumlich getrennt und bspw. in Auffangwannen, sicheren Lagerbehältern und/oder in abschliessbaren Containern zu lagern. Die Gefahrenstoffe sind mit ihren Gefahrensymbolen nach Chemikalienverordnung (ChemV 2015) klar zu kennzeichnen.
Als Anlage, die der Kernenergie- und Strahlenschutzgesetzgebung unterstellt ist, unterliegt die BEVA gemäss Art. 1 Abs. 4 StFV bezüglich Umgang mit radioaktiven Materialien nicht der StFV. Der Katastrophenschutz bzw. die Folgen eines Auslegungsstörfalls werden daher im Rahmen des UVB nicht behandelt.
In der Betriebsphase benötigt die BEVA voraussichtlich verschiedene Gefahrstoffe als Betriebsmittel (z.B. Diesel / Heizöl). Es kann davon ausgegangen werden, dass keine Gefahrstoffe und Zubereitungen in Mengen über den Mengenschwellen nach Anhang 1.1 StFV im Projektperimeter gelagert oder verwendet werden. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu verifizieren. Bei Bedarf wird ein Kurzbericht nach StFV erstellt.
Die Mengenschwellen nach Anhang 1.1 StFV werden vermutlich weder in der Bau- noch in der Betriebsphase überschritten. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu verifizieren. Sollten während der Bau- oder der Betriebsphase nach StFV relevante Mengen Gefahrenstoffe im Anlagenperimeter zwischengelagert werden, ist für den UVB 2. Stufe ein Kurzbericht nach StFV zu erstellen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Störfallvorsorge / Katastrophenschutz» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 StF 01 |
Beurteilung Störfallsituation (Bau- und Betriebsphase) Beschreibung und Beurteilung der Störfallsituation im Projektperimeter bzgl. Gefahrenstoffen und Mengenschwellen. Bei Bedarf wird ein Kurzbericht nach StFV erstellt. |
-
Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991, Stand 1. Januar 2022, SR 921.0 (Waldgesetz, WaG)
-
Verordnung über den Wald vom 30. November 1992, Stand 1. Juli 2021, SR 921.01 (Waldverordnung, WaV)
-
Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz – Voraussetzungen zur Zweckentfremdung von Waldareal und Regelung des Ersatzes. Umweltvollzug Nr. UV-1407 (BAFU 2014)
-
Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen vom 19. Januar 1993, Stand am 1. Juli 2024, SAR 713.100 (Baugesetz, BauG)
-
Waldgesellschaften und Waldstandorte der Schweiz, Schweizerische Anstalt für das forstliche Versuchswesen: Vol. 48/4 (Ellenberg, H., Klötzli, F. 1972)
-
Lebensräume der Schweiz, Ökologie – Gefährdung – Kennarten, 3. vollständig überarbeitete Auflage (Delarze et al. 2015)
-
Richtplan Kanton Aargau (Kanton Aargau 2011)
-
GIS des Kantons Aargau: Richtplan, L 2.5 (AGIS 2024)
-
GIS des Kantons Aargau: Pflanzengesellschaften im Wald (AGIS 2024)
|
PH-HU1 Wal 01 |
Beschreibung des vom Projekt betroffenen Walds Beschreibung der im Projektperimeter liegenden Wälder (anhand Vegetationskarten aus kantonalen GIS) und deren ökologischer Werte. |
|
PH-HU1 Wal 02 |
Ermittlung der permanenten Rodungsflächen, Bezeichnung der Ersatzaufforstungsflächen und Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmenkonzept für kant. Schutzgebiete Die projektbedingt definitiv zu rodenden Waldflächen werden ermittelt und dargestellt. Die Flächen für die Ersatzaufforstung werden definiert und dargestellt. Die Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmenkonzepte für kantonales Naturschutzgebiet im Wald werden erstellt. |
|
PH-HU1 Wal 03 |
Erarbeitung Rodungsgesuch (Bundesverfahren) Für die Rodungen und Aufforstungen der Ersatzfläche(n) ist ein Rodungsgesuch zu erarbeiten. Darin ist die Einhaltung der Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nachzuweisen (insbesondere die raumplanerische Standortbegründung). |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Wald» gewonnen werden. Die Punkte PH-HU1 Wald 02 und 03 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft UVB 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Der Kanton Aargau, Abteilung Umwelt, hat in seiner Stellungnahme vom 27. Januar 2023 folgenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgenden ergänzenden Antrag zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und des Kantons Aargau wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 7 BAFU und Antrag AG Wald 1: Im UVB 1. Stufe resp. im BAR (Nagra 2025a) werden die ungefähren Rodungsflächen ausgewiesen. Weiter wird die maximal benötigte Freihaltungsfläche (sicherheits- und sicherungsbedingte Rodung) ausgewiesen. In der UVB 2. Stufe resp. im BAR für die 2. Stufe werden die tatsächlich benötigte Rodungsflächen festgelegt und ein Rodungsgesuch (Bundesverfahren) erstellt. Zudem werden die Ersatzaufforstungsflächen festgelegt, wie auch ggf. das Ausnahmegesuch für die nachteilige Waldnutzung beantragt.
-
Antrag 6 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Begrifflichkeiten werden im Bericht präzisiert und der Antrag berücksichtigt.
Der Projektperimeter ist nördlich und westlich von Wald umgeben (vgl. Fig. 5‑10). Gemäss pflanzensoziologischer Kartierung des Kantons Aargau (Waldgesellschaften nach Ellenberg, H., Klötzli, F. 1972) ist bei den Wäldern grösstenteils mit «Waldmeister-Buchenwäldern» sowie im südöstlichen Projektperimeter stellenweise mit «Simsen- und Kalk-Buchenwäldern» zu rechnen.
Im Rahmen der Feldaufnahmen vor Ort wurden die vom Vorhaben tangierten Waldlebensräume nach Delarze et al. (2015) bestimmt. Dabei wurde der Lebensraum abweichend von der pflanzensoziologischen Kartierung im südlichen Projektperimeter als «Ahorn-Schluchtwald» (Rote-Liste-Status: LC, Nat. P: 0; vgl. Tab. 5‑8) mit Übergängen zum Waldmeister-Buchenwald klassiert. Weil keiner der beiden Lebensräume vollständig passend ist und im Baumbestand vor allem Ahorn und Eschen, jedoch nur sehr wenige Buchen vorkommen, wurde der Ahorn-Schluchtwald als Hauptlebensraum definiert. Im nördlichen Projektperimeter wurde der Wald als Flaumeichenwald (Rote-Liste-Status: LC, Nat. P: 0; vgl. Tab. 5‑8) identifiziert (vgl. Übersichtsfigur in der Beilage A3). Sowohl beim Ahorn-Schluchtwald wie auch beim Flaumeichenwald handelt es sich gemäss NHV um schützenswerte Lebensräume (vgl. Kap. 5.15.4), welche ersatzpflichtig sind. Im Ahorn-Schluchtwald wurden keine geschützten oder Rote-Liste (RL)-Arten festgestellt. Im Flaumeichenwald kommt die RL-Art Drüsige Bergminze vor, welche gemäss nationaler RL als potenziell gefährdet (NT) eingestuft wird. Die Art weist jedoch keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung auf.
Der Wald im Norden des Projektperimeters gehört zum Auenschutzpark (Richtplan L 2.2, Fig. 5‑11). Der Wald am östlichen Rand des Projektperimeters ist als NkBW (Richtplan L 4.1, Fig. 5‑11) ausgeschieden.
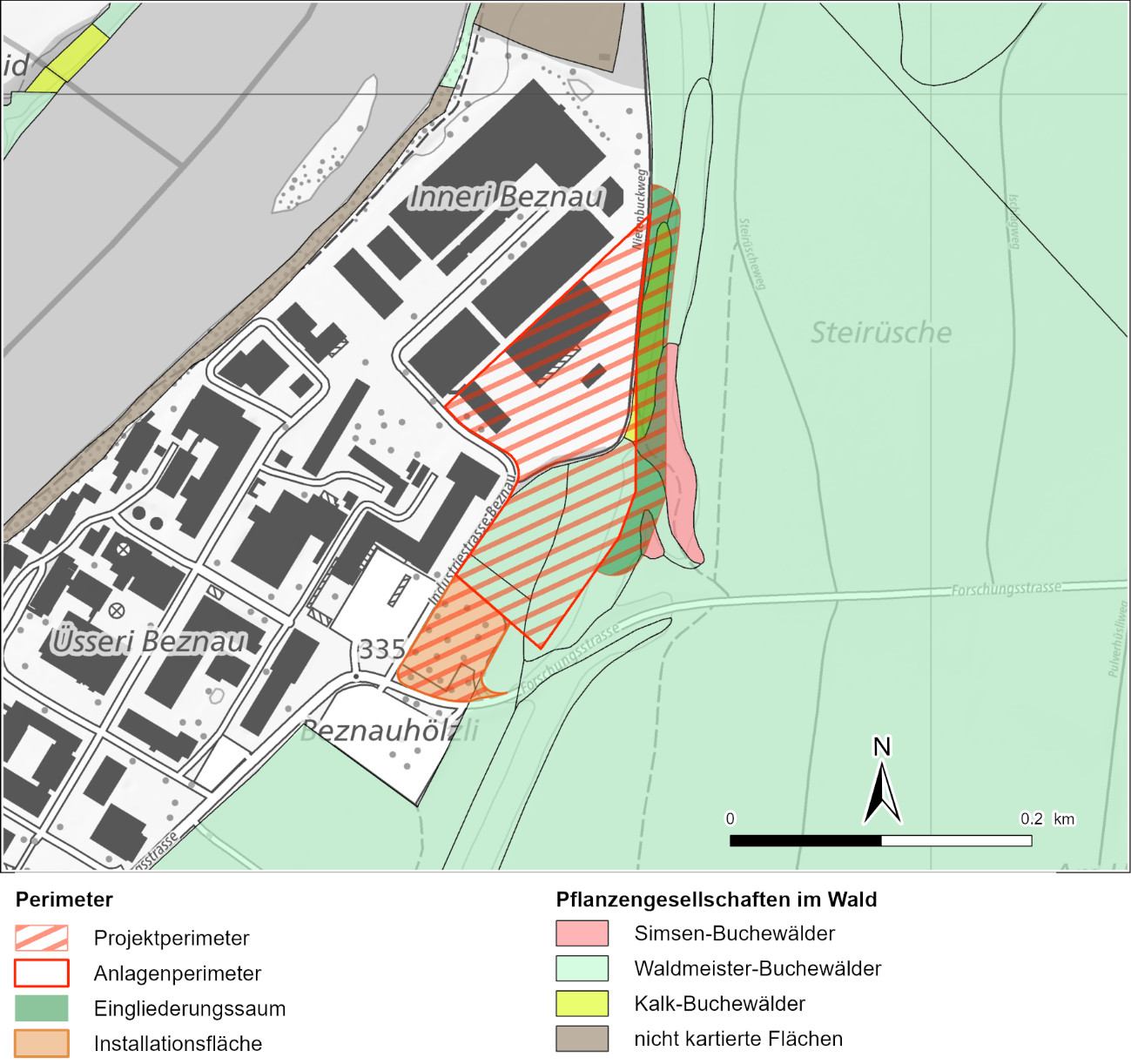
Fig. 5‑10:Pflanzensoziologische Kartierung der Waldflächen in verdichteter Form (AGIS 2024)
Zu Beginn der Bauphase müssen rund 0.9 ha Wald für die zukünftigen Nutzungen im Anlagenperimeter definitiv gerodet werden (vgl. Kap. 4.1.4). Nach Art. 4 WaG gilt jede dauernde oder vorübergehende Zweckentfremdung von Waldboden als Rodung. Rodungen sind nach Art. 5 Abs. 1 WaG verboten. Ausnahmebewilligungen sind nach Art. 5 Abs. 2 WaG möglich, wenn für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen, und das Werk auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist. Weiter muss das Vorhaben die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen und die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen (BAFU 2014, Art. 5 WaG). Es ist Rodungsersatz nach Art. 7 WaG zu leisten. Die definitive Rodung wird im Baubewilligungsverfahren nach KEG beantragt und mit der Baubewilligung erteilt (Art. 49 Abs. 2 KEG).
Für die Sicherheit und Sicherung der der BEVA als Kernanlage ist im Eingliederungssaum ein maximal 20 m breiter, voraussichtlich gehölzfreier «Freihaltestreifen» angrenzend an den Anlagenperimeter notwendig. Im waldrechtlichen Sinne handelt es sich bei einem solchen Freihaltestreifen ebenfalls um eine definitive Rodung gemäss Art. 5 WaG (Verfahren wie oben). Angrenzend an den Freihaltestreifen soll aus waldbaulichen Gründen wieder ein Waldrand erstellt werden (waldpflegerische Massnahme).
Nach heutigen Planungsannahmen soll der bestehende Nietenbuckweg abschnittsweise aufgehoben und in den Eingliederungssaum verlegt werden (vgl. Kap. 4.1.2). Die genaue Linienführung wird mit dem Baugesuch beantragt. Der bestehende Nietenbuckweg hat keine Erschliessungsfunktion für Nutzungen innerhalb der Bauzone. Im nördlichen Teil verläuft er im Waldareal, was ebenfalls auf einen Hauptzweck als «Waldstrasse» hinweist. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass die vorgesehene Verlegung waldrechtlich gesehen keine Rodung darstellt.
Die effektive Ausgestaltung und Pflege des Eingliederungssaums muss sich an der Anordnung der Bauten und Anlagen im Anlagenperimeter orientieren. Diese wird im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens nach KEG festgelegt.
Die tatsächlich benötigte Rodungsfläche zur Schaffung eines Freihaltestreifens im Eingliederungsaum wird für das Baugesuch bestimmt. Sie ergibt sich aus der Anordnung der Bauten und Anlagen im Anlageperimeter und muss sich an sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben an eine Kernanlage orientieren. Das Vorhaben wird so entwickelt, dass die tatsächlich zu rodende Breite des Freihaltestreifens nur so gross wie nötig ist, max. 20 m.
Der Anlagenperimeter wird voraussichtlich stellenweise bis an die Grenzen ausgenutzt, was eine Unterschreitung des Waldabstandes zur Folge haben kann, falls der gehölzfreie Freihaltestreifen an diesen Stellen zur Gewährleistung von Sicherheit und Sicherung nicht 20 m breit sein muss.
Gemäss § 48 Abs. 1 Bst. a BauG gilt für Gebäude und gebäudeähnliche Bauten ein Waldabstand von 18 m. Aus wichtigen Gründen können die zuständigen Behörden die Unterschreitung des Mindestabstands unter Auflagen und Bedingungen bewilligen (Art. 17 Abs. 3 WaG). Für den UVB 2. Stufe sind Begründungen für allfällige Waldabstandsunterschreitungen beizubringen. Weiter sind Massnahmen zum Schutz des Waldrands zu definieren.
Die korrekte waldrechtliche Handhabung der gesamten beanspruchten Waldfläche im Eingliederungssaum wird unter Beizug des Forstdiensts des Kantons Aargau definitiv festgelegt (Rodung, Freihaltung resp. sicherungsbedingte Rodung, nachteilige Nutzung von Wald und Waldabstandsunterschreitungen).
Zusammenfassende Begründung für Rodung, Freihaltung und Waldabstandsunterschreitung
-
Die Realisierung der BEVA wird Eingriffe in den Wald verursachen. Ein besser geeigneter Standort angrenzend an die Zwilag ohne Rodungen ist nicht vorhanden (vgl. Kap. 6.6 in Nagra 2025a). Die Grundstücke der Zwilag grenzen allseitig an das Waldareal, die Flächen des PSI innerhalb der Bauzone sind nicht verfügbar und die Grundstücke der Zwilag können nicht so weit verdichtet und umstrukturiert werden, dass die BEVA sowie die zum Betrieb benötigten, weiteren Gebäude vollständig innerhalb der Bauzone realisiert werden könnten (vgl. Kap. 4, Nagra 2025a). Mit der gewählten, realisierbaren Standortvariante «Mitte optimiert» (Variantenstudium, vgl. Kap. 4.2 Nagra 2025a) konnte ein Standort gefunden werden, der mehrheitlich in einer bestehenden Bauzone liegt und mit dauerhaften Rodungen in nur geringem Umfang (max.1.41 ha) verbunden ist und somit die geringstmöglichen Auswirkungen auf den Wald aufweist.
-
Eine Kernanlage ist gemäss den Vorgaben des ENSI an den Brandschutz so auszulegen, dass die Entstehung von Bränden vorgebeugt und die Ausbreitung eines Brands reduziert wird (Ensi 2024). Mit einem gehölzfreien, brandlastbegrenzten Freihaltestreifen angrenzend an
die Kernanlage können die potenziellen Auswirkungen eines Waldbrands auf die Anlageteile reduziert werden und somit ein Übergreifen eines Waldbrands auf den Anlagenperimeter verhindert werden (Kap. 4.2.6 in Nagra 2025c). -
Ein Freihaltestreifen ist auch aus Gründen der Sicherung des Anlagenperimeters als vorteilhaft einzustufen. Zur Sicherung einer Kernanlage wird die Einsehbarkeit der Umgebung von der Anlage aus gefordert (Kap. 3.2 in Nagra 2025d). Die Sicherungsmassnahme
zielt darauf ab, die nukleare Sicherheit gegen unbefugte Einwirkungen zu gewährleisten. Potenzielle Täter sollen von ihrem Vorhaben abgeschreckt und bei einem Angriff erkannt werden (UVEK 2007, UVEK 2008).
Mit dem Baugesuch werden ein Rodungsgesuch für die definitive Rodung eingereicht, Ersatzflächen bezeichnet und im UVB 2. Stufe eine Begründung für die Notwendigkeit dieser Rodung vorgelegt. Für die Waldabstandsunterschreitungen wird im Baugesuch ggf. eine Ausnahmebewilligung beantragt (vgl. Kap. 2.3) und im UVB 2. Stufe eine Begründung dafür beigebracht.
Die beeinträchtigten Waldstandorte sind gemäss NHV als schützenswert einzustufen und sind zudem teilweise als NkBW ausgeschieden. Die Ersatzpflicht gemäss NHV wird im Kap 5.15 behandelt.
Während der Betriebsphase werden keine zusätzlichen Waldstandorte tangiert.
Die Waldbewirtschaftung und der Unterhalt des Eingliederungssaum werden mit der zuständigen Forstwirtschaftsbehörde resp. der Grundeigentümerin (Gde. Würenlingen) koordiniert.
Für den Anlagenperimeter wird eine Waldfläche von rund 0.9 ha definitiv beansprucht, sie muss daher gerodet werden. Für das Baugesuch wird die tatsächlich benötigte Fläche (max. 0.51ha) für eine zusätzliche Rodung im Eingliederungssaum (Freihaltestreifen) aufgrund der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben bestimmt.
Für die tatsächlich benötigte Rodungsfläche wird ein Rodungsersatz nach Art. 7 WaG geleistet. Für das Baugesuch sind Ersatzaufforstungen festzulegen und ein Rodungsgesuch zu erarbeiten. Alle Ersatzaufforstungsflächen werden im UVB 2. Stufe ausgewiesen und behandelt. Daneben ist ein Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmenkonzept für das NkBW vorzusehen.
Für die waldbauliche Ausgestaltung des Waldrands wird das Einverständnis der Grundeigentümerin (Gde. Würenlingen) eingeholt. Für allfällige Unterschreitungen des Waldabstands ist im Baubewilligungsverfahren eine forstrechtliche Ausnahmebewilligung erforderlich. Schliesslich ist das beanspruchte Teilstück des bestehenden Nietenbuckwegs (Waldweg) zu ersetzen.
Die Voraussetzungen (Interessenabwägung, raumplanerische Standortbegründung) für die erforderlichen Ausnahmebewilligungen für die Waldbeanspruchung sind gemäss den oben genannten Begründungen gegeben.
Die Betriebsphase ist bezüglich des Umweltbereichs Wald nicht relevant.
Vorbehältlich der Sicherung von Ersatzflächen sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Wald» eingehalten werden.
|
PH-HU2 Wal 01 |
Definitive Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen Der Flächenbedarf für die definitiv zu rodende Waldfläche wird ermittelt und die Flächen für die Ersatzaufforstung festgelegt. |
|
PH-HU2 Wal 02 |
Neue Wegführung und Ausgestaltung Nietenbuckweg Die projektverträgliche, neue Wegführung, der Flächenbedarf und die Ausgestaltung des Nietenbuckwegs werden in einem Plan festgehalten. |
|
PH-HU2 Wal 03 |
Erarbeitung Rodungsgesuch (Bundesverfahren) Für die Rodungen und Aufforstung der Ersatzfläche(n) ist ein Rodungsgesuch mit Rodungs- und Ersatzaufforstungsplänen zu erarbeiten. Darin ist die Einhaltung der Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung nachzuweisen. |
|
PH-HU2 Wal 04 |
Unterschreitung Waldabstand Die Anlageteile, welche den Waldabstand unterschreiten werden ermittelt und in einem Plan festgehalten. Für die Unterschreitung des Waldabstands ist eine forstrechtliche Ausnahmebewilligung inkl. Begründung zu beantragen. |
|
PH-HU2 Wal 05 |
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmenkonzept für kant. Schutzgebiet Ein Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmenkonzept für das NkBW wird erstellt. |
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966, Stand 1. Januar 2022, SR 451 (NHG)
Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vom 20. Juni 1986, Stand am 1. Januar 2022, SR 922.0 (Jagdgesetz, JSG)
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991, Stand 1. Juni 2017, SR 451.1 (NHV)
Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung vom 15. Juni 2001, Stand am 1. November 2017, SR 451.34 (Amphibienlaichgebiete-Verordnung, AlgV)
Vollzugshilfe Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Vollzug Umwelt (BUWAL 2002b)
Korridore für Wildtiere in der Schweiz – Grundlagen zur überregionalen Vernetzung von Lebensräumen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 326 (Holzgang et al. 2001)
Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz – Die Eingriffsregelung nach schweizerischem Recht, Leitfaden Umwelt Nr. 11 (Kägi et al. 2002)
Rote Listen: Gefährdeten Arten der Schweiz (BAFU 2024d)
Bewertungsmethode für Eingriffe in schützenswerte Lebensräume (Bühler et al. 2017)
Richtplan Kanton Aargau (Kanton Aargau 2011)
GIS des Kantons Aargau: Wildtierkorridore (AGIS 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN; swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der eidgenössischen Jagdbanngebiete (swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung (swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung (swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Vernetzungssystem Wildtiere (swisstopo 2024)
|
PH-HU1 FFL 01 |
Bewertung von Eingriffen und Bemessung Bedarf an Ersatzmassahmen Bewertung der Eingriffe in die Flora, Fauna und Lebensräume und Angaben zur Ersatzpflicht. |
|
PH-HU1 FFL 02 |
Feldaufnahmen Flora / Lebensräume Anhand von Feldaufnahmen vor Ort werden auf den tangierten Flächen die Flora (inkl. geschützter und Rote-Liste-Arten) sowie schützenswerte Lebensräume nach Delarze aufgenommen (inkl. Waldflächen) und die Ersatzpflicht gemäss NHV definiert. |
|
PH-HU1 FFL 03 |
Feldaufnahmen Fauna Anhand der Daten aus der Datenbank des Schweizer Zentrums für die Kartographie der Fauna (CSCF) werden tangierte Hotspots von schützenswerten Arten identifiziert, diese mit Feldaufnahmen vor Ort verifiziert und die schützenswerten Lebensräume sowie die Ersatzpflicht gemäss NHV definiert. |
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Flora, Fauna, Lebensräume» gewonnen werden. Der Punkt PH-HU1 FFL 01 aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe wird daher in das Pflichtenheft UVB 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Der Kanton Aargau, Abteilung Landschaft und Gewässer (ALG), hat in seiner Stellungnahme vom 27. Januar 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1):
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 folgende ergänzenden Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.3):
Die Nagra hat im NTB 24-14 das Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe wie folgt anzupassen: Die Nagra hat ökologische Ausgleichsmassnahmen zu leisten. Im UVB 2. Stufe sind ökologische Ausgleichsmassnahmen vorzuschlagen.
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und des Kantons Aargau sowie des BAFU (Vollständigkeitsprüfung) wird folgendermassen eingegangen:
-
Antrag 1 BAFU: Die Interessenabwägung sowie die raumplanerische Standortbegründung für Eingriffe in schutzwürdige Lebensräume werden im BAR (Nagra 2025a) behandelt.
-
Antrag 2 BAFU: Der Antrag wird im UVB 1. Stufe bearbeitet, die Ergebnisse der Feldaufnahmen sind im Kap. 5.15.4 beschrieben.
-
Antrag 3 BAFU: Siehe Kommentare zu den kantonalen Anträgen.
-
Antrag 4 BAFU und Antrag 3 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Materialisierung und endgültige Ausführung der Gebäude erfolgt im Rahmen des weiteren Bewilligungsverfahrens gemäss KEG. Die Anträge werden im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 6 BAFU: Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag AG Ökol. Ausgleich 1 und 2 und Antrag 1 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Im UVB 1. Stufe werden die Lebensräume und deren Qualität ermittelt. Die Festlegung der benötigten Ersatzmassnahmen ist für den UVB 2. Stufe vorgesehen. Dies wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt. Ebenfalls werden für das Baugesuch ökologische Ausgleichsmassnahmen definiert und im Pflichtenheft für den UVB 2 Stufe berücksichtigt.
- Anträge 2 und 4 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Anträge werden im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
Inventarisierte Schutzgebiete
Das NkBW (Richtplan L 4.1, vgl. Fig. 5‑11) befindet sich östlich des Projektperimeters und wird randlich durch den Anlagenperimeter (rund 300 m2) sowie durch den Eingliederungssaum (ca. 0.5 ha) tangiert (vgl. Tab. 4‑1). Nördlich des Projektperimeters befindet sich zudem ein Teil des «Auenschutzparks Aargau» (Schutzgebiet von kantonaler Bedeutung, Richtplan L 2.2, vgl. Fig. 5‑11).
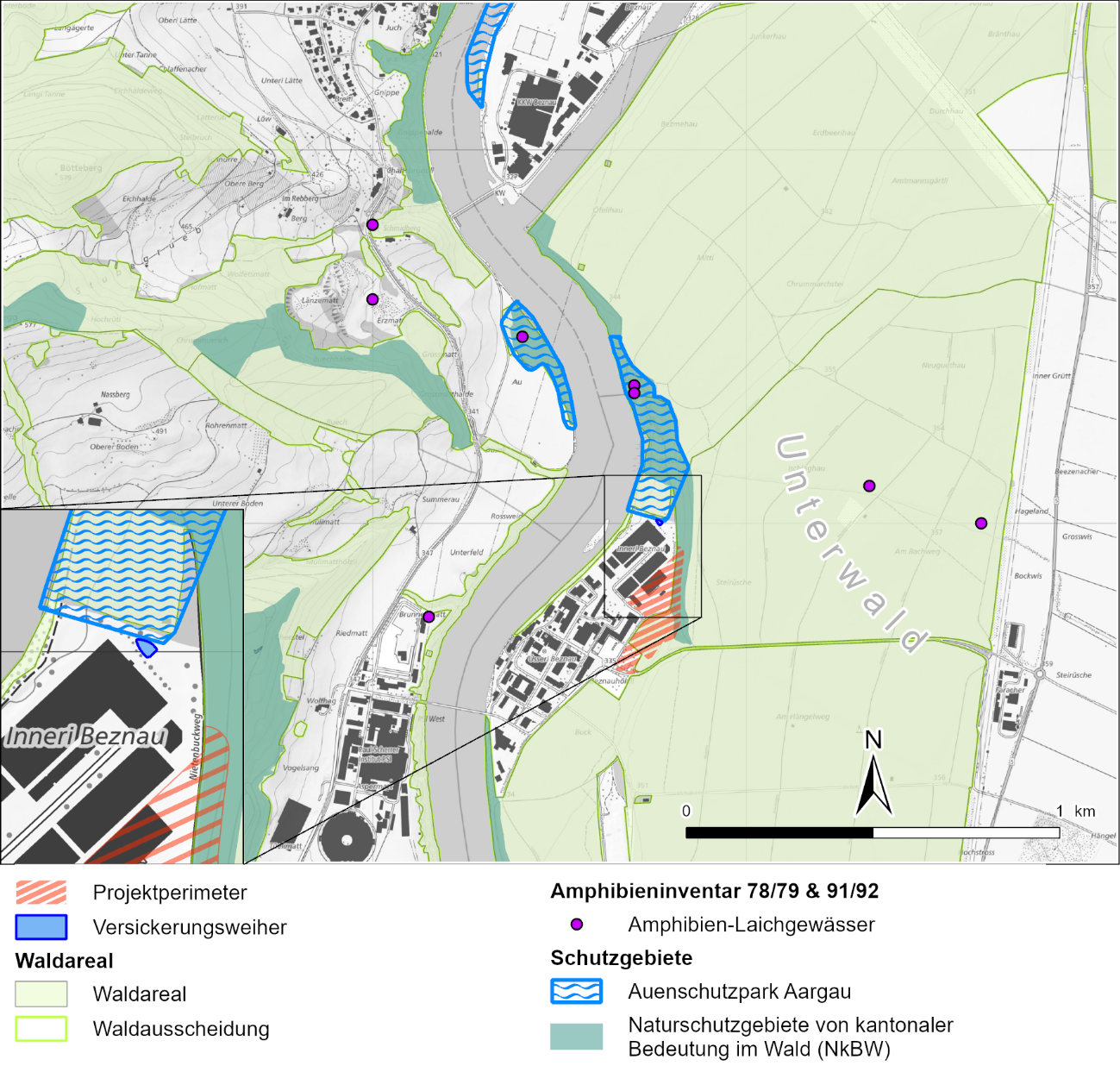
Fig. 5‑11:Projektperimeter mit NkBW, Auenschutzpark Aargau und Amphibien-Laichgewässer der Amphibieninventare 78/79 und 91/92 sowie den rechtlich geltenden (statischen) Waldgrenzen (AGIS 2024)
Wildtierkorridore und Vernetzung
Nördlich des Projektperimeters verläuft der überregionale Wildtierkorridor AG-05 Böttstein-Villigen von Nordosten nach Südwesten (vgl. Fig. 5‑12). Der Projektperimeter führt entlang der Waldränder des sog. «Unterwalds», welche als wichtige Vernetzungsachsen zum Auenschutzpark und als Übergangslebensräume dienen. Östlich schliesst der Projektperimeter über weite Strecken an das eingezäunte Zwilag-Areal an. Im Rahmen der Neukonzessionierung des Hydraulischen Kraftwerks Beznau wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau eine ökologische Aufwertung des Wildtierkorridors AG-05 im Bereich des orographisch linken Aareufers umgesetzt (Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer 2022).
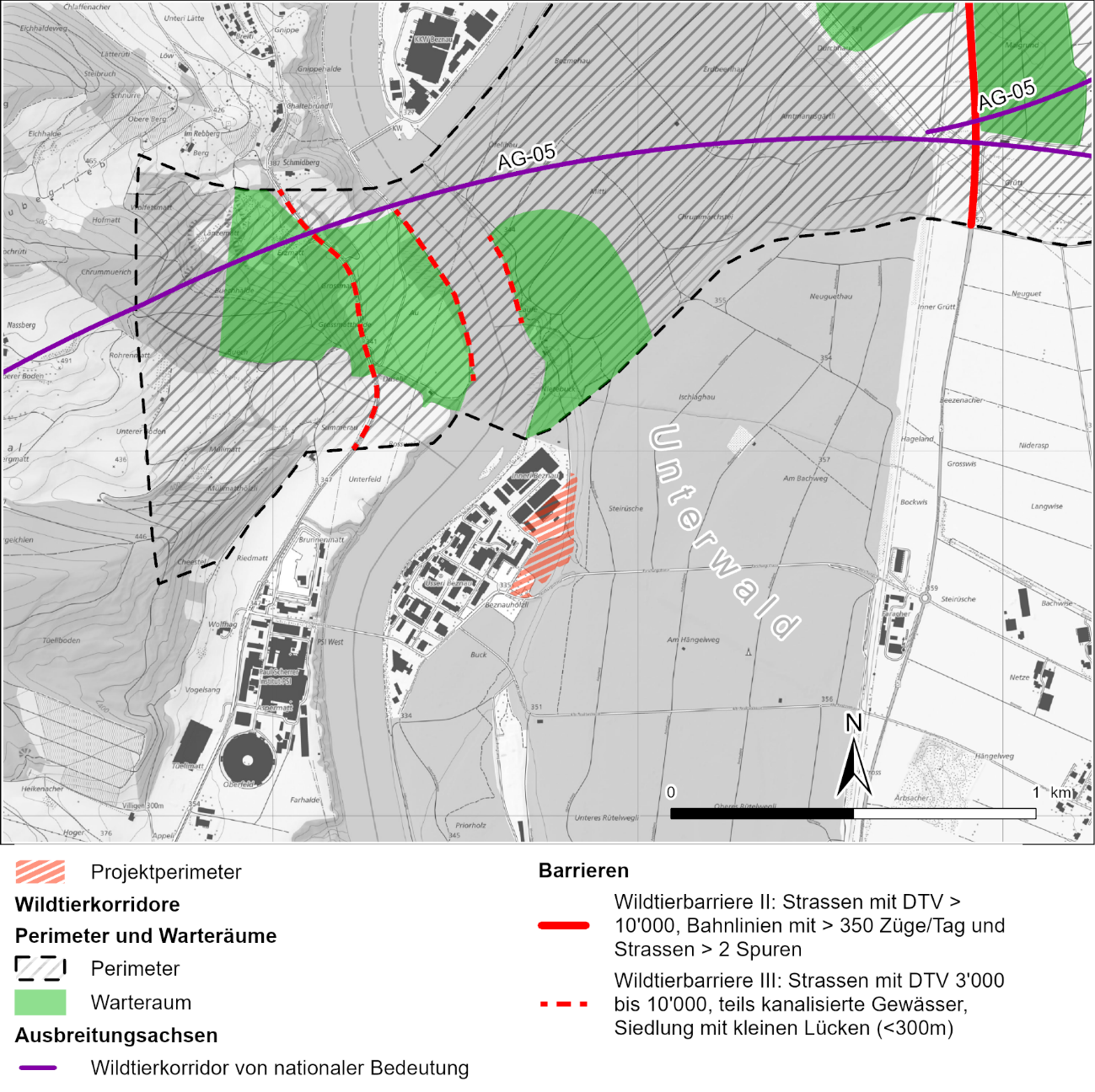
Fig. 5‑12:Ausschnitt Wildtierkorridor (AGIS 2024)
Lebensräume
Im Rahmen der Feldaufnahmen am 27.04.2023, 05.06.2023, 08.06.2023, 17.07.2023 sowie am 21.07.2023 wurde die Vegetation inklusive Gefährdungsstatus (Rote Liste-Arten, RL) und geschützte Arten aufgenommen sowie die Lebensräume gemäss Delarze et al. (2015) bestimmt (Übersichtsplan und Artenliste in der Beilage A2). Östlich des Projektperimeters befindet sich ein ökologisch wertvoller Eichenwald mit nährstoffreichen Krautsäumen, welche zum NkBW gehören. Im Flaumeichenwald kommt die RL-Art Drüsige Bergminze vor, welche gemäss nationaler RL-Liste als potenziell gefährdet (NT) eingestuft wird. Die Art weist jedoch keine nationale Priorität oder internationale Verantwortung auf. Auf dem Zwilag-Areal selbst sind fragmentierte, teilweise ruderale Grünflächen vorhanden. Es konnten dort weder RL-Arten (Gefässpflanzen) noch geschützte Arten festgestellt werden.
Die Bewertung der gefährdeten Arten der Schweiz (RL) wurde nach den Gefährdungskategorien der IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) vorgenommen (vgl. Tab. 5‑7).
Neben der «Nationalen Gefährdung» wird die «Nationale Priorität» einer Art bzw. Lebensraum bezüglich der (Art-)Erhaltung und -förderung beurteilt (Priorität 1: sehr hoch, 2: hoch, 3: mittel, 4: mässig). Die nationale Priorität ergibt sich aus der Gefährdung und der Höhe der internationalen Verantwortung, welche die Schweiz für die Art trägt (BAFU 2019).
Tab. 5‑7:Erläuterung des RL-Status (BAFU 2024d)
|
Rote Liste Status |
Beschreibung IUCN |
Beschreibung Schweiz |
|---|---|---|
|
RE |
regionally extinct |
In der Schweiz ausgestorben |
|
CR |
critically endangered |
Vom Aussterben bedroht |
|
EN |
endangered |
Stark gefährdet |
|
VU |
vulnerable |
Verletzlich |
|
NT |
near threatened |
Potenziell gefährdet |
|
LC |
least concern |
Nicht gefährdet |
|
DD |
data deficient |
Ungenügende Datengrundlage |
|
NE |
not evaluated |
Nicht beurteilt |
Bei den im Perimeter vorkommenden schützenswerten Lebensräumen gemäss NHV handelt es sich um magere Ruderalflächen, wertvolle Waldstandorte sowie Lebensräume für Reptilien und Amphibien (vgl. Tab. 5‑8). In der Beilage A3 resp. A4 ist eine Lebensraumkarte inklusive Artenliste aufgeführt.
In der nachfolgenden Tab. 5‑8 sind die im und um den Projektperimeter vorkommenden Lebensräume und ihr Schutzstatus aufgeführt:
Tab. 5‑8:Lebensräume im und um den Projektperimeter nach Delarze et al. (2015)
|
Lebensraumtyp |
Talfettwiese (Typische Fromentalwiese) (Arrhenatherion typicum, InfoFlora Nr. 4.5.1.2) |
Talfettwiese (Trockene Fromentalwiese) (Arrhenatherion salvietosum, InfoFlora Nr. 4.5.1.3) |
Mesophile Ruderalflur (Dauco-Melilotion, InfoFlora Nr. 7.1.6) |
|---|---|---|---|
|
Beschreibung |
Typische Fromentalwiesen zwischen Parkflächen, am Waldrand sowie dem Zwilag-Areal, teilweise Einfluss des Waldrandes und der angrenzenden Ruderalflächen (Feldaufnahme Nr. 1.1). Typisch ist das Vorkommen von verschiedenen Gräsern wie Fromental, Knaulgras oder Wolliges Honiggras sowie diverser Fettzeiger wie Wiesen-Sauerampfer, Spitzwegerich oder Rotklee. Typische Talfettwiesen bzw. Fromentalwiesen sind nicht im Anhang der NHV aufgeführt, werden jedoch in der RL der gefährdeten Lebensräume mit Status «VU» aufgeführt und sind daher als ersatzpflichtig einzustufen. |
Eher magere, trockene Fromentalwiese auf Industrieareal mit vielen Blütenarten, teilweise Einfluss der angrenzenden Ruderalflächen (Feldaufnahme Nr. 1.2). Trockene Talfettwiesen bzw. Fromentalwiesen sind nicht im Anhang der NHV aufgeführt, werden jedoch in der RL der gefährdeten Lebensräume mit Status «VU» geführt und sind daher als ersatzpflichtig einzustufen. |
Ruderalfläche auf Industrieareal mit Einfluss der angrenzenden Fettwiesenflächen und des Waldrandes; typische, häufige Arten; Pionierflächen und stärker bewachsene Bereiche zu den Rändern hin (Aufnahme Nr. 6.1). Mesophile Ruderalfluren sind nicht im Anhang der NHV aufgeführt, werden jedoch in der RL der gefährdeten Lebensräume als verletzlich «VU» geführt und sind daher als ersatzpflichtig einzustufen. |
|
Gefährdung gemäss RL |
VU |
VU |
VU |
|
Vorkommen Gefährdete Arten (RL) |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Vorkommen Arten von Nationaler Priorität |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Vorkommen geschützter Arten CH |
Ja (vgl. Fauna Amphibienvorkommen) |
Ja (vgl. Fauna Amphibienvorkommen) |
Nein |
|
Vorkommen geschützter Arten Kt. AG |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Schutzstatus Lebensraum gemäss NHG/NHV |
Ja (gemäss Art. 18 NHG und Art.14 NHV) |
Ja (gemäss Art. 18 NHG und Art.14 NHV) |
Ja (gemäss Art. 18 NHG und Art.14 NHV) |
|
Ersatzpflicht |
Ja |
Ja |
Ja |
|
Lebensraumtyp |
Nährstoffreicher Krautsaum (Aegopodion+Alliarion, InfoFlora Nr. 5.1.5) |
Flaumeichenwald (Quercion pubescenti-petraeae, InfoFlora Nr. 6.3.4) |
Ahorn-Schluchtwald (Lunario-Acerion, InfoFlora Nr. 6.3.1) |
|---|---|---|---|
|
Beschreibung |
Krautsaum mit Einfluss vom angrenzenden Wald (Waldarten) und Fettwiesenarten; nährstoffreich (Feldaufnahme Nr. 7). |
Typischer Wald des Mittellandes mit vielen alten Eichen und einigen Föhren an steiler Böschung, wenig Unterwuchs, mit alten Baumbeständen (v.a. Eichen); Eichen dominant, Föhre häufig (Feldaufnahme Nr. 8.3) |
Wald des Mittellandes mit viel Ahorn und Eschen und weiteren typischen Arten, teilweise mit alten Baumbeständen, z.T. Nadelgehölze (Feldaufnahme Nr. 8.2). Der Lebensraum hat zahlreiche Einflüsse eines Waldmeister-Buchenwaldes und weist deshalb auch nicht das typische Gesamtbild eines Ahorn-Schluchtwaldes aus. Da Buchen im Bestand aber nur vereinzelt vorkommen und Ahorn sowie Eschen die dominierenden Baumarten sind, wurde diese Klassierung vorgenommen. Der Lebensraum ist möglicherweise ein Überbleibsel einer früheren Hanginstabilität (Flurname: Steirütsche). |
|
Gefährdung gemäss RL |
LC |
LC |
LC |
|
Vorkommen Gefährdete Arten (RL) |
Bergminze (Calamintha nepeta) |
Nein |
Nein |
|
Vorkommen Arten von Nationaler Priorität |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Vorkommen geschützter Arten CH |
Ja (vgl. Fauna Reptilienvorkommen) |
Ja (vgl. Fauna Reptilienvorkommen) |
Nein |
|
Vorkommen geschützter Arten Kt. AG |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Schutzstatus Lebensraum gemäss NHG/NHV |
Ja (gemäss Anh. 1 NHV) |
Ja (gemäss Anh. 1 NHV) |
Ja (gemäss Anh. 1 NHV) |
|
Ersatzpflicht |
Ja |
Ja (zusätzlich Rodungsersatz gemäss WaG) |
Ja (zusätzlich Rodungsersatz gemäss WaG) |
Amphibien
Rund um den Projektperimeter sind keine Schutzgebiete des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung ausgewiesen (swisstopo 2024). Gemäss Geoportal des Kantons Aargau liegt das nächstgelegene Laichgewässer für Amphibien im Auenschutzpark Aargau ca. 400 m nördlich des Projektperimeters (vgl. Fig. 5‑11). Nördlich der Zwilag, rund 80 m nördlich des Projektperimeters, befindet sich jedoch ein Weiher, welcher der Versickerung von Dachwasser der bestehenden Zwilag-Gebäude dient (vgl. Kap. 5.7.4 und Fig. 5‑11).
Um die aktuell vorkommenden Amphibienarten und Laichgewässer eruieren zu können, wurden zwischen März und Juni 2023 der Weiher, das Aareufer und deren Umgebung auf die Anwesenheit von Amphiben untersucht. Während sechs Begehungen wurden diese auf Sicht, Rufaktivität und Laichvorkommen nach Amphibien abgesucht. Davon wurden vier Begehungen nach der Dämmerung und bei Nacht durchgeführt. An zwei weiteren Begehungen wurden die Gewässer tagsüber auf vorhandenen Laich und die Umgebung auf potenzielle Lebensräume für Amphibien untersucht. Die Begehungen in der Nacht wurden bei > 6°C (März – April) und bei > 10°C (Mai – Juni), feuchter oder regnerischer Witterung und nur leichtem Wind durchgeführt. Während den Begehungen tagsüber herrschten trockene und sonnige Bedingungen.
Die vorgefundenen Arten sind in nachfolgender Tab. 5‑9 und in der Beilage A3 aufgeführt:
Tab. 5‑9:Auflistung der angetroffenen Amphibienarten mit RL-Status und Populationsgrösse
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Populationsgrösse |
Priorität |
|---|---|---|---|---|
|
Erdkröte |
Bufo bufo |
VU |
Mittel |
4 |
|
Feuersalamander |
Salamandra salamandra |
VU |
Klein |
4 |
|
Fadenmolch |
Lissotriton helveticus |
VU |
Mittel |
4 |
|
Wasserfrosch-Komplex |
Pelophylax sp. |
NT |
Mittel |
- |
|
Bergmolch |
Triturus alpestris |
LC |
Gross |
- |
|
Grasfrosch |
Rana temporaria |
LC |
Klein |
- |
|
Seefrosch |
Pelophylax ridibundus |
NE |
Mittel |
- |
Neben den aufgenommenen adulten Tieren wurde auch Laich im Weiher nördlich der Zwilag gefunden. Das Gewässer dient somit der Fortpflanzung von Amphibien und ist daher als Laichgewässer anzusehen. Das Aareufer und die Wiesen und Wälder in der näheren Umgebung des Weihers sind als Landlebensraum für Amphibien anzusehen. Alle erwähnten Lebensräume für Amphibien sind gemäss Art. 14 NHV geschützt. Bei Eingriffen in diese Biotope sind Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen nötig.
Die Populationsgrösse wurde mittels Vollzugshilfe Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung und der Populationsgrössentabelle Amphibien der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) festgelegt (BUWAL 2002b, Karch 2019). Zwischen den Laichplätzen, den Landlebensräumen und Überwinterungsplätzen in der Umgebung bestehen intensive Beziehungen, die Korridore sind daher als schützenswert zu erachten und müssen erhalten werden.
In der Liste der national prioritären Arten der Schweiz weisen die Erdkröte, der Fadenmolch und der Feuersalamander eine mässige Priorität 4 und eine geringe Verantwortung der Stufe 1 auf. Es handelt sich gemäss dem nationalen Gefährdungsgrad um gefährdete bzw. verletzliche Arten (RL: VU). Der Grasfrosch, Bergmolch, Seefrosch und Wasserfrosch-Komplex sind keine gefährdeten RL-Arten und nicht in der Liste der national prioritären Arten aufgeführt.
Reptilien
Für die Aufnahme der vorhandenen Reptilienarten im und rund um den Projektperimeter wurden über die Monate Mai, Juni und September 2023 insgesamt drei Begehungen frühmorgens sowie bei warmen und sonnigen Bedingungen durchgeführt. Zudem wurden an geeigneten Plätzen Bitumenwellbleche ausgelegt, welche den Reptilien als Unterschlupf oder Sonnenplatz dienen, wodurch diese einfacher erfasst und beobachtet werden können.
Ausserhalb des Sicherungsareals der Zwilag konnten Vorkommen der Mauereidechse und Zauneidechse kartiert werden. Sichtungen gab es hauptsächlich am Waldrand entlang des Nietenbuckwegs und auf Wiesenflächen mit Gehölzen nördlich des Areals. Auf dem Zwilag-Areal selbst konnte nur die Mauereidechse nachgewiesen werden.
Die im Untersuchungsperimeter gefundenen Arten sind in Tab. 5‑10 sowie in der Beilage A4 aufgeführt:
Tab. 5‑10:Auflistung der angetroffenen Reptilienarten inkl. RL-Status und Priorität
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Priorität |
|---|---|---|---|
|
Zauneidechse |
Lacerta agilis |
VU |
4 |
|
Mauereidechse |
Podarcis muralis |
LC |
- |
Der Waldrand sowie der Wald entlang des Nietenbuckwegs und die Flächen nördlich der Zwilag gelten somit als Reptilienlebensräume, wodurch diese gemäss Art. 14 und Art. 20 Abs. 2 Anhang 3 NHV geschützt und bei einer Beanspruchung ersatzpflichtig sind. Bei Eingriffen in diese Biotope sind Schutz-, Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen nötig.
In der Liste der national prioritären Arten der Schweiz weist die Zauneidechse eine mässige Priorität 4 und eine geringe Verantwortung der Stufe 1 auf. Bei der Zauneichechse handelt es sich um eine gefährdete Art welche gemäss RL als verletzlich eingestuft ist. Die Mauereidechse ist in der Liste der national prioritären Arten nicht aufgeführt.
Tagfalter
Anlässlich der Begehungen im Untersuchungsperimeter wurden 9 Tagfalterarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑11 und Beilage A6). Die Abundanz und Diversität an Tagfaltern war eher unterdurchschnittlich, was auf das eher geringe Angebot an Raupenfutter- und Nektarpflanzen zurückzuführen ist.
Am häufigsten festgestellt wurden für Fromentalwiesen typische Arten wie Grosses Ochsenauge und Hauhechelbläuling. Vereinzelt wurden auch Arten festgestellt, die gerne auf wenig befahrenen Flurwegen und an deren Rändern vorkommen (Mauerfuchs, Dunkler Dickkopffalter) sowie Arten des Ackerlandes (Kleiner Kohlweissling, Senfweissling). Der Kurzschwänzige Bläuling wurde als potenziell gefährdete Art der RL in der trockenen Fromentalwiese (Transsekt T1) festgestellt (vgl. Tab. 5‑11 und Beilage A6). Alle weiteren erwähnten und gefundenen Arten sind gemäss RL als nicht gefährdet (LC) eingestuft.
Tab. 5‑11:Auflistung der angetroffenen Tagfalterarten inkl. RL-Status
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Anzahl Nachweise |
|---|---|---|---|
|
Kurzschwänziger Bläuling |
Cupido argiades |
NT |
Wenige (2 – 4) |
|
Grosses Ochsenauge |
Maniola jurtina |
LC |
Häufig (>10) |
|
Hauhechelbläuling |
Polyommatus icarus |
LC |
Wenige (2 – 4) |
|
Mauerfuchs |
Lasiommata megera |
LC |
Wenige (2 – 4) |
|
Dunkler Dickkopffalter |
Erynnis tages |
LC |
1 |
|
Kleiner Kohlweissling |
Pieris rapae |
LC |
Wenige (2 – 4) |
|
Senfweissling |
Leptidea sinapis |
LC |
Wenige (2 – 4) |
|
C-Falter |
Polygonia c-album |
LC |
1 |
|
Himmelblauer Bläuling |
Lysandra bellargus |
LC |
1 |
Mit dem Rotklee wurde im Untersuchungsgebiet eine typische Raupenfutterpflanze des Kurzschwänzigen Bläulings festgestellt, womit eine Fortpflanzung dort möglich ist.
Heuschrecken
Anlässlich der Begehungen wurden 9 Heuschreckenarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑12 und Artenliste in der Beilage A6). Die Artenzahl an Heuschrecken war angesichts der festgestellten Lebensraumtypen durchschnittlich. Die Abundanz war jedoch aufgrund der starken Verbreitung von anspruchslosen Arten wie Gemeiner Grashüpfer, Nachtigall-Grashüpfer und Brauner Grashüpfer stellenweise hoch. Die Westliche Beissschrecke wurde als potenziell gefährdete RL-Art (NT) in der trockenen Fromentalwiese (Transsekt T1, vgl. Beilage A6) festgestellt. Alle weiteren erwähnten und gefundenen Arten sind gemäss RL als nicht gefährdet (LC) eingestuft.
Tab. 5‑12:Auflistung der angetroffenen Heuschreckenarten inkl. RL-Status
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Anzahl Nachweise |
|---|---|---|---|
|
Westliche Beissschrecke |
Platycleis albopunctata |
NT |
1 (stridulierend) |
|
Brauner Grashüpfer |
Chorthippus brunneus |
LC |
häufig (>50) |
|
Gemeiner Grashüpfer |
Pseudochorthippus parallelus |
LC |
häufig (>50) |
|
Gewöhnliche Strauchschrecke |
Pholidoptera griseoaptera |
LC |
3 (Sichtung) |
|
Grünes Heupferd |
Tettigonia viridissima |
LC |
wenige (2 – 3) |
|
Nachtigall-Grashüpfer |
Chorthippus biguttulus |
LC |
häufig (>50) |
|
Rote Keulenschrecke |
Gomphocerippus rufus |
LC |
wenige (10-25) |
|
Waldgrille |
Nemobius sylvestris |
LC |
wenige (10-25) |
|
Wiesengrashüpfer |
Chorthippus dorsatus |
LC |
1 (stridulierend) |
Die Westliche Beissschrecke bevorzugt klimatisch begünstigte, südlich bis südwestliche Trockenwiesen. Sie konnte sich aufgrund der Klimaveränderung in den vergangenen Jahren ausbreiten (Pfeifer 2012, Löffler et al. 2019) und es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend zukünftig fortsetzen wird.
Die eher magere, trockene Fromentalwiese nordwestlich des Zwilag-Areals ist aufgrund des Schnittzeitpunkts sowie der Exposition als Lebensraum für die Westliche Beissschrecke geeignet.
Libellen
Anlässlich der Begehungen wurden 12 Libellenarten festgestellt (vgl. Tab. 5‑13 und Beilage A6). Die Libellenaufnahmen wurden koordiniert mit den Tagfalter- und Heuschreckenaufnahmen durchgeführt. Nordwestlich des Zwilag-Areals erfasste Libellen sind in den Artenlisten des Transekts 1 (T1), die nordöstlich des Zwilag-Areals nachgewiesenen Arten beim Transekt 2 (T2) aufgeführt. Entlang des Waldrands östlich des Zwilag-Areals waren gemäss dem Untersuchungskonzept keine Libellenaufnahmen vorgesehen. Die im Rahmen der Tagfalter- und Heuschreckenaufnahmen gesichteten Libellen wurden jedoch ebenfalls notiert und sind in der Artenliste unter dem Transekt 3 (T3) aufgeführt.
Tab. 5‑13:Auflistung der festgestellten Libellen inkl. RL-Status
|
Artname (Deutsch) |
Artname (Latein) |
RL Status |
Anzahl Nachweise |
|---|---|---|---|
|
Becher-Azurjungfer |
Enallagma cyathigerum |
LC |
5 |
|
Blaue Federlibelle |
Platycnemis pennipes |
LC |
häufig (>20) |
|
Blaugrüne Mosaikjungfer |
Aeshna cyanea |
LC |
2 |
|
Frühe Adonislibelle |
Pyrrhosoma nymphula |
LC |
wenige (5 – 10) |
|
Gebänderte Prachtlibelle |
Calopteryx splendens splendens |
LC |
häufig (>20) |
|
Grosse Königslibelle |
Anax imperator |
LC |
wenige (2 – 3) |
|
Grosse Pechlibelle |
Ischnura elegans |
LC |
häufig (>20) |
|
Grosser Blaupfeil |
Orthetrum cancellatum |
LC |
1 |
|
Hufeisen-Azurjungfer |
Coenagrion puella |
LC |
häufig (>20) |
|
Kleines Granatauge |
Erythromma viridulum |
LC |
häufig (11 – 25) |
|
Vierfleck |
Libellula quadrimaculata |
LC |
wenige (5 – 10) |
Als Fortpflanzungsgewässer dient für die meisten der nachgewiesenen Libellenarten der Versickerungsweiher nordöstlich der Zwilag ausserhalb des Projektperimeters. Mit der Gebänderten Prachtlibelle wurde aber auch eine typische Art von grösseren Fliessgewässern nachgewiesen, welche sich vermutlich im Gewässerraum der angrenzenden Aare fortpflanzt. Libellen sind während ihrer Reifephase sehr mobil und halten sich gerne auch weit abseits der Fortpflanzungsgewässer auf.
Xylobionte Käfer
Für den UVB 1. Stufe wurde eine Ersteinschätzung der Waldlebensräume östlich des Projektperimeters durchgeführt und bzgl. der Eignung als Habitat für xylobionte Käfer beurteilt. Zudem wurde der Totholzanteil untersucht und dokumentiert (Frei 2024 und Beilage A7).
Der Flaumeichenwald (vgl. Kap 5.14 und Beilage A2) im nordöstlichsten Teil des Projektperimeters (Teilfläche 1) mit westlicher Exposition befindet sich im Eingliederungssaum und wurde erst kürzlich durch die Eigentümerin (Forstbetrieb Gemeinde Würenlingen) aufgelichtet. Diese Fläche weist liegendes und stehendes Totholz und besonnte Flächen auf. Die untersuchte Teilfläche 2 befindet sich südlich der Biegung des Nietenbuckwegs (Anlagenperimeter) und ist als Ahorn-Schluchtwald klassifiziert (vgl. Kap 5.14 und Beilage A2). Die Baumbestände in diesem Bereich sind dicht, wodurch wenig Licht hindurchdringt. Entsprechend ist das Totholzangebot gering. Teilfläche 3 befindet sich grösstenteils im Bereich des PSI-Parkplatzes südöstlich der Zwilag (temporäre Installationsfläche). Dort stehen junge Bäume dicht an dicht, wodurch kein Licht in den Bestand gelangt. Zudem ist das Totholzangebot gering.
Bezüglich der Habitateignung und des potenziellen Vorkommens von seltenen und geschützten xylobionten Käferarten können aus den Untersuchungen folgende Schlüsse gezogen werden:
-
Teilfläche1: Grosser Relevanz für xylobionte Käfer aufgrund des lichten Walds und der Exposition (wärmebegünstigte Lage). Vorkommen von seltenen xylobionten und thermophilen Käferarten ist zu erwarten.
-
Teilfläche 2: Die grossen Eichen dienen den xylobionten Käfern als Habitatstrukturen, wodurch auch in diesem Bereich diverse Arten zu erwarten sind.
-
Teilfläche3: Zu dunkel und der Baumbestand zu jung und dicht, um für seltene xylobionte Käfer interessant zu sein. Vorkommen von seltenen xylobionten und thermophilen Käferarten unwahrscheinlich.
Daher werden für den UVB 2. Stufe auf Teilflächen 1 und 2 Aufnahmen von xylobionten Käfern vorgesehen.
Wildbienen
Im und um den Projektperimeter wurde weiter eine Ersteinschätzung der Lebensräume durchgeführt und bzgl. ihrer Eignung als Habitat für Wildbienen untersucht und dokumentiert (Sedivy 2024 und Beilage A8).
Der Flaumeichenwald östlich des Zwilag-Areals und im nordöstlichen Teil des Projektperimeters (Eingliederungssaum und teils Anlagenperimeter) verfügt heute über Totholz, leere Schneckenhäuschen sowie markhaltige Stängel und bietet daher wertvolle Nisthabitate sowie weitere Nahrungsquellen (wie z.B. die Brombeere).
Die ruderalen Grünflächen und Rabatten auf dem Zwilag-Areal sowie im Bereich des Anlagenperimeters und auch der temporären Installationsfläche bieten ein wichtiges Angebot an Blütenpflanzen (z.B. Rispen-Flockenblume, Gewöhnlicher Natternkopf, Gewöhnlicher Hornklee) als Nahrungsquelle für Wildbienen.
Daher werden für den UVB 2. Stufe auf den genannten Flächen Aufnahmen von Wildbienenarten vorgesehen.
Mollusken
Im und um den Projektperimeter wurde zudem eine Ersteinschätzung der Lebensräume durchgeführt und bzgl. ihrer Eignung als Habitat für gefährdete Molluskenarten untersucht und dokumentiert (Müller 2024 und Beilage A9). Die Einschätzung erfolgte aufgrund der Lebensraumkartierungen (vgl. Tab. 5‑8), den Gegebenheiten vor Ort und der Karte der Pflanzengesellschaften im Wald des Kantons Aargau (AGIS 2024). Die Waldflächen östlich der Zwilag und des Projektperimeters (d.h. der Eingliederungssaum sowie der heute bewaldete Teil des Anlagenperimeters) eignen sich aufgrund der angetroffenen Verhältnisse als Lebensraum für gefährdete Molluskenarten (vgl. Beilage A9). In den restlichen Bereichen und ausserhalb von Waldflächen sind keine solchen Arten zu erwarten.
Aufgrund dieser Ergebnisse sind für den UVB 2. Stufe auf den bewaldeten Flächen des Projektperimeters Aufnahmen von gefährdeten Molluskenarten vorgesehen.
Fledermäuse
Aufgrund der vorhandenen Lebensräume Wald, Waldrand und offenes Feld sind sowohl das passende Nahrungsangebot als auch notwendige Ruhe- und Fortpflanzungsstätten vorhanden, weshalb davon ausgegangen wird, dass sich verschiedene Fledermausarten in der Nähe oder innerhalb des Projektperimeters aufhalten.
Für den UVB 2. Stufe werden daher Feldaufnahmen für Fledermäuse vorgesehen.
Inventarisierte Schutzgebiete
Das Vorhaben tangiert eine Fläche von rund 0.5 ha im NkBW (vgl. Tab. 4‑1). Ein kleiner Teil davon (ca. 300 m2) wird dabei vom Anlagenperimeter permanent beansprucht und überbaut, d.h. er muss definitiv gerodet werden (vgl. Kap. 4.1.1). Die restliche Fläche wird durch den Eingliederungssaum und dessen Freihaltestreifen von 20m Breite tangiert (vgl. Kap. 4.1.2). Durch die Umlegung des Nietenbuckwegs werden voraussichtlich weitere Flächen des NkBW permanent beansprucht, wobei der Flächenbedarf und die genaue Lage des verlegten Nietenbuckwegs fürs Baugesuch festgelegt wird (vgl. Kap. 5.14.5.1). Der nördlich des Projektperimeters liegende Auenschutzpark Aargau wird nicht tangiert. Die tangierten Naturschutzflächen sind gemäss NHV zu ersetzen (vgl. Abschnitt Lebensräume). Die entsprechenden Massnahmen im Wald sind in Kap. 5.14.7 zu finden. Die geschützten Gebiete werden während der Bauzeit mit geeigneten Massnahmen geschützt und abgegrenzt.
Die für diese Beanspruchung der Schutzgebiete notwendige raumplanerische Standortbegründung sowie die Herleitung der Interessenabwägung sind in den Kapiteln 2 und 4 des BAR (Nagra 2025a) zu finden.
Wildtierkorridore und Vernetzungslebensräume
Der rund 100 m nördlich des Projektperimeters verlaufende Wildtierkorridor AG-05 und dessen Warteräume werden durch das Vorhaben nicht tangiert (vgl. Fig. 5‑12). Somit wird die Funktion des grossräumigen Wildtierverbundsystems nicht beeinträchtigt.
Aufgrund der Nähe zum Projektperimeter lässt sich auf Stufe RBG noch nicht ausschliessen, dass in der Bauphase im Randbereich des Wildtierkorridors (WTK) Störungen auftreten (allgemeiner Baubetrieb, Lärm, Beleuchtung), welche die Funktionalität des WTK randlich beeinträchtigen. Im Rahmen des Baugesuchs werden die genannten Auswirkungen auf den WTK für die Bauphase beurteilt und Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Funktionalität des WTK für angetroffene Zielarten ausgearbeitet.
Der Waldrand rund um die Zwilag und den Projektperimeter stellt eine Vernetzungsachse und einen Übergangslebensraum für Wildtiere dar (vgl. Kap. 5.14.4). Für die Vorbereitung des Anlagenperimeters und die Herstellung eines Freihaltestreifens wird der Waldrand verschoben.
Wo die Anforderungen von Bau und Betrieb es erlauben, werden Anliegen aus dem Natur- und Heimatschutz berücksichtigt. Geprüft werden kann beispielsweise ob und in welchem Umfang eine ökologische Aufwertung im Eingliederungssaum realisiert werden kann, die Ansprüche spezifischer Arten an die Vernetzung berücksichtigt.
Lebensräume – Beurteilung Eingriffe und Ersatzpflicht
Im Anlagenperimeters und im Eingliederungssaum sind schützenswerte Lebensräume gemäss NHV betroffen (vgl. Kap. 5.15.4 und Tab. 5‑14). Dabei wird durch die neuen Bauten im Anlagenperimeter vor allem der Lebensraum «Ahorn-Schluchtwald» permanent beansprucht.
Die im Rahmen der Feldaufnahmen festgestellten schützenswerten Lebensräume überschneiden sich mit dem oben beschriebenen kantonalen Schutzobjekt (NkBW). Bei den betroffenen Lebensräumen handelt es sich neben dem Ahorn-Schluchtwald sowohl um Krautsäume entlang des Waldrands als auch um trockene/typische Fromentalwiesen und Ruderalstandorte, welche gemäss NHV als schützenswert eingestuft und ersatzpflichtig sind.
Ebenfalls ersatzpflichtig sind die Grünflächen auf dem heutigen Areal der Zwilag im Bereich des Anlagenperimeters sowie der temporären Installationsfläche. Sie werden trotz der Kleinflächigkeit als Fromentalwiese (trockene und typische) sowie als magere Ruderalflur ausgeschieden. Diese drei Lebensräume sind gefährdet, in der RL der Lebensräume als VU aufgeführt und sind daher als schützenswert und ersatzpflichtig einzustufen. Total sind im Projektperimeter rund 1.7 ha schützenswerte, ersatzpflichtige Lebensräume betroffen, d.h. knapp 60 % der Gesamtfläche des Projektperimeters (vgl. Tab. 5‑14).
Tab. 5‑14:Tangierte Flächen von schützenswerten, ersatzpflichtigen Lebensraumtypen im Projektperimeter (vgl. Tab. 5‑8)
Die Spalte «Total» enthält die betroffene Fläche im gesamten Projektperimeter. Der Flächenanteil wurde entsprechend der Gesamtfläche nach Tab. 4‑1 berechnet.
|
Lebensraumtyp (Delarze et al. 2015) |
Anlagenperimeter [ha] |
Installationsfläche [ha] |
Eingliederungssaum [ha] |
Total [ha] |
|---|---|---|---|---|
|
Typische Fromentalwiese |
0.15 |
0.07 |
- |
0.22 |
|
Trockene Fromentalwiese |
0.02 |
- |
- |
0.02 |
|
Mesophile Ruderalflur |
0.10 |
- |
- |
0.10 |
|
Nährstoffreicher Krautsaum |
0.05 |
- |
0.05 |
0.10 |
|
Ahorn-Schluchtwald |
0.81 |
- |
0.23 |
1.04 |
|
Flaumeichenwald |
- |
- |
0.23 |
0.23 |
|
Total [ha] |
1.13 |
0.07 |
0.51 |
1.71 |
|
Flächenanteil der Gesamtfläche [%] |
55 |
19 |
100 |
59 |
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen
Im Rahmen der weiteren Projektplanung sind die tatsächlich tangierten Flächen aufzuführen und die schützenswerten bzw. ersatzpflichtigen Lebensräume nach der Methode Hintermann & Weber (Bühler et al. 2017) im UVB 2. Stufe zu bewerten. Mittels Bilanzierung wird die notwendige Ersatzpflicht festgestellt. Dieser werden die geplanten Ersatzmassnahmen gegenübergestellt. Mit einer artspezifischen Lebensraumbilanzierung wird für den UVB 2. Stufe der Nachweis erbracht, dass die Ersatzmassnahmen einen gleichwertigen Ersatz, d.h. eine ausgeglichene Bilanz für die Eingriffe in die geschützten Lebensräume bieten. Somit stellen die Ersatzlebensräume bzgl. Qualität und Ausprägung möglichst gleichwertige Lebensraumfunktionen sicher.
Wo die Anforderungen von Bau und Betrieb es erlauben, werden Anliegen aus dem Natur- und Heimatschutz berücksichtigt. Geprüft werden kann beispielsweise ob und in welchem Umfang ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum geleistet werden können z.B. durch die Schaffung eines ökologisch aufgewerteten Waldrandes. Die konkrete Gestaltung des Eingliederungssaums wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden definiert und im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) des UVB 2. Stufe festgehalten.
Der für das Baugesuch zu erstellende LBP stellt die Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen auf Plänen dar und legt deren Erstellungs- und Unterhaltspflege fest. Dabei umfasst das Projekt auch sämtliche Ersatz- und Wiederherstellungsflächen, welche ausserhalb des Projektperimeters liegen.
Der definitiv gerodete resp. tatsächlich freigehaltene Wald wird ersetzt. Das Rodungsgesuch mit Bezeichnung der Ersatzaufforstungsflächen wird mit dem Baugesuch eingereicht (vgl. Kap. 5.14).
Ökologische Ausgleichsmassnahmen
Der Kanton Aargau stützt sich für den ökologischen Ausgleich auf § 13 und 14 Naturschutzverordnung. Gemäss dieser kantonalen gesetzlichen Grundlage sind für Planungen, Güterregulierungen, bei der Erteilung von Bewilligungen und bei Unterhaltungsarbeiten von Kanton, Gemeinden und anderen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für Ausgleichsmassnahmen zu sorgen.
Gemäss Art. 78 Abs. 4 BV hat der Bund bei der Erfüllung seiner Aufgaben (z.B. Realisierung von Bundesvorhaben) auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes Rücksicht zu nehmen und bedrohte Arten vor Ausrottung zu schützen. Durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen kann dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten entgegengewirkt werden (Art. 18 Abs.1 NHG). Beim ökologischen Ausgleich handelt es sich um eine solche Massnahme.
Im Rahmen des Baugesuchs werden geeignete ökologische Ausgleichsmassnahmen definiert.
Fauna
Amphibien
Für die Amphibien ist der auf dem Zwilag-Areal liegende Weiher als Fortpflanzungshabitat relevant (vgl. Kap. 5.14.4). Die vorgefundenen Arten konzentrieren sich örtlich daher hauptsächlich auf den Weiher. Dieser liegt ausserhalb des Projektperimeters und wird durch das Vorhaben nicht tangiert. Im Anlagenperimeter sowie im Eingliederungssaum wurden die beiden gefährdeten Arten Erdkröte und Bergmolch festgestellt (vgl. Tab. 5‑9). Diese sind vor allem auch auf den Waldlebensraum angewiesen und bewegen sich während der Fortpflanzungszeit zwischen dem Landlebensraum Wald und dem beschriebenen Weiher (Laichgewässer) hin und her.
Durch die Arbeiten im Eingliederungssaum und im Anlagenperimeter zu Beginn der Bauphase sind Habitatverluste unvermeidbar. Aufgrund des nahen Auengebiets wird davon ausgegangen, dass durch die Arbeiten im Anlagenperimeter und Eingliederungssaum die Landhabitate der beiden gefährdeten Arten zwar tangiert werden, jedoch keine populationsgefährdenden Auswirkungen haben. Die Bewegungsachsen während der Fortpflanzungszeit sind vom Auenschutzgebiet her noch ungehindert zugänglich. Während des Baus wird – unter Berücksichtigung der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben – mittels geeigneter Massnahmen und unter Beizug eines Amphibienspezialisten sichergestellt, dass keine Amphibien während ihrer Wanderung in den Anlagenperimeter gelangen können. Durch Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum werden Habitate ersetzt.
Reptilien
Für die Reptilien sind vor allem die Waldränder im Anlagenperimeter als Lebensraum wichtig, welche zu Beginn der Bauphase durch die Rodung beansprucht werden.
Im Anlagenperimeter sowie im Eingliederungssaum ist vor allem die gefährdete Art Zauneidechse betroffen (vgl. Tab. 5‑10), welche auf Eingriffe in ihr Habitat empfindlich reagiert. Für die Bauphase sind unter Beizug eines Reptilienspezialisten bedarfsgerechte Rückzugslebensräume vorzusehen, sodass eine Restpopulation gesichert werden kann. Durch die vorgesehenen Massnahmen im Eingliederungssaum werden die Verluste des Habitats entlang des Waldes ersetzt.
Tagfalter, Heuschrecken und Libellen
Die Feldaufnahmen zeigen, dass im Projektperimeter zwar Tagfalter und Heuschrecken vorhanden sind, die Vielfalt jedoch eher gering ist (vgl. Tab. 5‑11 und Tab. 5‑12). An den Begehungen wurden keine gefährdeten RL-Arten (Status VU oder höher), keine nach NHV geschützten Tagfalter-/Heuschreckenarten und auch keine prioritären Tagfalter-/Heuschreckenarten festgestellt, womit keine artspezifischen Massnahmen bzw. Ersatz der Lebensräume gemäss NHV erforderlich sind.
Die während den Begehungen angetroffenen Libellenarten sind gemäss RL als nicht gefährdet (LC) eingestuft (vgl. Tab. 5‑13). Es wurden keine gefährdeten RL-Arten (Status VU oder höher), keine nach NHV geschützten Arten sowie auch keine prioritären Libellenarten festgestellt, womit keine artspezifischen Massnahmen bzw. Ersatz der Lebensräume gemäss NHV erforderlich sind.
Bei der Ausgestaltung der ohnehin für andere Themen des Umweltbereichs «Flora, Fauna, Lebensräume» benötigten Ersatzmassnahmen werden die Ansprüche der potenziell gefährdeten Arten Kurzschwänziger Bläuling und Westliche Beissschrecke auf ihren Lebensraum mit geeigneten Massnahmen miteinbezogen.
Xylobionte Käfer
Auf der Teilfläche 1, im Eingliederungssaum, ist aufgrund des vorhandenen Totholzes mit gefährdeten und stark gefährdeten Käferarten zu rechnen (vgl. Kap. 5.14.4), welche gemäss Art. 20 Abs. 2 Anhang 3 NHV geschützt sind. Auf der Teilfläche ist ein Freihaltestreifen mit einem stufigen Waldrand inkl. Verlegung des Nietenbuckwegs geplant, wodurch in die Fläche und den Lebensraum der xylobionten Käfer eingegriffen wird. Die Teilfläche überschneidet sich zudem mit weiteren, oben genannten und ebenso schützenswerten Lebensräumen. Daher ergibt sich eine Ersatzpflicht.
Dasselbe gilt für die Teilfläche 2 (Rodung grosser Flaumeichen im Anlagenperimeter, welche möglicherweise xylobionten Käfern als Lebensraum dienen).
Teilfläche 3 besteht grösstenteils aus dem PSI-Parkplatz und der angrenzenden Waldfläche mit einem zu dichten und jungen Waldbestand, als dass die Fläche für seltene xylobionte Käfer interessant wäre.
Anhand der Resultate der Ersteinschätzung sind in den als potenziell geeigneten Teilflächen 1 und 2 für xylobionte Käfer für UVB 2. Stufe entsprechende Felduntersuchungen vorzusehen und deren Ansprüche für den LBP im UVB 2. Stufe abzustimmen sowie Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen.
Wildbienen
Die im Anlagenperimeter und auf der temporären Installationsfläche vorkommenden Ruderalflächen sowie extensive Grünflächen, welche als wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen dienen, werden in der Bauphase beansprucht. Die Nisthabitate im Eingliederungssaum werden durch das Vorhaben nicht tangiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund des Freihaltestreifens und Auflichtung der Waldflächen im Eingliederungssaum mehr Nisthabitate für Wildbienen geschaffen werden.
Anhand der Resultate der Ersteinschätzung sind in den als potenziell geeigneten Teilflächen für Wildbienen für UVB 2. Stufe entsprechende Felduntersuchungen vorzusehen und deren Ansprüche für den LBP im UVB 2. Stufe abzustimmen sowie Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen. Für UVB 2. Stufe ist zudem zu prüfen, ob Teile der Ruderalflächen direkt im Projekt wiederhergestellt werden können. Die restlichen Flächen sind zu ersetzen.
Mollusken
Die im Eingliederungssaum liegenden Waldflächen werden durch das Vorhaben nur randlich im Sinne eines Freihaltestreifens tangiert. Für seltene Mollusken sind jedoch die Waldflächen östlich des Projektperimeters als Lebensraum wertvoll, welche dem Anlagenperimeter weichen müssen (vgl. Kap. 5.14.4). Aufgrund der naturräumlichen Ausprägung ist davon auszugehen, dass in diesen Waldflächen mehrere gefährdete Arten (RL-Status: VU und EN) anzutreffen sind, welche gemäss Art. 18 NHG und Art. 14 NHV als schützenswert einzustufen sind.
Anhand der Resultate der Ersteinschätzung sind in den als potenziell geeigneten Teilflächen für Mollusken für UVB 2. Stufe entsprechende Felduntersuchungen vorzusehen und deren Ansprüche für den LBP im UVB 2. Stufe abzustimmen sowie Ziel- und Leitarten für die Realisierung von gezielten Ersatzmassnahmen zu bestimmen.
Bei der Errichtung des Freihaltestreifens kann geprüft werden, ob die Anforderungen an die Sicherung und Sicherheit den Schutz ökologisch wertvoller Bäume (mehrere alte Eichen in Teilfläche 1, grosse Eichen in Teilfläche 2) situativ zulassen.
Beleuchtung
Grundsätzlich finden die Bauarbeiten tags statt (vgl. Kap. 4.5.2). In Ausnahmefällen werden Nachtarbeiten ausgeführt. Für Arbeiten in der Nacht und am Abend sind Lichtquellen notwendig, welche vor allem nachtaktive Kleintiere und Insekten stören. Für den UVB 2. Stufe wird ein Beleuchtungskonzept für die Bauphase nach den geltenden Richtlinien (SIA 2013) ausgearbeitet (vgl. auch Kap. 5.16.5.1).
Während der Betriebsphase sind keine direkten Auswirkungen auf den Umweltbereich Flora, Fauna, Lebensräume zu erwarten. Für das Baugesuch (UVB 2. Stufe) wird die Erstellungspflege sowie der Unterhalt von ersetzten Flächen definiert.
Der Anlagenperimeter wird voraussichtlich vollständig umzäunt. Das Sicherungsareal um die BEVA ist voraussichtlich mit einem Doppelzaun gesichert (Nagra 2025d). Amphibienschutzzäune, welche im untersten Bereich der Zaunanlage angebracht werden, verhindern, dass Kleintiere aus den angrenzenden Habitaten in den Anlagenperimeter eindringen und dort aufgrund von Tierfallen (Kellerabgänge, Rinnen u.Ä.) verenden. Die Zwilag verfügt bereits heute über solche wirksamen Zäune und die Aufnahmen der Fauna innerhalb des Areals haben gezeigt, dass dort lediglich Eidechsen zu finden sind (vgl. Kap. 5.15.4).
Die neu zu erstellenden Gebäude werden voraussichtlich vergleichbar materialisiert wie die bestehenden Zwilag-Bauten (vgl. Fig. 4‑5) und sind daher für Vögel bzgl. Vogelkollisionsgefahr ungefährlich.
Aus Sicherheitsgründen wird das Sicherungsareal im Anlagenperimeter voraussichtlich jederzeit ausleuchtbar sein, jedoch nicht ständig beleuchtet. Diese Lichtbelastung im Bereich der Aussenanlagen hat vor allem auf die Insektenpopulation sowie nachtaktive Tiere wie Schalenwild, Vögel und Fledermäuse einen negativen Einfluss. Die Beleuchtung des Anlagenperimeters ist daher im Sinne der Vorsorge gemäss Art. 11 Abs. 2 USG zu begrenzen und die Ausgestaltung und Auswirkungen auf die Umgebung und die nachtaktive Fauna in einem Beleuchtungskonzept für die Betriebsphase darzulegen (vgl. Kap. 5.16.5.2). Insbesondere sind die Auswirkungen auf die Funktionalität des WTK aufzuzeigen. In der weiteren Planung werden die genannten Auswirkungen auf den WTK für die Betriebsphase beurteilt und Schutzmassnahmen zur Erhaltung der Funktionalität des WTKs für angetroffene Zielarten ausgearbeitet.
In der Bauphase sind im Anlagenperimeter und im Eingliederungssaum aufgrund der Rodung sowie des Rückbaus von Grünflächen Eingriffe in gemäss NHV als schützenswert eingestufte Lebensräume und Habitaten von diversen vorhandenen Tierarten vorgesehen. Bei den ersatzpflichtigen Lebensräumen handelt es sich um extensiv genutzte Standorte, welche im Schweizer Mittelland unter Druck stehen und im Rückgang sind. Im Rahmen der UVB 2. Stufe ist anhand der definitiv tangierten Flächen und mittels einer Lebensraumbilanzierung die Ersatzpflicht zu bestimmen.
Für permanente Eingriffe ist eine Interessenabwägung erforderlich, zudem ist die eine raumplanerische Standortbegründung herzuleiten. Der Standort ist das Ergebnis einer umfangreichen Interessenabwägung im Rahmen des Sachplanverfahrens. Weiterführende Informationen dazu sowie eine raumplanerische Standortbegründung wird im BAR dargelegt (Nagra 2025a).
Wo die Anforderungen von Bau und Betrieb es erlauben, werden Anliegen aus dem Natur- und Heimatschutz berücksichtigt. Geprüft werden kann beispielsweise ob und in welchem Umfang ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im Eingliederungssaum geleistet werden können. Damit eine ausgeglichene Gesamtbilanz erreicht wird, werden für das Baugesuch zusätzliche, ggf. projektexterne Ersatzflächen eruiert, welche ebenfalls zum Projekt gehören. Die Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen werden für den UVB 2. Stufe festgelegt, wenn möglich rechtlich gesichert, in einem entsprechenden Projekt ausgearbeitet sowie planerisch dargestellt.
In der Betriebsphase sind neben dem Einfluss der Arealeinzäunung und der nächtlichen Beleuchtung des Sicherungsareals keine negativen Auswirkungen auf den Umweltbereich Flora, Fauna, Lebensräume zu erwarten.
Vorbehältlich der Sicherung von Ersatz- und Wiederherstellungsflächen, unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweisen sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Flora, Fauna, Lebensräume» eingehalten werden.
|
PH-HU2 FFL 01 |
Ergänzende Feldaufnahmen Fauna: Wildbienen, xylobionte Käfer, Mollusken und Fledermäuse Innerhalb der für die Arten geeigneten Teilflächen werden Feldaufnahmen von Wildbienen, xylobionten Käfern, Mollusken und Fledermäusen durchgeführt. |
|
PH-HU2 FFL 02 |
Bewertung von Eingriffen und Bemessung von Ersatzmassnahmen Bewertung der Eingriffe und Angaben zur Ersatzpflicht anhand der BAFU-Bewertungsmethode von Eingriffen in schützenswerte Lebensräume nach (Bühler et al. 2017). |
|
PH-HU2 FFL 03 |
Definition der Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen, Sichern von Ersatzflächen Die notwendigen Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen werden beschrieben (inkl. Bestimmung der Ziel- und Leitarten) und in einem Plan dargestellt. |
|
PH-HU2 FFL 04 |
Definition von ökologischen Ausgleichsmassnahmen Im Rahmen des Baugesuchs werden geeignete ökologische Ausgleichsmassnahmen definiert. |
|
PH-HU2 FFL 05 |
Erstellung der Lebensraumbilanzierung Ersatzflächen ausserhalb des Projektperimeters werden festgelegt und rechtlich gesichert. Es wird eine nach BAFU-Bewertungsmethode für Eingriffe in schützenswerte Lebensräume (Bühler et al. 2017) ausgeglichene Bilanz erreicht. |
|
PH-HU2 FFL 06 |
Nachweis Materialisierung Gebäude Allfällig durchsichtig gestaltete Wände werden gemäss geltenden Empfehlungen von anerkannten Fachpersonen vogelfreundlich gestaltet. |
|
PH-HU2 FFL 07 |
Nachweis Massnahmen zur Verhinderung von Wildtierfallen (Bauphase) Während des Baus wird – unter Berücksichtigung der sicherheits- und sicherungstechnischen Vorgaben – mittels geeigneten Massnahmen sichergestellt, dass Amphibien und Kleintiere nicht in den Anlagenperimeter gelangen können (Verhinderung Wildtierfallen). Die Umsetzung der Massnahmen sind durch einen Amphibien- und Reptilienspezialisten zu begleiten. |
|
PH-HU2 FFL 08 |
Auswirkungen von Bau- und Betrieb auf den WTK, Schutzmassnahmen Die Auswirkungen auf den überregionalen WTK AG-05 «Böttstein-Villigen» während des Baus und Betriebs der BEVA bzgl. Licht und Lärm sind zu beurteilen. Es sind Schutzmassnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität des WTK auszuarbeiten. |
|
PH-HU2 FFL 09 |
Schutz gefährdeter Lebensräume während der Bauphase Die an den Projektperimeter angrenzenden nach NHG schützenswerten Flächen werden mit geeigneten Massnahmen geschützt und abgegrenzt. |
|
PH-HU2 FFL 10 |
Rückzugslebensräume während der Bauphase In der Bauphase werden Rückzugslebensräume für die Zauneidechse vorgesehen. Die Umsetzung der Massnahmen sind durch einen Reptilienspezialisten zu begleiten. |
|
PH-HU2 FFL 11 |
Erstellung Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) für die Betriebsphase Die vorgesehenen Ersatzmassnahmen inkl. deren langfristiger Unterhalt werden im LBP festgehalten. |
|
PH-HU2 FFL 12 |
Bedarfsabklärung Pflegeverträge, Vereinbarungen mit Dritten für die Betriebsphase Nach Bedarf wird der Unterhalt der Ersatzflächen (vgl. PH-HU2 FFL 03) während der Betriebsphase mittels Pflegeverträgen und/oder Vereinbarungen mit Dritten geregelt. |
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966, Stand 1. Januar 2022, SR 451 (NHG)
Verordnung über den Natur- und Heimatschutz vom 16. Januar 1991, Stand 1. Juni 2017, SR 451.1 (NHV)
Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege vom 04. Oktober 1985, Stand am 1. Januar 2023, SR 704 (FWG)
Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Denkmäler vom 10. August 1977, Stand 1. Juni 2017, SR 451.11 (VBLN)
Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz vom 9. September 1981, Stand 1. Mai 2024, SR 451.12 (VISOS)
Verordnung über Fuss- und Wanderwege vom 26. November 1986, Stand am 1. Juli 2008, SR 704.1 (FWV)
Landschaftsgerecht planen und bauen, SIA Dokumentation D 0167 (Kleiner & Schmitt 2001)
Landschaftskonzept Schweiz: Landschaft und Natur in den Politikbereichen des Bundes, Umwelt-Info Nr. 2011 (BAFU 2020b)
Arbeitshilfe Landschaftsästhetik. Wege für das Planen und Projektieren (Gremminger et al. 2001)
Empfehlung zur Vermeidung von Lichtemissionen, Umwelt-Vollzug Nr. 2117 (BAFU 2021b)
Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum (Schweizer Norm SN 586 491; SIA 2013)
GIS des Kantons Aargau: Wanderwege (AGIS 2024)
IS des Bundes: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (swisstopo 2024)
Schweiz Mobil: Wanderweg-, Velo- und Skaterouten (swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN; swisstopo 2024)
GIS des Bundes: Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS; swisstopo 2024)
|
PH-HU1 Lan 01 |
Gestaltungskonzept Die Bauwerke sowie die dazugehörige neue Infrastruktur (Verkehrswege) werden bezüglich ihrer räumlichen Einbindung in Landschaft und Ortsbild beschrieben und bewertet. |
|
PH HU1 Lan 02 |
Aufzeigen der Auswirkung auf die Erholungsnutzung Es wird aufgezeigt, wie das Vorhaben die Erholungsnutzung langfristig beeinflusst und allfällige Massnahmen werden definiert. |
|
PH HU1 Lan 03 |
Aufzeigen Lichtemissionen Es wird aufgezeigt, mit welchen Lichtemissionen in der Bau-, Betriebs- und Rückbauphase zu rechnen ist. |
Der Rückbau der BEVA wird im Rahmen des Stilllegungsverfahrens behandelt (vgl. Kap. 3.5.2).
Aufgrund des aktuellen Projektstands können noch keine abschliessenden Erkenntnisse für den Umweltbereich «Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtemissionen)» gewonnen werden. Sämtliche Punkte aus dem Pflichtenheft für den UVB 1. Stufe werden daher in das Pflichtenheft 2. Stufe übertragen.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme vom 6. Juli 2023 folgende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B2.1):
Der Kanton Aargau, Abteilung Umwelt, hat in seiner Stellungnahme vom 27. Januar 2023 fol gende Anträge zum Pflichtenheft formuliert (vgl. Beilage B1):
-
ist das Beleuchtungsprojekt auszuarbeiten und die Leuchten sind zu projektieren (Standorte, Typ, Höhe, Lichtfarbe, Beleuchtungszeiten).
-
sind aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe zum Wald Leuchten mit amberfarbenem Licht von maximal 2'200 Kelvin zu projektieren.
-
sind die Leuchten wo nötig am Rücken mit einem sogenannten Backlightstopp zu projektieren, um Störlicht in den direkt angrenzenden Wald so gut wie möglich zu reduzieren.
-
ist zu prüfen, ob ein bewegungsabhängiger/dynamischer und/ oder ein zeitgesteuerter Betrieb realisiert werden kann.
Das BAFU hat in seiner Stellungnahme zur Vollständigkeit vom 27. Februar 2025 (vgl. Beilage B2.3) folgende ergänzende Anträge zum Pflichtenheft formuliert:
Berücksichtigung der Anträge
Auf die Anträge des BAFU und des Kantons Aargau wird folgenermassen eingegangen:
-
Antrag 3 BAFU: Siehe Kommentare zu den kantonalen Anträgen.
-
Anträge 12 und 13 BAFU sowie Anträge AG Lichtemissionen 1 und 2: Im UVB 1. Stufe werden nur generelle Angabe zu Lichtemissionen gemacht. Im UVB 2. Stufe wird ein Be leuchtungskonzept ausgearbeitet und die Massnahmen zur Reduzierung der Lichtemissionen festgelegt sowie die Auswirkungen beurteilt. Sofern später Solarzellen auf der BEVA vorge sehen werden, wird die Blendwirkung beurteilt. Die Anträge werden im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 1 AG Landschaft: Das Gestaltungskonzept wird im UVB 1. Stufe nur grob abge handelt. Im UVB 2. Stufe wird das Detailkonzept erarbeitet. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 2 AG Landschaft: Im UVB 1. Stufe wird die Einordnung der Bauten und Anlagen grob beschrieben. Im UVB 2. Stufe wird das Detailkonzept inkl. Massnahmen zur Einord nung der Bauten und Anlagen erarbeitet. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 3 AG Landschaft: Erste Aussagen zur Einsehbarkeit sind im UVB 1. Stufe enthalten. Eine konkrete Analyse erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe. Der Antrag wird im Pflichten heft für den UVB 2. Stufe berücksichtigt.
-
Antrag 4 AG Landschaft: Im UVB 1. Stufe erfolgt eine erste Beurteilung des Projekts inkl. Massnahmen hinsichtlich des Landschaftsschutzes. Eine konkrete Beurteilung erfolgt im Rahmen des UVB 2. Stufe. Der Antrag wird im Pflichtenheft für den UVB 2. Stufe berück sichtigt.
-
Antrag 5 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Der Antrag wird entsprechend umgesetzt.
-
Antrag 11 BAFU (Vollständigkeitsprüfung): Die Nagra hatte weder in der Voruntersuchung noch Vorhabensbeschrieb im UVB 1. Stufe (vgl. Kap. 4) Solaranlagen erwähnt und es sind keine solchen Anlagen geplant. Es handelt sich dabei um ein Missverständnis, weswegen auf den Antrag nicht eingetreten wird.
In der Landschaftstypologie der Schweiz (ARE 2011) wird die Landschaft im und um den Projektperimeter (Zwilag, PSI und Nachbarflächen) mit Aarelauf als Typ «Flusslandschaft» beschrieben. Der östlich anschliessende «Unterwald» und angrenzende Flächen werden als «Ackerbaugeprägte Hügellandschaft des Mittellandes» und die westlich der Aare aufsteigende Hügellandschaft als «Hügellandschaft des Tafeljura» bezeichnet. Die Landschaft ist geprägt durch die bewaldeten Hügel des Tafeljuras und der Flusslandschaft der Aareebene sowie – sofern unbewaldet – die offenen Landwirtschaftsflächen und einzelne Siedlungsbereiche. Die Aare fliesst als markantes Landschaftselement durch die Ebene. Lokal ist das Gebiet durch die bestehenden Areale des PSI und der Zwilag bereits siedlungsgeprägt, liegt der Anlagenperimeter selbst in engem Kontext zur bestehenden Industrieansiedlung mit PSI und Zwilag. Nördlich, knapp 1 km flussabwärts, befindet sich als ebenfalls siedlungsgeprägter Raum die Aareinsel mit dem KKW Beznau (vgl. Fig. 3‑1). Südöstlich befindet sich im Unterwald die Grossforschungsanlage des SwissFEL, welche weitgehend als eingegrünte Lichtung im Wald in Erscheinung tritt (vgl. Fig. 3‑2). Bezüglich Verkehrsinfrastruktur ist der Raum durch die Kantonsstrasse K442 sowie die den Wald und die Aare querende Verbindungsstrasse (Forschungsstrasse) zwischen Kantonsstrasse K113 – PSI/Zwilag – Kantonsstrasse K442 vorbelastet (vgl. Kap. 4.7.1 und Fig. 4‑6). Zudem führt eine Freileitung entlang des westlichen Aareufers von Villigen nach Beznau (vgl. Fig. 5‑2). Südlich des Projektperimeters quert eine markant sichtbare Materialtransportbahn vom westlichen Hügel über die Aare nach Untersiggenthal-Station. Grössere Verkehrsinfrastrukturen, wie Nationalstrassen, sind keine vorhanden.
Die Zwilag-Gebäude sind in gewissen Arealteilen rund um die Uhr beleuchtet. Im Bereich seitlich zum Anlagenperimeter befindet sich aktuell ein Container-Anlieferungsbereich, der ebenfalls rund um die Uhr beleuchtet ist (Nachtanlieferungen).
Die westlich der Aare anschliessende ansteigende Hügellandschaft ist als Objekt Nr. 1108 «Aargauer Tafeljura» im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) ausgewiesen. Die Schutzziele dieses Objekts umfassen u.a. die Erhaltung der charakteristischen Wald-Offenlandverteilung, der naturnahen Lebensräume, der wenig gestörten, grossflächigen und zusammenhängenden Wälder, der Gewässer und ihre Lebensräume sowie der Besiedlungsform und insbesondere die typischen Haufendörfer mit ihrem Umfeld.
Zudem ist diese angrenzende Landschaft Teil des «Juraparks Aargau» sowie im Richtplan als «Landschaft kantonaler Bedeutung» (LkB, Richtplan L 2.3; vgl. Fig. 5‑13) gekennzeichnet.
Der Jurapark Aargau nennt als seine strategischen Ziele 2022 – 2031 die «Erhaltung und Aufwertung der Qualität und Vielfalt von einheimischen Tier- und Pflanzenarten und ihren Lebensräumen sowie die Wahrung und Stärkung der typischen Landschafts- und Kulturwerte sowie Ortsbilder» (Verein Jurapark Aargau 2021). Die LkB sind gemäss kantonalem Richtplan «langfristig zu erhalten und dienen dem Erhalt und der Weiterentwicklung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, der naturnahen und ruhigen Erholung». Neue Nutzungen, z. B. durch Bauten und Anlagen, die den Schutzzielen widersprechen, sind nur zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegen und ihre Nachhaltigkeit nachgewiesen ist (Kanton Aargau 2011).
In Richtung Osten steigt die Landschaft mit dem Unterwald leicht in Richtung Würenlingen an. Von Westen her gesehen liegt der Projektperimeter tiefer als die ansteigende Landschaft. Allgemein stellen die geplanten Bauten und Anlagen lediglich eine Erweiterung der bestehenden Arbeitszone (inkl. PSI West) dar, welche durch die Ufervegetation der Aare bereits heute teilweise abgedeckt wird.
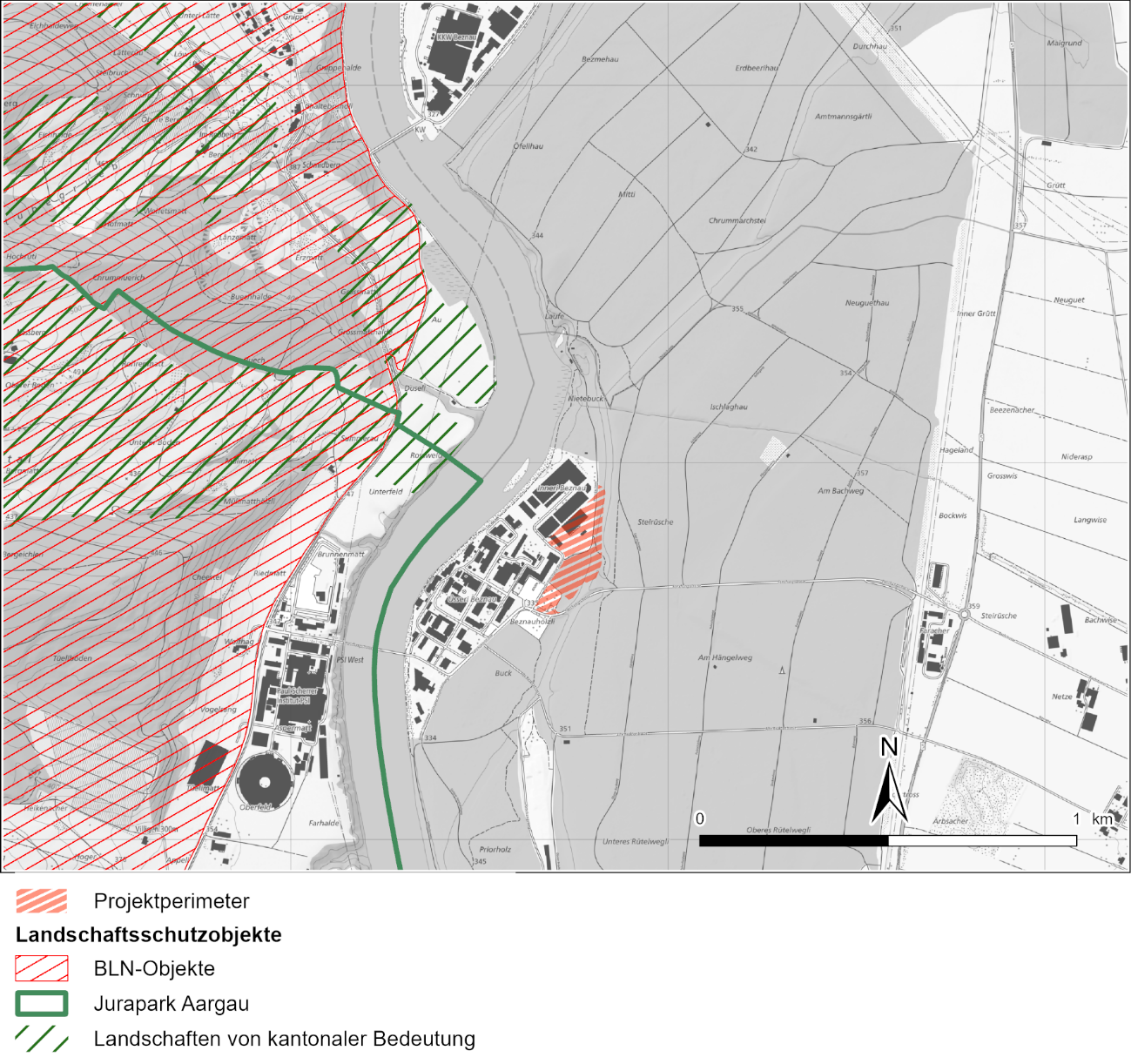
Fig. 5‑13:Ausschnitt aus dem BLN und dem LkB (AGIS 2024)
Der «Unterwald» wird als Waldbereich mit zahlreichen Wegen zur Erholung genutzt. Am östlichen Aareufer zwischen PSI-/Zwilag-Gelände und Aare verläuft ein unbefestigter Wanderweg. Entlang der Kantonsstrasse Villigen – Kleindöttingen verläuft die nationale Veloroute Nr. 8 Aare – Koblenz (swisstopo 2024). Zusätzlich verläuft ein historischer Verkehrsweg in der Nähe des Projektperimeters (vgl. Kap. 5.17.4).
Es sind keine Ortsbilder nationaler Bedeutung im Projektperimeter resp. der Umgebung betroffen (vgl. Fig. 5‑16).

Fig. 5‑14:Wanderwege um den Projektperimeter (AGIS 2024)
Der an das bebaute Gebiet anschliessende Anlagenperimeter wird mit einem Arealzaun abgeschlossen und grenzt im Osten an den Eingliederungssaum. Durch den Zaun wird eine klare Trennung von Baubereich und Nichtbaubereich / Wald sichergestellt. Der Eingliederungssaum wird zudem die neue Fusswegführung (Nietenbuckweg) aufnehmen, wobei die Wegführung für das Baugesuch noch zu definieren ist (vgl. Kap. 5.14.5.1).
Während der ca. 5 Jahre andauernden Bauphase (vgl. Kap. 4.3) wird das Landschaftsbild v.a. durch die Rodungsarbeiten, die Aushubarbeiten, die temporäre Installationsfläche, die Bauinstallationen / Turmkräne, die Baustellenzufahrten, die Baustellenbeleuchtung (vor allem tags, ggf. auch nachts) sowie die Massnahmen und Anpassungen im Eingliederungssaum beeinflusst. Es handelt sich um temporäre Störungen, welche vor allem die Erholungslandschaft (Lärm- und Lichtemissionen, Baustellenverkehr, Fusswegverlegung) betreffen. Nach Abschluss der Bauphase werden die temporären Installationen rückgebaut. Infolge der Erweiterung des bebauten Areals gegen Osten und der Waldrodung wird der Nietenbuckweg in einem Teilabschnitt gegen den neuen Waldrand hin verschoben. Das heutige Wegenetz wird so im angrenzenden Wald- und Erholungsbereich erhalten. Während der Umlegung des Nietenbuckwegs stehen mehrere Ausweichmöglichkeiten über den Steinrüscheweg oder den Wanderweg entlang der Aare zur Verfügung (vgl. Fig. 5‑14).
Die Beleuchtungssituation verändert sich im Vergleich zu heute nicht massgebend, weil der gesicherte Teil des Zwilag-Areals (innerhalb Arealzaun), die Zufahrtsstrassen und Einfahrten sowie Teile der Büro- und Parkplatzflächen bereits heute auch nachts beleuchtet sind. Aufgrund allfällig nötiger Nachtarbeiten ist der Bedarf ausgeleuchteter Flächen während der Bauphasen leicht grösser als heute. Für den UVB 2. Stufe wird ein Beleuchtungskonzept für die Bauphase ausgearbeitet, in dem der Perimeter der Auswirkungen durch die Lichtimmissionen (v.a. Beleuchtung der Baustelle) auf die Umgebung und die nachtaktive Fauna nachvollziehbar dargelegt wird. Die Auswirkungen werden im Rahmen der geltenden Richtlinien (SIA 2013) beurteilt und entsprechend umgesetzt.
Die Schutzziele des BLN-Objektes 1108, die Ziele des Juraparks Aargau sowie die Anliegen als LkB werden in der Bauphase – abgesehen von der oben beschriebenen teilweisen Einsehbarkeit der Bauinstallationen von gewissen exponierten Aussichtspunkten aus – nicht beeinträchtigt, da der Projektperimeter das bestehende bebaute Gebiet (Arbeitszone II) nur unwesentlich vergrössert und aus den genannten Landschaftsschutzgebieten kaum einsehbar ist (vgl. Fig. 5‑13).
Während der Betriebsphase sind die neuen Gebäude in das Ensemble der bestehenden Arbeitszone mit den Zwilag- und PSI-Bauten integriert. Die Neubauten bilden zusammen mit den bestehenden Gebäuden der Zwilag eine städtebauliche und architektonische Einheit. Sie übernehmen den kubischen Ausdruck und die architektonische Gestaltung der Bestandsbauten und gliedern sich so in das Bild ein (vgl. Fig. 5‑15).
Aus Sicherheitsgründen muss das Sicherungsareal (Teilbereich des Anlagenperimeters, vgl. Kap. 4.1.1) voraussichtlich jederzeit ausleuchtbar sein, jedoch nicht ständig beleuchtet. Die Beleuchtungsanlage wird in erster Linie nach den Vorgaben der sicherungstechnischen Anforderungen einer Kernanlage sowie der Arbeitssicherheit ausgelegt (Nagra 2025d) und wird zudem auf die Anordnung der Gebäude, der Zu-/Aus- und Eingänge sowie die Nutzung der Aussenflächen abgestimmt. Beim Erstellen eines Beleuchtungskonzepts werden – insbesondere wegen der Waldnähe – Grundsätze zur Reduktion und Vermeidung von unnötigen Lichtemissionen (z. B. gemäss BAFU 2021b) berücksichtigt, soweit dies betrieblich und sicherheitstechnisch möglich ist. Für den UVB 2. Stufe wird daher auch für die Betriebsphase nach den oben genannten Prinzipien ein Beleuchtungskonzept sowie die dazugehörigen Abschirmungsmassnahmen ausgearbeitet und die Auswirkungen auf die Umwelt konkret beurteilt.
Durch die Lage zwischen der Aare und dem Wald wird der Standort durch die Ufervegetation, Wald und auch bestehende Bauten in weiten Teilen verdeckt (vgl. Fig. 5‑15). Von erhöhten Aussichtsbereichen her (Gugelen Villigen, Nassberg, Rebberg Böttstein und Böttelberg) werden die Bauten und Anlagen teilweise sichtbar, jedoch als Erweiterung der bestehenden Arbeitszone, kaum auffällig sein (vgl. Fig. 5‑15). Der Anlagenperimeter ist – abgesehen vom direkten Nahbereich beim Nietenbuckweg und vom bestehenden Parkplatz her – von aussen (z.B. Kantonsstrasse Villigen – Beznau) nicht einsehbar.


Fig. 5‑15:Das Zwilag-Areal ohne BEVA im Ausgangszustand heute (2024; oben) sowie mit eingebetteter BEVA nach Abschluss der Bauphase (exemplarische Umsetzung der BEVA zum Stand ca. 2050, Umgebung Stand 2023; unten) gesehen von der gegenüberliegenden Talseite in Villigen (Fuss des Gebietes Gugelen; Blickrichtung Nordnordost)
Die Auswirkungen auf die Landschaft beziehen sich während der Betriebsphase rein auf die veränderte Bebauungsstruktur und die leicht geänderte Fusswegführung im Eingliederungssaum. Die Lage und Gestaltung der neuen Bauten und Anlagen sind für den UVB 2. Stufe bzgl. ihrer räumlichen und gestalterischen Einbindung in Landschaft und Ortsbild zu beschreiben, zu beurteilen (Visualisierungen) und zu bewerten.
Die Erholungsnutzung (Nietenbuckweg, Wanderweg entlang der Aare, Wegenetz im «Unterwald») wird aufgrund des Wegersatzes des Nietenbuckwegs in der Betriebsphase nicht beeinträchtigt.
Die Ziele des BLN-Objekts Nr. 1108 und des Juraparks Aargau sowie die Anliegen des LkB werden damit in der Betriebsphase nicht tangiert (kein funktionaler Zusammenhang zwischen Schutzgebieten und Projektperimeter, nur geringfügige flächenhafte Vergrösserung der bestehenden Arbeitszone, keine massgebliche Einsehbarkeit aus den Schutzgebieten heraus).
Das Gebiet liegt am Rand einer bereits heute vorbelasteten Bauzone. Innerhalb der Bauzone wären die Bauten grundsätzlich auch nach der Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Würenlingen bewilligungsfähig (Gemeinde Würenlingen 2016). Während der Bauphase sind vor allem temporäre Einwirkungen auf die Landschaft und das Ortsbild durch Bauinstallationen, Anpassungsarbeiten am Gelände und durch die Installationsfläche zu erwarten.
Aufgrund der rückwärtigen Lage und der prägenden Zwilag- und PSI-Gebäude wird das Landschaftsbild während der Betriebsphase kaum zusätzlich belastet. Lediglich die Verlegung des Nietenbuckwegs sowie die zu erwartenden Sicherungsanlagen um die BEVA werden die bisherige Erholungsnutzung leicht verändern. Für den UVB 2. Stufe wird ein Gestaltungs- und Beleuchtungskonzept erstellt (inkl. Eingliederungssaum). Für den Umweltbereich Landschaft und Ortsbild sind die Auswirkungen der Betriebsphase als gering einzuschätzen.
Unter Berücksichtigung der obenstehenden Vorgehensweise sowie unter der Annahme, dass die für UVB 2. Stufe definierten Massnahmen umgesetzt werden, können die Anforderungen aus Sicht «Landschaft und Ortsbild» eingehalten werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Lan 01 |
Gestaltungskonzept Die Landschaftseingliederung und die Massnahmen zum Schutz des Landschafts- und Ortsbilds (inkl. Beleuchtung) sind zu detaillieren (inkl. Visualisierungen). Neue Bauten und Anlagen sowie die zugehörige Infrastruktur werden bezüglich ihrer räumlichen und gestalterischen Einbindung in Landschaft und Ortsbild beschrieben, beurteilt und bewertet. |
|
PH HU2 Lan 02 |
Aufzeigen der Aufrechterhaltung der Fusswegverbindungen während der Bauphase Es wird aufgezeigt, wie Fusswegverbindungen während der Bauphase sichergestellt werden. |
|
PH HU2 Lan 03 |
Beleuchtungskonzept und Beurteilung Lichtimmissionen (Bau- und Betriebsphase) Für die Bau- und Betriebsphase wird ein Beleuchtungskonzept mit spezifischen Angaben für alle neuen Aussenbeleuchtungsanlagen erstellt. Im Konzept ist der Perimeter der Auswirkungen der Lichtimmissionen auf die Umgebung und die nachtaktive Fauna nachvollziehbar darzulegen. Bei Bedarf werden geeignete Schutzmassnahmen ausgearbeitet. |
Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz vom 14. April 2010, Stand am 1. Juni 2017, SR 451.13 (VIVS)
Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften und Denkmäler vom 10. August 1977, Stand am 1. Juni 2017, SR 451.11 (VBLN)
Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz vom 9. September 1981, Stand 1. Mai 2024 2022, SR 451.12 (VISOS)
Kulturgesetz des Kanton Aargaus vom 31. März 2009, Stand 01.08.2023, SAR 495.200 (KG)
Bundes GIS: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN; swisstopo 2024)
Bundes GIS: Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler Bedeutung (KGS; swisstopo 2024)
Verordnung zum Kulturgesetz vom 4. November 2009, Stand 1. September 2021 SAR 495.211 (VKG)
GIS des Kantons Aargau: Denkmalpflege, Archäologische Fundstellen (AGIS 2024)
Kantonale und kommunale Inventare der Kulturobjekte (AGIS 2024)
|
PH-HU1 Kul 01 |
Ermittlung tangierter historischer Verkehrswege (IVS) Es wird abgeklärt, ob und in welcher Form historische Verkehrswege mit Substanz vom Vorhaben tangiert werden und welche Massnahmen getroffen werden müssen. |
In den Stellungnahmen sind keine zusätzlichen Anträge zum Pflichtenheft formuliert.
Westlich des PSI West verläuft die historische «Schmidbergstrasse» (IVS-Objekt AG 234, vgl. Fig. 5‑16 und Kanton Aargau 1996), welche im Bundesinventar der historischen Verkehrswege (IVS) eingetragen ist (regionale Bedeutung). Heute verläuft dort die Hauptstrasse (Lokalverbindungsstrassen, Nr. K442, vgl. Fig. 4‑6). Entsprechend besitzt der historische Verkehrsweg in diesem Bereich keine IVS-relevante Substanz mehr.
Östlich des Projektperimeters endet der Hängelweg (IVS-Objekt AG 245; vgl. Fig. 5‑16 und Kanton Aargau 1994). Dieser führt von Würenlingen nach Beznau, ist von lokaler Bedeutung und verfügt abschnittsweise noch über historische Substanz. Grosse Teile des Weges sind heute nicht mehr erkennbar (ohne Substanz), da diese überbaut oder zugewachsen sind. Östlich der Zwilag, im Bereich des Projektperimeters ist ein letztes, etwa 95 m langes Stück mit Substanz vorhanden. Der hier 4 – 5 m breite versumpfte Grasweg wird jedoch nicht mehr begangen und wächst stetig weiter zu. Das letzte Wegstück nördlich der modernen Zufahrt zum PSI wurde gemäss IVS-Objektblatt AG 245 schon viel früher aufgegeben und durch einen unmittelbar daneben verlaufenden Fussweg (Nietenbuckweg) ersetzt (Kanton Aargau 1994).
Die inventarisierten Wegabschnitte sind von lokaler (Hängelweg) oder regionaler (Schmidbergstrasse) Bedeutung. Sie sind im IVS-Inventar beschrieben, unterstehen jedoch als aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung nicht dem Art. 5 NHG.
Es sind keine archäologischen Fundstellen oder Denkmalschutzobjekte im oder in unmittelbarer Nähe zum Projektperimeter vorhanden (vgl. Fig. 5‑16).
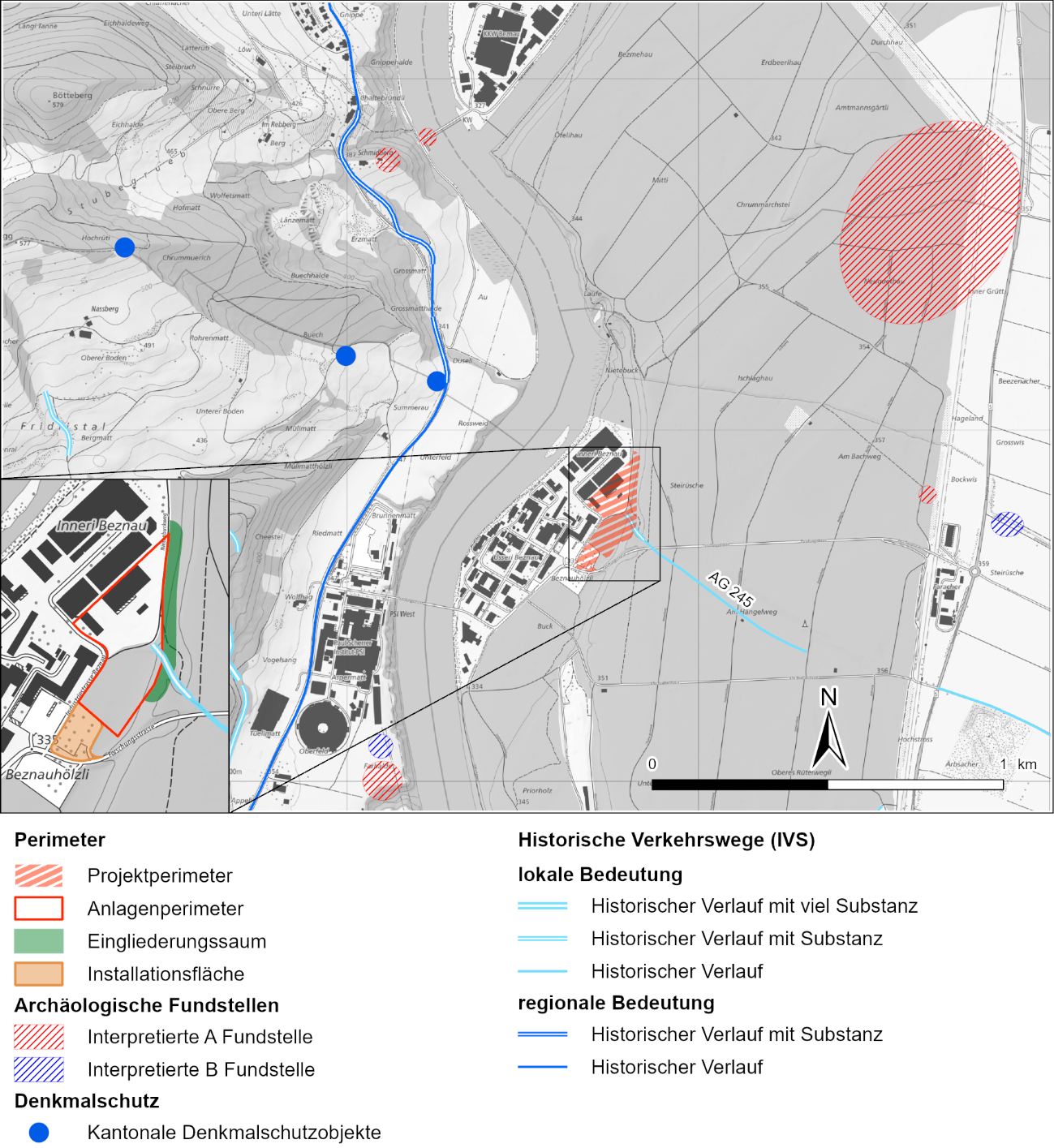
Fig. 5‑16:Ausschnitt Archäologische Fundstellen, kantonale Denkmalschutzobjekte und IVS mit dem Hängelweg AG245 (AGIS 2024)
Durch die baulichen Veränderungen im Anlagenperimeter und Eingliederungssaum werden Teile des westlichen Teilstücks des historischen Verkehrswegs mit Substanz (Hängelweg, IVS Nr. AG 245, Kanton Aargau 1994) von lokaler Bedeutung beeinträchtigt oder aufgehoben. Dies betrifft im Anlagenperimeter ca. 21 m des Wegs. Das ca. 32 m lange Teilstück im Eingliederungssaum wird durch bauliche Eingriffe voraussichtlich nicht verändert. Dies ist für den UVB 2. Stufe zu bestätigen. Der Niedergang des Teilstücks im Anlagenperimeter wurde von der kantonalen IVS-Fachstelle gutgeheissen8 und kann ohne weitere Massnahmen im geplanten Umfang durchgeführt werden.
Voraussichtlich werden keine archäologischen Fundstellen tangiert. Aufgrund der Lage des Projektperimeters auf einer Aareterrasse, welche aus archäologischer Sicht in prähistorischer Zeit als bevorzugte Siedlungslage zu bezeichnen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei den Bodeneingriffen während der Bauphase archäologische Funde gibt. Im Falle von allfälligen archäologischen Funden sind die archäologischen Hinterlassenschaften unverändert zu belassen (§ 38 Abs. 2 KG) und die Kantonsarchäologie herbeizuziehen, sodass sie fachgerecht untersucht und allenfalls geborgen werden können.
Auskunft Kantonale Fachstelle IVS per E-Mail am 30.01.2024 ↩
In der Betriebsphase sind keine baulichen Eingriffe in den Untergrund vorgesehen, weshalb keine archäologischen Fundstellen tangiert werden.
Der Umweltbereich «Kulturdenkmäler und archäologische Stätten» ist in dieser Phase nicht relevant.
Das Vorhaben beeinträchtigt während der Bau- und Betriebsphase keine bekannten archäologischen Fundstellen oder Denkmalschutzobjekte. Vor dem Bau sind daher keine vorsorglichen Sondierungen vorzusehen. Während der Bauphase sind bei allfälligen archäologischen Funden die archäologischen Hinterlassenschaften unverändert zu belassen (§ 38 Abs. 2 KG) und die Kantonsarchäologie herbeizuziehen, sodass sie fachgerecht untersucht und allenfalls geborgen werden können.
Der Ostteil des Projektperimeters tangiert ein Teilstück des historischen Hängelwegs, welcher Teil des lokalen IVS-Verkehrsnetzes ist, und Substanz aufweist.
Der Niedergang des IVS im Anlagenperimeter wurde von der kantonalen IVS-Fachstelle gutgeheissen und kann im geplanten Umfang ohne weitere Massnahmen durchgeführt werden. Die Auswirkungen des Vorhabens bezüglich dieses Umweltbereichs werden als tragbar erachtet.
|
PH-HU2 Kul 01 |
Überprüfen allfälliger Eingriffe in den Untergrund bzgl. IVS-Substanz (Bauphase) Im Bereich des Eingliederungssaums ist zu überprüfen, ob bauliche Eingriffe in den Untergrund den Verlauf des historischen Verkehrsweges tangieren. Bei Bedarf sind in Abstimmung mit der kantonalen Fachstelle Schutzmassnahmen vorzusehen. |
