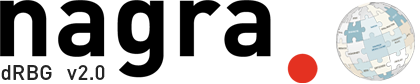A. Herleitung der maximalen Lagerkapazität für die Abfallkategorien HAA, ATS und SMA (NTB 24-01)
Gesetzliche Vorgaben
Zu den mit der Rahmenbewilligung festzulegenden Grundzügen des Projektes gehören die Kategorien des Lagerguts (HAA, ATA, SMA; Art. 51 KEV) sowie damit verknüpft die maximale Lagerkapazität (Art. 14 Abs. 2 Bst. b KEG). In der Botschaft zum KEG wird die maximale Lagerkapazität mit «Höchstvolumen» bzw. der «Höchstanzahl Gebinde» umschrieben (vgl. Botschaft KEG, 2766 f.).
Der Gesetzgeber sieht vor, dass in der Rahmenbewilligung die Grössenordnung der Lagerkapazität erkennbar ist. Eine Präzisierung erfolgt anschliessend im Rahmen des mehrstufigen Bewilligungsverfahren nach KEG. So wird mit der Baubewilligung die Kapazität der Anlage festgelegt (Art. 17 Abs. 1 Bst. c KEG) und mit der Betriebsbewilligung werden Grenzwerte für die Aktivität der einzulagernden Abfälle definiert (Art. 37 Abs. 3 KEG).
Herleitung der maximalen Lagerkapazität
Der Sicherheitsnachweis für das RBG ist auf Basis des derzeit erwartenden Inventars zu erbringen (ENSI 2018a). Dies entspricht dem Inventar, so wie es im MIRAM für das RBG (Nagra 2023c) wiedergegeben ist. Das erwartende Inventar, welches periodisch aktualisiert und überprüft wird, ist auch den jeweiligen Sicherheitsnachweisen für die Bau- und Betriebsbewilligung zugrunde zu legen.
Für die Herleitung bzw. Begründung der maximalen Lagerkapazität im RBG wird das derzeit erwartende Inventar eindeutig von demjenigen abgegrenzt, welches nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse anfällt. Für die Ermittlung des letzteren werden sog. Planungsreserven ausgewiesen. Diese basieren auf Annahmen und werden so quantifiziert, dass Änderungen, die zu grösseren Abfallvolumen führen (u. a. Verlängerung der Betriebszeiten der KKW, verlängerte Einlagerung von MIF ins geologische Tiefenlager, betriebsbedingte Abweichungen bei der Abfallbehandlung) Rechnung getragen werden kann. In Anbetracht des hundertjährigen Zeithorizonts des Vorhabens geologisches Tiefenlager sind zusätzliche Planungsreserven vorzusehen. Diese zusätzlichen Planungsreserven bezwecken, dass mit der Rahmenbewilligung auch die Konsequenzen von schwer voraussehbaren Ereignissen bzw. von Veränderungen der äusseren Umstände so weit wie möglich abgedeckt sind.
Entsprechend dem Gebot zur Optimierung (ENSI 2023a) muss es möglich sein,
-
dass heutige Konzepte mit Auswirkungen auf die anfallende Menge radioaktiven Abfalls bei Bedarf an neue Gegebenheiten angepasst werden können
-
dass Erfahrungen aus fortgeschrittenen Entsorgungsprogrammen im Ausland im schweizerischen Programm berücksichtigt werden können
-
der kerntechnischen Forderung zur Berücksichtigung des Stands der Technik gerecht zu werden
-
allfälligen Änderungen der Gesetzgebung Rechnung zu tragen (z. B. Änderung der Befreiungsgrenzen, bei welcher ein Material als radioaktiver Abfall einzustufen ist)
-
auf Entwicklungen einzutreten, die nur schwer voraussehbar sind
Die im Folgenden dargelegten Vorschläge für die maximale Lagerkapazität für die Abfallkategorien HAA, ATA und SMA beziehen sich auf das unverpackte Volumen. Diese Volumenangabe ist leichter nachvollziehbar, da Planungsreserven dargelegt werden können, ohne auf Aspekte der Verpackung einzugehen. Wird zudem die maximale Lagerkapazität als unverpackte Volumen festgelegt, bleibt die erforderliche Flexibilität erhalten, im Hinblick auf spätere Bewilligungsschritte nach KEG die effektiv verwendeten Endlagerbehälter unter Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte (z. B. Transport, Bau, Betrieb, Betriebs- und Langzeitsicherheit) zu optimieren.
Zur Erörterung von Aspekten mit potenziellem Bezug zur Sicherheit und Lagerauslegung sind in Tab. A-1 auch verpackte Volumen angegeben. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass die Verpackung unter Fortsetzung der bestehenden Verpackungskonzepte erfolgen würde.
Maximale Lagerkapazität für die Abfallkategorie HAA
Für die Abfallkategorie HAA wird eine maximale Lagerkapazität von 2'500 m3 unverpacktes Abfallvolumen vorgeschlagen. Gemäss MIRAM für das RBG (Nagra 2023c) fallen ca. 1'550 m3 HAA als unverpacktes Abfallvolumen an. Die Planungsreserven betragen 650 m3 (Tab. A-1). Da die vorgeschlagene maximale Lagerkapazität eine abdeckende Richtgrösse darstellt, wurde für HAA die resultierende Summe von 2'200 m3 für den Vorschlag auf 2'500 m3 entsprechend aufgerundet. Würde die HAA-Planungsreserve vollumfänglich in Anspruch genommen, erhöht sich das einzulagernde HAA-Abfallvolumen um ca. den Faktor 1.6.
Der Hauptbestandteil der Planungsreserven umfasst HAA, die sich ergeben, falls die KKW länger betrieben werden. Da die Anzahl der BE in erster Näherung proportional zur Laufzeit ist, führt jede Verlängerung der Laufzeiten der sich in Betrieb befindenden schweizerischen KKW um 5 Jahre zu einer Zunahme um etwas über 1'000 BE. Geht man anstatt von einem 60-jährigen von einem 80-jährigen Betrieb aus, führt dies zu zusätzlichen 4'300 BE. Dies entspricht einem unverpackten Abfallvolumen von 550 m3.
Die Anzahl der BE ist auch abhängig von der Anreicherung und dem Abbrand. Auch wenn derzeit keine Verminderung als wahrscheinlich erachtet wird, ist für Unvorhergesehenes eine Reserve einzuplanen. Reduziert man beispielhaft den maximalen Abbrand auf 40 GWd/tHM48 führt dies zu 800 zusätzlichen BE. Dies entspricht einem unverpackten Abfallvolumen von 100 m3.
Maximale Lagerkapazität für die Abfallkategorie SMA
Für die Abfallkategorie SMA wird eine maximale Lagerkapazität von 100'000 m3 unverpacktes Abfallvolumen vorgeschlagen. Gemäss MIRAM für das RBG (Nagra 2023c) fallen ca. 43'000 m3 SMA als unverpacktes Abfallvolumen an. Die Planungsreserven betragen 55'000 m3 (Tab. A-1). Da die vorgeschlagene maximale Lagerkapazität eine abdeckende Richtgrösse darstellt, wurde für SMA die resultierende Summe49 von 98'000 m3 für den Vorschlag auf 100'000 m3 entsprechend aufgerundet.
Die Planungsreserven für SMA basieren auf folgenden Überlegungen:
-
Am meisten ins Gewicht fallen Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Stilllegung von Kernanlagen. Für diese werden 30'000 m3 Reserven antizipiert. Können Materialien bei der Stilllegung nicht gemäss den Vorgaben der StSV freigemessen werden, führt dies zu einem Mehrvolumen an SMA-Abfällen. Ebenso verhält es sich, falls Befreiungsgrenzen50 verschärft würden. Kommt es zudem bei der Zuweisung von Stilllegungsabfällen für die Abklinglagerung zu Abweichungen von den modellhaften Annahmen, so fallen signifikant höhere Volumen an sehr schwachaktiven Abfällen an. Bei den hier beschriebenen Abfällen weicht das verpackte Volumen (32'000 m3) nur unwesentlich vom unverpackten Volumen ab.
-
Durch eine allfällige Verlängerung der Laufzeiten der KKW fallen zusätzliche Betriebs- und Reaktorabfälle an (5'000 m3 unverpackt).
-
Die Planungsreserven umfassen ein Reservevolumen für MIF. So fallen auch nach dem planmässigen Verschluss des SMA-Lagerteils MIF-Abfälle in der Schweiz an. Ebenso würde ein längerer Betrieb der Kernanlagen beim PSI und CERN zu zusätzlichen MIF führen. Der Bund ist bestrebt, sich die Flexibilität über die Rahmenbewilligung hinaus zu wahren, damit bis zum Verschluss des Gesamtlagers MIF im gTL eingelagert werden könnten. In einer Studie geht der Bund von bis zu 4'000 m3 aus (Agneb 2019). Als abdeckende Annahme wird 5'000 m3 unverpacktes Volumen unterstellt.
-
Die Planungsreserven umfassen auch einen Zuschlag von 5 % für das allfällige Mehrvolumen, welches aufgrund von betriebsbedingten Abweichungen von optimierten Abläufen beim Abfallverursacher anfallen könnte. Gründe sind u. a. unerwartete betriebsbedingte Abweichungen vom Grundsatz der Abfallminimierung, sowie Mehrvolumen, welches resultiert, wenn eine volumenoptimierte Beladung von Endlagerbehälter aufgrund z. B. von geometrischen Gründen nicht erfolgen kann. Es wird angenommen, dass bei diesen Abfällen das verpackte Volumen (6'000 m3) nur wenig vom unverpackten Volumen (5'000 m3) abweichen würde.
-
Schliesslich umfassen die Planungsreserven auch einen generellen Zuschlag von 10 % bezüglich des Gesamtvolumens. Gründe sind Ungewissheiten bei der Quantifizierung von zukünftig zu erwartenden Abfallströmen, sowie Unvorhergesehenes und Unwägbarkeiten bis zum Einlagerungsbeginn SMA bzw. dem Verschluss des Lagers. Es wird wiederum angenommen, dass bei diesen Abfällen das verpackte Volumen (12'000 m3) nur wenig vom unverpackten Volumen (10'000 m3) abweichen würde.
Maximale Lagerkapazität für die Abfallkategorie ATA
Für die Abfallkategorie ATA51 wird eine maximale Lagerkapazität von 600 m3 unverpacktes Abfallvolumen vorgeschlagen. Gemäss Nagra (2023c) ist von ca. 300 m3 unverpacktem Volumen für ATA aus der Wiederaufarbeitung, der Stilllegung und dem MIF-Bereich auszugehen. Die Planungsreserven umfassen nochmals 300 m3 unverpacktes Volumen und basieren auf folgenden Überlegungen:
-
Durch allfällige längere Laufzeiten fallen 30 m3 unverpackte zusätzliche ATA aus dem Betrieb der KKW an.
-
In Analogie zu SMA führen eine Verlängerung der MIF-Sammelperiode sowie ein allfälliger längeren Betrieb von Anlagen beim PSI und CERN zu 20 m3 unverpackten zusätzlichen ATA.
-
Am meisten ins Gewicht fällt bei ATA ein Szenario, bei welchem die derzeitige Gesetzeslage geändert würde und die Wiederaufarbeitung wieder aufgenommen würde. Falls alle existierenden BE wiederaufgearbeitet würden, würden diese zu 250 m3 unverpacktem Abfallvolumen führen.
Auswirkungen einer Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität auf die Langzeitsicherheit und den Platzbedarf des geologischen Tiefenlagers
Das im Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase (Nagra 2024v) betrachtete Lagerkonzept basiert auf einem Sicherheitskonzept mit einem gestaffelten System passiver, geologischer und technischer Barrieren. Dem gTL als Ganzes und den einzelnen Barrieren werden dabei Sicherheitsfunktionen (vgl. Kap. 3.2.2 in Nagra 2024v) zugeordnet, welche weitgehend unabhängig sind von der absoluten Grösse des Radionuklidinventars. Entsprechend der Vorgaben in der Präzisierung der sicherheitstechnischen Vorgaben für Etappe 3 des SGT (ENSI 2018a) ist der Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase für das RBG in Nagra (2024v) mit dem Inventar des MIRAM für das RBG (Nagra 2023c) erbracht.
Die Auswirkungen zur Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität auf die Langzeitsicherheit sind mit einem Inventar erläutert, welches die maximale Lagerkapazität ausschöpft und im Folgenden als skaliertes Inventar bezeichnet wird. Im Vergleich zum MIRAM-RBG ergeben sich Skalierungsfaktoren von ca. 1.6 für das HAA-Lager und ca. 2.3 für das SMA-Lager52, jeweils bezogen auf das unverpackte Volumen (Tab. A-1).
Die Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität würde die Nachweisführung zur Langzeitsicherheit des gTL nicht wesentlich beeinflussen. Denn sowohl die zu bewertenden lagerinduzierten Effekte (Nagra 2024ac) als auch die radiologischen Konsequenzen (Nagra 2024y), die durch ein skaliertes Abfallinventar entstehen, unterscheiden sich nicht wesentlich von den relevanten Prozessen und Phänomenen gemäss Sicherheitsnachweis (Nagra 2024v).
Aufgrund des skalierten Inventars und entsprechender Lagergrösse, sind folgende lagerinduzierte Effekte relevant:
-
Temperaturentwicklung: Die Temperaturverteilung im Nah- und Fernfeld bleibt vergleichbar mit den in Nagra (2024ac) berechneten thermischen Entwicklungen, wenn das Lagerfeld bei einem skalierten Inventar entsprechend ausgeweitet werden würde. Die Wärmeleistung pro m2 Lagerfläche und die daraus resultierende Wärmestromdichte in [W/m2] würde somit bei Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität unverändert bleiben.
- Die Gasdruckentwicklung wird massgeblich durch das Verhältnis von Gasproduktion zu Speichervolumen bestimmt (Nagra 2024w). Das Speichervolumen für Gas hängt im Wesentlichen vom Ausbruchvolumen der Untertagebauwerke ab, das sich proportional zum Abfallvolumen vergrössern würde. Es wurde nachgewiesen, dass ausreichend Speichervolumen in den Zugangsbauwerken die Gasdruckentwicklung günstig beeinflusst (z.B. base case in Nagra (2024w) mit gasdurchlässigen V1- und V2-SMA Siegeln).
Da der zentrale Bereich des gTL zwar für die Gasspeicherung zur Verfügung steht, jedoch unabhängig vom Abfallvolumen ist, führt ein skaliertes Abfallinventar zu einem leicht grösseren Verhältnis von Abfall- zu Tunnelvolumen. Falls erforderlich, kann jedoch durch geeignete bauliche Massnahmen – beispielsweise eine Verlängerung der Bau- und Betriebstunnel – das notwendige Speichervolumen für Gas sichergestellt werden. Im Rahmen von Sensitivitätsstudien wurde gezeigt, wie sich der Einfluss des Gasspeichervolumens in den Zugangsbauwerken auf den Gasdruck in den Lagerkavernen auswirkt (z.B. Case 7: Low-permeability seal V1-L/ILW in Nagra (2024w)).
In der Analyse der radiologischen Konsequenzen (Nagra 2024y) werden die Quellterme zur Radionuklidfreisetzung auf einen einzelnen Endlagerbehälter bezogen. Die konzeptualisierte Freisetzung erfolgt vom Endlagerbehälter vertikal nach oben und unten durch den EG in die regionalen Aquifersysteme (Kap. 7 in Nagra 2024y). Die Gesamtdosis der freigesetzten Radionuklide ergibt sich aus der Summe der Beiträge aller eingelagerten Endlagerbehälter. Bei Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität erhöht sich die berechnete Dosis des gesamten Radionuklidinventars proportional zur Anzahl der eingelagerten Behälter und liegt immer noch mehrere Grössenordnungen unter dem Schutzkriterium.
Aufgrund dieser Erläuterungen bleibt der Sicherheitsnachweis der Nachverschlussphase (Nagra 2024v) auch für eine maximale Lagerkapazität gültig.
Bei der Ausnutzung der maximalen Lagerkapazität würde sich der Platzbedarf des gTL erhöhen53. Unter Annahme des RBG-Inventars und der exemplarischen Auslegung des gTL umfassen die einschlusswirksamen Gebirgsbereiche rund 2 km2 für das HAA-Lager und rund 1.2 km2 für das SMA-Lager (Kap. 3.1.6 in Nagra 2024f). Da die potenzielle Lagerzone von 22 km2 komplett in den vorgeschlagenen vorläufigen Schutzbereich integriert ist (vgl. Kap. 5.1.1), reicht das Platzangebot aus, selbst wenn der Platzbedarf gemäss maximaler Lagerkapazität um den Faktor 1.6 für das HAA-Lager und 2.3 für das SMA-Lager erhöht würde.
Tab. A‑1:Abfallvolumen (realistisches Inventar (MIRAM) und Planungsreserven) für die Abfallkategorien HAA, SMA und ATA als Grundlage für die Herleitung der maximalen Lagerkapazität
Zur Erörterung von Aspekten der Sicherheit umfasst die Tabelle auch Angaben zu verpackten Volumen.
|
HAA |
SMA54 |
ATA (separat ausgewiesen) |
|||||
|
Anzahl BE |
m3 unverpackt |
m3 verpackt |
m3 unverpackt |
m3 verpackt |
m3 unverpackt |
m3 verpackt |
|
|
MIRAM (Nagra 2023c) aufgerundet |
12'500 |
1'55055 |
9'300 |
43'000 |
84'000 |
300 |
1'100 |
|
Planungsreserven: |
650 |
5'550 |
55'000 |
74'000 |
300 |
1'300 |
|
|
- Längerer Betrieb KKW |
4'300 |
550 |
4'900 |
5'000 |
16'000 |
30 |
130 |
|
- Reserve Anreicherung / Abbrand BE |
800 |
100 |
650 |
||||
|
- Wiederaufarbeitung (Gesetzesänderung wäre erforderlich)56 |
250 |
1'100 |
|||||
|
- Reserve für allfällige Abweichung durch Veränderungen der Freimessgrenzen |
30'000 |
32'000 |
|||||
|
- Reserve infolge einer Verlängerung der MIF-Sammelperiode |
5'000 |
8'000 |
20 |
70 |
|||
|
- Reserve für betriebsbedingte Abweichungen von optimierten Abläufen |
5'000 |
6'000 |
|||||
|
- Genereller Zuschlag für Unvorhergesehenes bei SMA (ca. 10% auf Gesamtsumme unverpackt) |
10'000 |
12'000 |
|||||
|
Summe berechnet (MIRAM plus Planungsreserven) |
2'200 |
14'850 |
98'000 |
158'000 |
600 |
2'400 |
|
|
Beantragte maximale Lagerkapazität (aufgerundet auf abdeckende Richtgrösse) |
2'500 |
100'000 |
600 |
||||
Die Abschätzung geht von einer gleichbleibenden Energieproduktion ab 2025 aus. Dazu müsste der Brennstoff häufiger gewechselt werden; dies führt zu zusätzlichen BE. GWd/tHM = Gigawatt x Tag / Tonne Brennstoff. ↩
Zur Vereinfachung beinhalten die Angaben zur Abfallkategorie SMA auch ATA (< 1% des unverpackten Volumens). Diese Vereinfachung ist angezeigt, da die ATA-Volumen im Vergleich zu den getätigten Rundungen um einiges kleiner sind. ATA werden in der Tabelle (Tab. A-1) nur deshalb separat ausgewiesen, um der Vorgabe Rechnung zu tragen, dass mit der Rahmenbewilligung für jede Abfallkategorie (HAA, ATA, SMA) eine maximale Lagerkapazität festzulegen ist. ↩
Die Befreiungsgrenze (LL) entspricht derjenigen massenspezifischen Aktivität, unterhalb welcher der Umgang mit einem Material nicht mehr der Bewilligungspflicht und demnach auch nicht mehr der Aufsicht unterstellt ist. ↩
Der Anfall an ATA ist im Vergleich zu SMA sehr klein (< 1% des unverpackten Volumens). ↩
Der Platzbedarf für die OFA (Projektperimeter, vgl. Kap. 2.3.1 und 2.3.2) würde sich nicht verändern. ↩
Zur Vereinfachung beinhalten die Angaben zur Abfallkategorie SMA auch ATA (< 1% des unverpackten Volumens). Diese Vereinfachung ist angezeigt, da die ATA-Volumen im Vergleich zu den getätigten Rundungen um einiges kleiner sind. ATA werden in der Tabelle (Tab. A-1) nur deshalb separat ausgewiesen, um der Vorgabe Rechnung zu tragen, dass mit der Rahmenbewilligung für jede Abfallkategorie (HAA, ATA, SMA) eine maximale Lagerkapazität festzulegen ist. ↩
Zusätzlich zu 1'430 m3 BE existieren 120 m3 Abfälle aus der Wiederaufarbeitung und dem MIF-Bereich (Nagra 2023c). ↩
Im Falle einer erneuten Wiederaufarbeitung würden zwar sog. WA-HAA entstehen (Nagra 2023c). Da dadurch das Volumen an HAA insgesamt reduziert wird, werden diese nicht aufgeführt. ↩